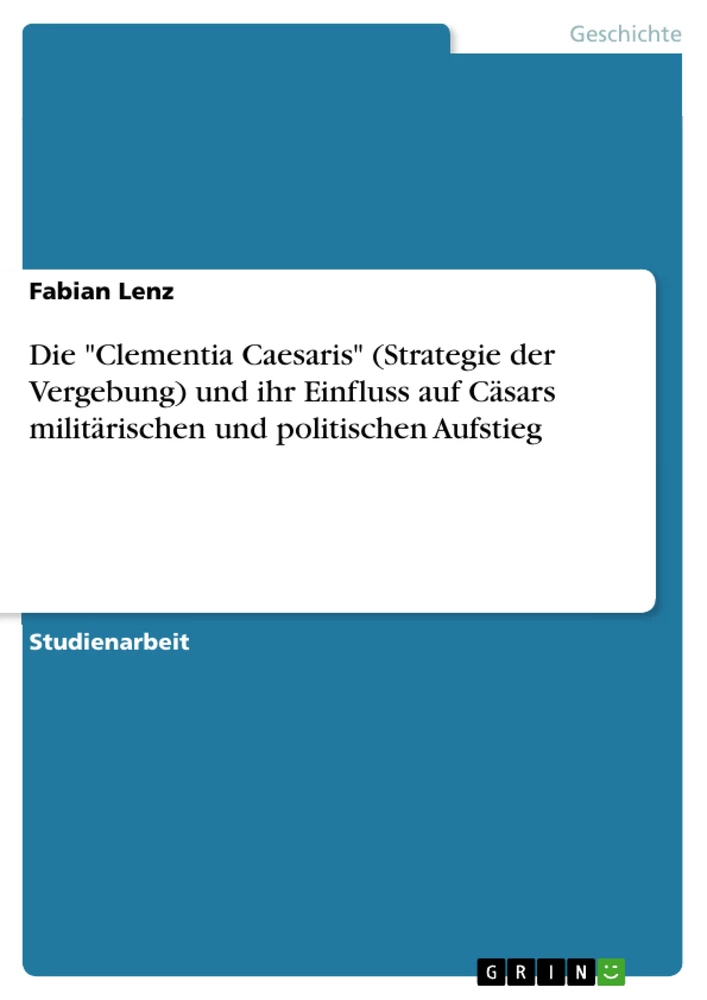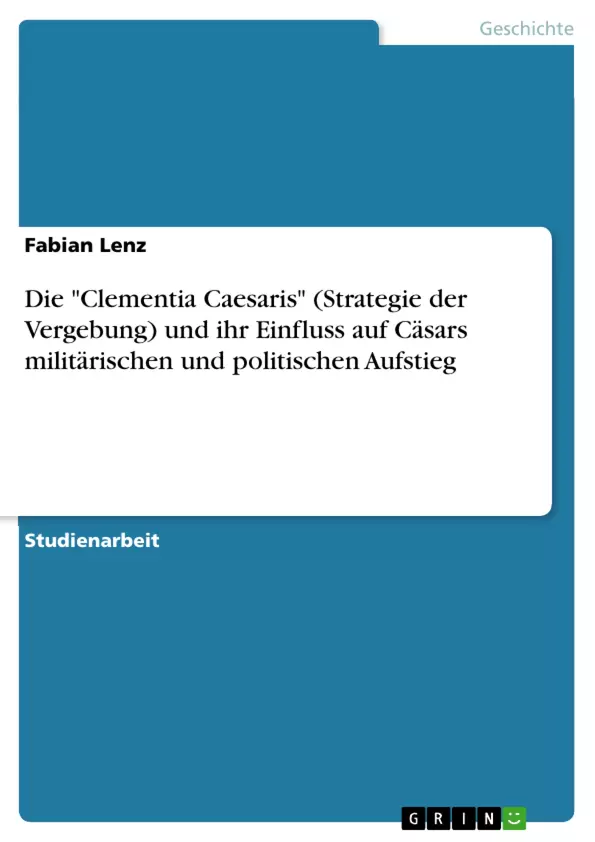In dieser Hausarbeit soll es um Cäsars berühmt gewordene „Strategie der Vergebung“, die „Clementia Caesaris“ (lat. Gnade Cäsars/Gnade des Kaisers) gehen und welchen Einfluss sie auf Cäsars militärischen und politischen Aufstieg gehabt hat.
Hierzu wird in dieser Arbeit zunächst eine kurze Vorstellung der Person Gaius Julius Cäsars erfolgen, ehe dann eine Begriffserklärung der „Clementia“ vorgenommen wird. Im Anschluss daran steht dann eine Beleuchtung einiger Beispiele für jene Taktik Cäsars aus der Epoche des römischen Bürgerkriegs von 49-45 v. Chr. Zum Abschluss soll dargelegt werden, wie zum einen die Zeitgenossen Cäsars über sein Handeln dachten, zum anderen auch um die postume Darstellung Cäsars.
Im Fazit wird es dann schließlich um eine Beurteilung gehen, ob Cäsars Feldzüge tatsächlich von solcher Milde geprägt waren und wenn ja, inwieweit sie ihm dienlich für seinen Aufstieg, bzw. für das spätere Bild des römischen Staatsmannes war.
Als Textgrundlage dienen hierbei einschlägige Biografen Cäsars wie etwa die von Helga Gesche oder Matthias Gelzer, zum anderen jedoch auch Quellen der zeitgenössischen Autoren bzw. deren Übersetzungen.
Hinsichtlich der Quellenlage scheint, angesichts der Bedeutung und Popularität Julius Cäsars, ein relativ großer Fundus an Werken zur Verfügung zu stehen, wobei zu beachten gilt, dass auch manche der antiken Autoren erst mit signifikantem zeitlichem Abstand die zurückliegenden Ereignisse schildern. Weiterhin ergeben sich auch, aufgrund der zumeist tendenziös verfassten Berichte, Schwierigkeiten, weshalb es geboten ist, Schriften nach der Motivation und politischen Einstellung ihrer Verfasser, zu beurteilen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gaius Julius Cäsar
- Clementia
- Beispiele der Clementia Caesaris
- Die Catilinarische Verschwörung
- Bellum Gallicum
- Bellum Civile
- Urteil der Zeitgenossen
- Protagonisten des Bürgerkriegs
- Postume Rezeption
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Gaius Julius Cäsars „Strategie der Vergebung“, die „Clementia Caesaris“, und deren Einfluss auf seinen militärischen und politischen Aufstieg. Die Arbeit beleuchtet zunächst Cäsars Person und erklärt den Begriff der „Clementia“. Anschließend werden Beispiele aus der Epoche des römischen Bürgerkriegs (49-45 v. Chr.) untersucht, um Cäsars Vorgehensweise zu verdeutlichen. Abschließend werden die zeitgenössische Meinung und die postume Darstellung Cäsars betrachtet. Im Fazit wird bewertet, ob Cäsars Feldzüge tatsächlich von Milde geprägt waren und wie diese seinen Aufstieg beeinflusst hat.
- Cäsars Persönlichkeit und seine Rolle im römischen Staat
- Der Begriff „Clementia“ und seine Bedeutung im römischen Kontext
- Cäsars „Strategie der Vergebung“ und ihre Auswirkungen auf seine militärische und politische Karriere
- Zeitgenössische und postume Rezeption von Cäsars „Clementia“
- Bewertung der Rolle der Milde in Cäsars Feldzügen und ihre Auswirkungen auf sein Vermächtnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach dem Einfluss der „Clementia Caesaris“ auf Cäsars Aufstieg. Das Kapitel „Gaius Julius Cäsar“ bietet einen kurzen Überblick über Cäsars Leben und Karriere, wobei seine familiären Beziehungen, seine politische Karriere und seine militärischen Leistungen beleuchtet werden. Der Abschnitt „Clementia“ definiert den Begriff der „Clementia“ und erläutert seine Bedeutung im römischen Kontext.
Das Kapitel „Beispiele der Clementia Caesaris“ befasst sich mit konkreten Beispielen aus der Epoche des römischen Bürgerkriegs, um Cäsars „Strategie der Vergebung“ zu illustrieren. Hier werden die Catilinarische Verschwörung, die „Bellum Gallicum“ und die „Bellum Civile“ näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind „Clementia Caesaris“, „Strategie der Vergebung“, „römischer Bürgerkrieg“, „Militärstrategie“, „politischer Aufstieg“, „Zeitgenössische Rezeption“, „Postume Rezeption“. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Cäsars „Clementia“ als strategisches Mittel für seinen militärischen und politischen Erfolg diente und wie er in der Antike und der Moderne wahrgenommen wurde.
- Quote paper
- Fabian Lenz (Author), 2021, Die "Clementia Caesaris" (Strategie der Vergebung) und ihr Einfluss auf Cäsars militärischen und politischen Aufstieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1126188