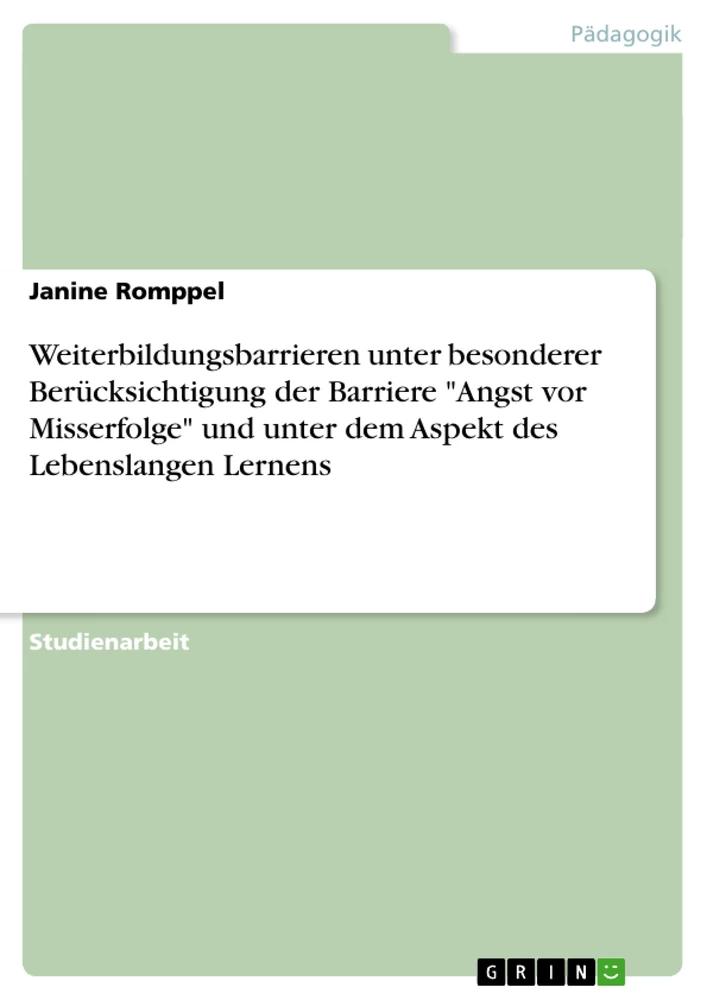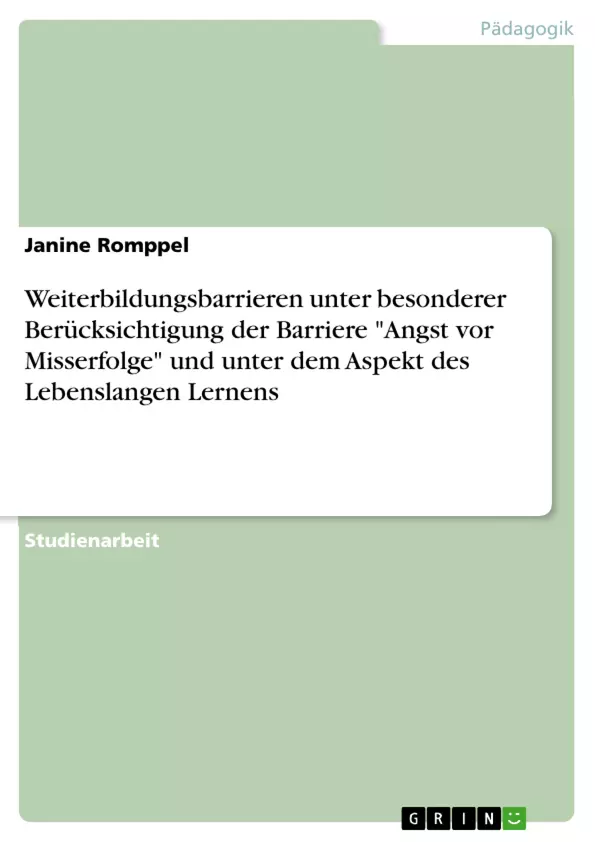Europa befindet sich in einer gewaltigen Umbruchphase, auf dem Wege in ein Zeitalter des Wissens, verknüpft mit Veränderungen im kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen Leben. Die Ergebnisse des Europäischen Rates von Lissabon im März 2000 betonen, dass der gelungene Übergang zu einer auf Wissen basierenden Gesellschaft, mit einer Ausrichtung zum lebenslangen Lernen einhergehen muss. Als eines von vielen Zielen wird das Erreichen
höherer Bildungs,- und Qualifikationsniveaus benannt, das nicht nur hochwertige Bildungs- und Berufsbildungsangebote sichern soll, sondern gleichzeitig Kenntnisse und Fähigkeiten gewährleistet, die den sich stetig ändernden Anforderungen von Arbeitsplätzen, Tätigkeiten und Arbeitsverfahren, angepasst sind (vgl. Memorandum 2006). Weiterbildung erscheint hier
als eine das Ziel unterstützende Maßnahme und soll innerhalb dieser Arbeit näher beleuchtet werden. Weiterbildung ist freiwillig und für jeden Menschen grundsätzlich zugänglich. Ob aus Eigeninitiative, Interesse oder beruflicher Pflichterfüllung, die Beweggründe, an Weiterbildungen teilzunehmen, unterscheiden sich. Doch wie die von Schiersmann durchgeführte empirische Untersuchung über berufliche Bildung und Barrieren 2006 zeigt, gibt
es auch Motive warum nicht an Weiterbildung teilgenommen wird. Nur 50% der
Erwerbspersonen formulieren einen zukünftigen Weiterbildungsbedarf. Diese Tatsache wirft die Frage auf, warum sich Menschen der Weiterbildung enthalten. Was stellt sich ihnen in den Weg? Die am häufigsten genannten Barrieren, die die Teilnahme an einer Weiterbildung erschweren oder nicht ermöglichen sind u.a. Mangel an Zeit sowie der fehlende Nutzen (vgl. Schiersmann 2006, S. 48). Aber auch andere Barrieren seien zu erwähnen, wie etwa der Einfluss des sozialen Milieus auf das Weiterbildungsverhalten (vgl. Tippelt). Besonderen Wert
soll letztendlich auf die Weiterbildungsbarriere “Angst vor Misserfolgen” gelegt werden.
Inwieweit spielt der Einfluss der schulzeitlichen Erfahrung eine Rolle für das
Weiterbildungsverhalten und somit für die Teilnahme an Weiterbildung?
Um sich der Thematik Weiterbildungsbarrieren unter besonderer Berücksichtigung der Kategorie „Angst vor Misserfolge“, zu nähern, ist es inhaltlich sinnvoll, Begriffe wie Weiterbildung, Weiterbildungsmotiv und Weiterbildungsinteresse zu klären und sich einen Überblick über die Teilhabe an Weiterbildung zu verschaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Weiterbildung als Bestandteil Lebenslangen Lernens
- Lebenslanges Lernen
- Begriff der Weiterbildung
- Weiterbildungsbeteiligung
- Lernmotivation als zentraler Aspekt der Weiterbildung
- Weiterbildungsbarrieren
- Was sind Weiterbildungsbarrieren?
- Untersuchungen zu Weiterbildungsbarrieren
- Christiane Schiersmann
- Milieustudie von Tippelt und Barz
- Vergleich der Studien und Kritik
- Angst vor Misserfolg als Weiterbildungsbarriere
- Der Begriff der Angst
- Was ist Schulangst?
- Angst vor Misserfolge als Nichteilnahmemotiv?
- Der Begriff der Angst
- Fazit
- Literaturliste
- Abbildungsliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Weiterbildungsbarrieren, insbesondere mit der Barriere "Angst vor Misserfolg", im Kontext des Lebenslangen Lernens. Ziel ist es, anhand empirischer Studien verschiedene Weiterbildungsbarrieren zu analysieren und die Auswirkungen von Angst auf das Weiterbildungsteilnahmeverhalten zu untersuchen.
- Lebenslanges Lernen als gesellschaftliches Konzept
- Weiterbildungsbarrieren und ihre Ursachen
- Angst vor Misserfolg als Motiv für die Nichtteilnahme an Weiterbildung
- Empirische Studien zur Weiterbildungsbeteiligung und -motivation
- Implikationen für die Gestaltung von Weiterbildungsangeboten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Weiterbildungsbarrieren ein und stellt die Relevanz des Lebenslangen Lernens in der heutigen Gesellschaft heraus. Sie beleuchtet die Bedeutung von Weiterbildung für die Anpassungsfähigkeit an den sich stetig wandelnden Arbeitsmarkt und die Herausforderungen, die mit der Teilnahme an Weiterbildung verbunden sind.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Konzept des Lebenslangen Lernens und erläutert seine Bedeutung für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs und die verschiedenen Facetten des Lebenslangen Lernens, wobei der Fokus auf der Rolle der Weiterbildung als wichtiger Bestandteil dieses Konzepts liegt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Weiterbildungsbarrieren. Es definiert den Begriff der Weiterbildungsbarrieren und stellt verschiedene Studien vor, die sich mit den Ursachen und Auswirkungen von Weiterbildungsbarrieren auseinandersetzen. Die Kapitelzusammenfassung beleuchtet die Ergebnisse dieser Studien und zeigt die vielfältigen Faktoren auf, die die Teilnahme an Weiterbildung erschweren oder verhindern können.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Weiterbildungsbarriere "Angst vor Misserfolg". Es analysiert den Begriff der Angst und untersucht die Rolle der Angst vor Misserfolg als Motiv für die Nichtteilnahme an Weiterbildung. Die Kapitelzusammenfassung beleuchtet die psychologischen und sozialen Aspekte der Angst vor Misserfolg und ihre Auswirkungen auf das Weiterbildungsverhalten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Weiterbildungsbarrieren, Lebenslanges Lernen, Angst vor Misserfolg, Weiterbildungsbeteiligung, Lernmotivation, empirische Studien, Bildungsforschung, Erwachsenenbildung, soziale Ungleichheit, Bildungschancen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind typische Barrieren für die Teilnahme an Weiterbildung?
Häufig genannte Gründe sind Zeitmangel, fehlender Nutzen, Einflüsse des sozialen Milieus und psychologische Barrieren wie die Angst vor Misserfolg.
Wie wirkt sich die Angst vor Misserfolg aus?
Diese Angst kann dazu führen, dass Personen sich trotz Bedarf gegen eine Weiterbildung entscheiden, um eine erneute Konfrontation mit negativen Lernerfahrungen zu vermeiden.
Welchen Einfluss hat die Schulzeit auf das spätere Lernverhalten?
Schulängste und negative Erfahrungen in der Kindheit prägen das Selbstbild als Lerner maßgeblich und wirken oft als lebenslange Barriere für die Weiterbildung.
Was bedeutet "Lebenslanges Lernen" im gesellschaftlichen Kontext?
Es ist die Notwendigkeit, Kenntnisse ständig an die sich wandelnde Wissensgesellschaft und den Arbeitsmarkt anzupassen, wie im Lissabon-Prozess der EU betont wurde.
Wie viele Erwerbspersonen sehen tatsächlich Weiterbildungsbedarf?
Empirische Studien (z.B. Schiersmann 2006) zeigen, dass nur etwa 50 % der Erwerbspersonen einen konkreten zukünftigen Weiterbildungsbedarf für sich formulieren.
- Arbeit zitieren
- Janine Romppel (Autor:in), 2008, Weiterbildungsbarrieren unter besonderer Berücksichtigung der Barriere "Angst vor Misserfolge" und unter dem Aspekt des Lebenslangen Lernens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112619