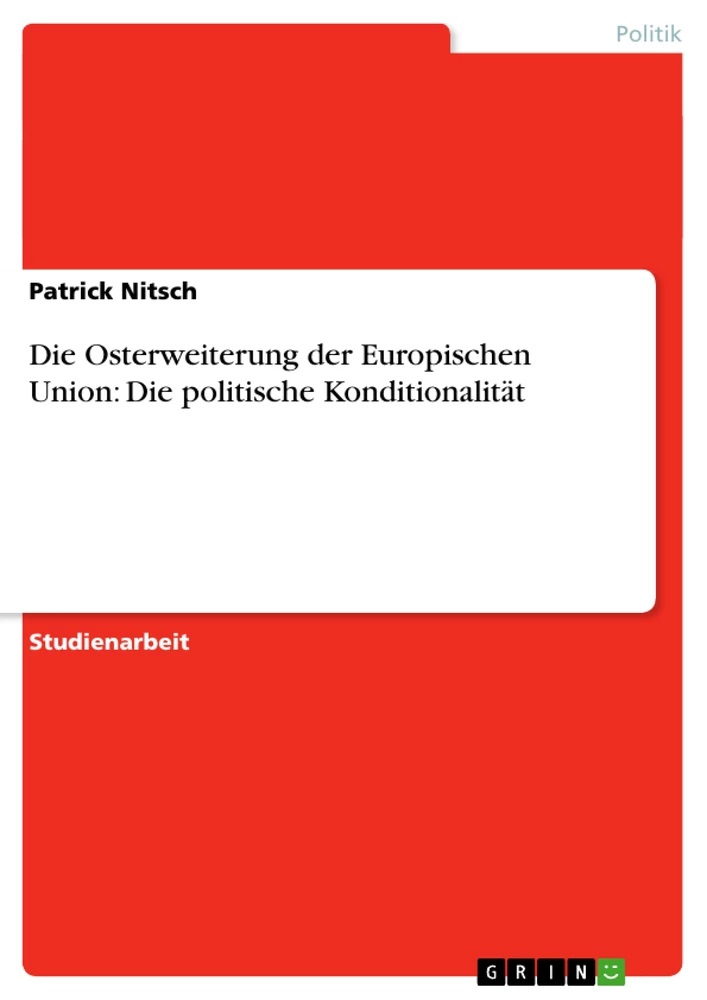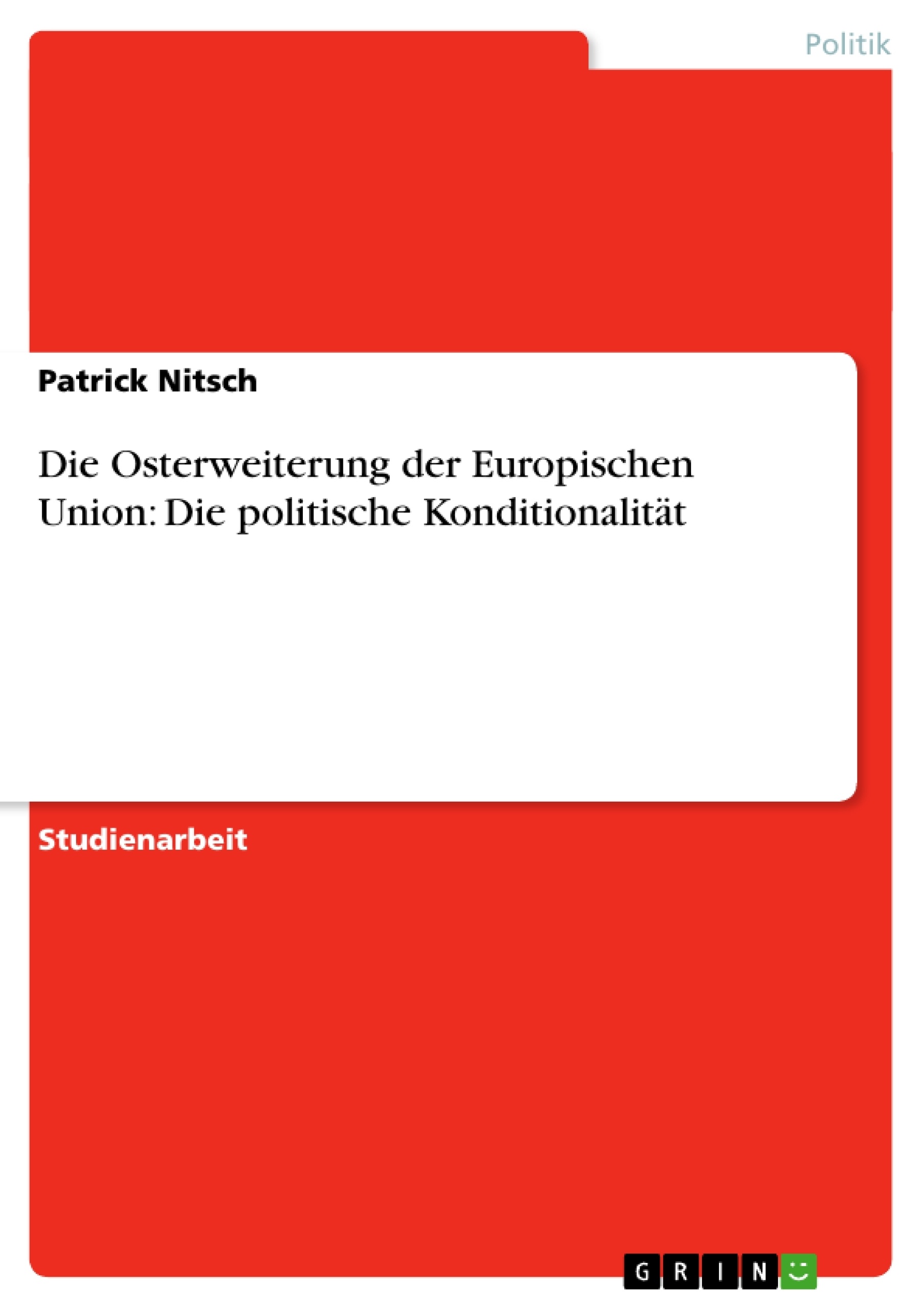Der unmittelbare Beitritt der MOES zu der EU wird die fünfte Erweiterung sein. Bis heute haben die Erweiterungswellen vor allem Kandidaten betroffen, die ein Regierungssystem hatten, das ähnlich zu dem der Mitgliedstaaten war, d.h. ein parlamentarisches und demokratisches System, das den Rechtsstaat, die Menschenrechte und eine wettbewerbsfähige und liberale Marktwirtschaft achtet.
Entsprechend diesen politischen und wirtschaftlichen Kriterien konnte die Süderweiterung1 in den 80er Jahren erst stattfinden, als Griechenland, Portugal und Spanien die Demokratie und den Rechtsstaat wiederhergestellt hatten. Dies bildet die erste Bezeichnung, die später „politische Konditionalität“ genannt wurde. Mitglied der EU zu sein, macht eine Rückkehr zur Macht von antidemokratischen Kräften schwieriger, da diese die Schwäche der Wirtschaft ausnützen.
Erst in den 90er Jahren, mit den Perspektiven der Osterweiterung, erschien die politische Konditionalität in dem gemeinschaftlich-rechtlichen System. Am Ende der 80er Jahre hat die Zersplitterung des Ostblocks die geopolitische Lage in Europa verändert. Die ehemaligen Satellitenstaaten waren frei, aber ohne langfristigen lebensfähigen Aufbau, weshalb ihre erste Reaktion darin bestand, sich für den Beitritt zur EU zu bewerben2.
Tiefgreifende Reformen haben angefangen ein demokratisches und wirtschaftliches System in diesen Staaten zu errichten, das entsprechend mit dem System der Mitglieder der EU eingeführt werden muss. Die EU stellt nämlich in diesen beiden Bereichen die Sicherheit, die Prosperität und die Normalität dar.
Innerhalb der EU wird die Frage gestellt, wie man die MOES integrieren soll, da ihre politische und wirtschaftliche Lage, die für einen Beitritt normalerweise geforderte Ebene nicht erreicht. Das betrifft die folgenden Kriterien: Europäische Identität, Achtung der Demokratie, der Menschenrechte und die Fähigkeit, den Acquis communautaire sind in die nationale Rechtsordnung einzufügen. Dank der MOES konnte die politische Konditionalität in den Konventionalbereich eingeführt worden, da die Gemeinschaft durch Assoziierungsabkommen mit den Kandidaten die politische Konditionalität dort eingefügt hat, um ihre Integration gut vorzubereiten.
Lange wurde über die politische Konditionalität gesprochen, ohne dass sie definiert wurde [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- I. DEFINITION DER POLITISCHEN KONDITIONALITÄT
- A. Die Achtung des Acquis communautaire.
- 1. Die Achtung des Acquis communautaire als traditionelle rechtliche und politische Bedingung für einen Beitritt.
- 2. Die wirtschaftlichen Aspekte des Acquis communautaire
- B. Die Achtung der Grundfreiheiten.
- 1. Die besondere Rolle des Europarats
- 2. Die politische Konditionalität in den gemeinschaftlichen Verträge.
- 3. Die politische Konditionalität und die Beiträge der gemeinschaftlichen Institutionen
- II. DIE EINFÜGUNG DER POLITISCHEN KONDITIONALITÄT IN DIE EUROPAABKOMMEN
- A. Die politische Konditionalität als wesentlicher Bestandteil der Europaabkommen.
- B. Die Sanktion zur Nichtbeachtung der politischen Konditionalität.
- C. Das Verfahren der Weiterverfolgung der Fortschritte.
- III. DIE AGENDA 2000
- A. Die Staaten, die Beitrittsverhandlungen mit der EU angefangen haben.
- B. Die Staaten, die noch warten müssen.
- SCHLUSS
- Die Entwicklung der politischen Konditionalität als Bestandteil der EU-Erweiterungspolitik.
- Die Rolle des Acquis communautaire und der Achtung der Grundfreiheiten.
- Die Integration der politischen Konditionalität in die Europaabkommen und die Agenda 2000.
- Die Herausforderungen und Chancen der Osterweiterung.
- Die Bedeutung der politischen Konditionalität für die Stabilität und Integration der EU.
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Osterweiterung als fünfte Erweiterungswelle der EU dar und beleuchtet den Hintergrund der politischen Konditionalität. Die Erweiterungswellen fokussierten bisher auf Kandidatenländer, die ein ähnliches Regierungssystem wie die EU-Mitgliedstaaten aufweisen.
- Kapitel I: Definition der politischen Konditionalität: Dieses Kapitel untersucht die Definition der politischen Konditionalität, wobei der Fokus auf die Achtung des Acquis communautaire und der Grundfreiheiten liegt. Es beleuchtet die rechtlichen und politischen Voraussetzungen für einen Beitritt und die Rolle des Europarats.
- Kapitel II: Die Einführung der politischen Konditionalität in die Europaabkommen: Das Kapitel analysiert die Einbindung der politischen Konditionalität in die Europaabkommen, die Verfahren zur Überwachung der Fortschritte und die Sanktionen bei Nichtbeachtung der Bedingungen.
- Kapitel III: Die Agenda 2000: Dieses Kapitel betrachtet die Agenda 2000 und die Auswirkungen auf die Osterweiterung. Es unterscheidet zwischen Staaten, die Beitrittsverhandlungen aufgenommen haben und Ländern, die noch auf die Aufnahme der Verhandlungen warten.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der politischen Konditionalität im Kontext der Osterweiterung der Europäischen Union. Sie analysiert die Entwicklung und Implementierung dieses Prinzips, das die Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher Standards sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Voraussetzung für den EU-Beitritt von Ländern Mittel- und Osteuropas definiert.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Osterweiterung, politische Konditionalität, Acquis communautaire, Grundfreiheiten, Europaabkommen, Agenda 2000, Mittel- und Osteuropäische Staaten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliche Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "politische Konditionalität" beim EU-Beitritt?
Es ist das Prinzip, dass Beitrittskandidaten bestimmte demokratische, rechtsstaatliche und menschenrechtliche Standards erfüllen müssen, bevor sie Mitglied werden können.
Warum wurde die Konditionalität in den 90er Jahren so wichtig?
Durch den Zusammenbruch des Ostblocks bewarben sich viele Staaten mit instabilen Systemen; die EU wollte sicherstellen, dass diese Länder stabil und demokratisch integriert werden.
Welche Rolle spielt der "Acquis communautaire"?
Der Acquis communautaire ist der gesamte gemeinsame Rechtsbestand der EU, den jedes neue Mitglied zwingend in sein nationales Recht übernehmen muss.
Was ist die "Agenda 2000"?
Ein Aktionsprogramm der EU, das Reformen der Gemeinschaftspolitik und den finanziellen Rahmen für die Osterweiterung festlegte.
Was passiert bei Nichtbeachtung der politischen Bedingungen?
Die EU sieht Sanktionsmechanismen in den Europaabkommen vor und kann Beitrittsverhandlungen verzögern oder aussetzen.
Welche Bedeutung hat der Europarat in diesem Prozess?
Der Europarat spielt eine besondere Rolle bei der Überwachung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die eine Basis für die politische Konditionalität der EU bilden.
- Quote paper
- Patrick Nitsch (Author), 2002, Die Osterweiterung der Europischen Union: Die politische Konditionalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11262