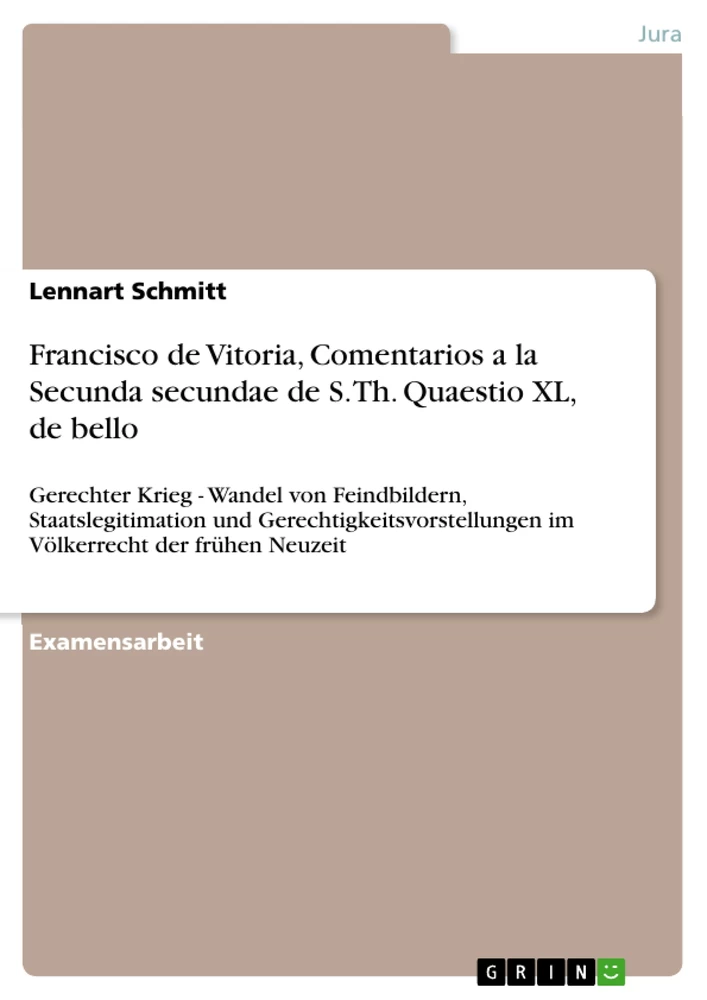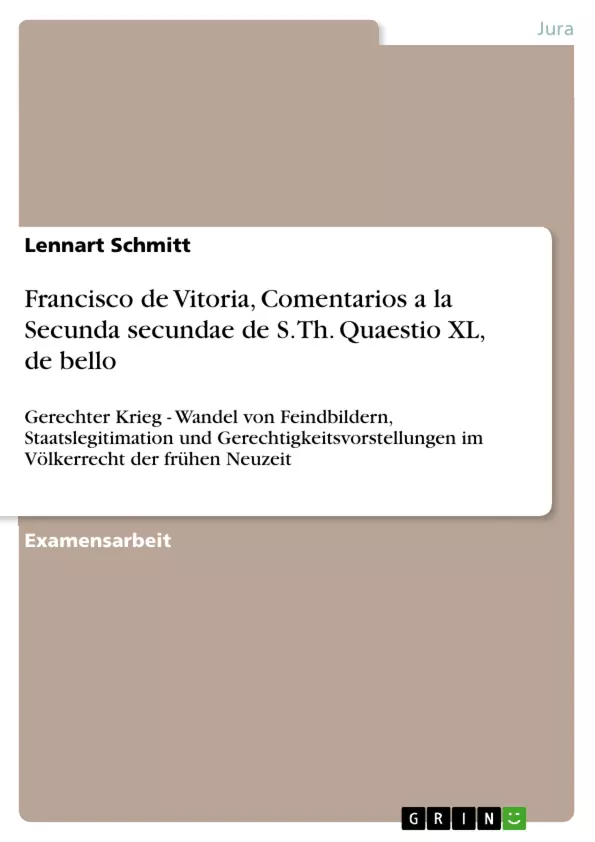A) Einleitung
I. Lebenslauf von Francisco de Vitoria
1. Geburt, Studium, Lehrtätigkeit
Francisco de Arcaya y Compludo wurde 1483 in Burgos (Kastilien) geboren. 1504 trat er als Francisco de Vitoria in den Dominikanerkonvent San Pablo zu Burgos ein. Ca. 1509 begann Vitoria sein Studium in Paris, wo er durch das Kunst- und Philosophiestudium in Berührung mit den Strömungen des Humanismus und Nominalismus kam. Mit Beginn seines Theologiestudiums ca. 1512/13 wurde er maßgeblich von seinem Lehrer und Mitbruder Pierre Crockaert beeinflusst. Mit Crockaert zusammen gab Vitoria den zweiten Teil der „Summa theologica“ des Aquinaten heraus, die Crockaert bereits 1510/12 als Lehrbuch in Paris anstelle der Sentenzen des Petrus Lombardus eingeführt hatte . 1522/23 war Vitoria als Theologielehrer in Valladolid tätig. In einem ordentlichen Berufungsverfahren durch die Studenten wurde Vitoria 1526 als Catédra de Prima auf den bedeutendsten theologischen Lehrstuhl der Universität von Salamanca berufen. Vitoria ersetzte in Salamanca, ebenso wie Crockaert vorher in Paris, die Sentenzen Lombardus durch die mehr Ethik enthaltende „Summa theologica“ des Aquinaten. Damit begann auch in Salamanca der Beginn der Thomasrezeption. Gleichzeitig markierte dies die Einleitung der Spätscholastik, deren bedeutendster Vertreter Vitoria selber war.
Inhaltsverzeichnis
- A) EINLEITUNG
- I. LEBENSLAUF VON FRANCISCO DE VITORIA
- II. ZEITGESCHICHTLICHE EINORDNUNG
- III. QUELLENLAGE, TEXTBEFUND, DATIERUNG, ZIELGRUPPE
- 1. Die ordentlichen Vorlesungen
- 2. Die Relectiones
- 3. Die deutsche Übersetzung
- B) HAUPTTEIL
- I. FRAGESTELLUNG:,,THOMAS-REZEPTION / THOMAS-EVOLUTION“?
- II. ERLÄUTERUNG BZGL. DER „BELLUM IUSTUM“ - LEHRE
- 1. Legitime Autorität
- a) Traditioneller Begriff und Notwendigkeit der Aktualisierung
- b) Das Gemeinwesen
- aa) Das naturrechtlich begründete Gemeinwesen
- bb) Folgen der naturrechtlichen Ableitung des Gemeinwesens
- cc) Revidierung der politischen Theologie mit aristotelischem Gedankengut
- 2. Gerechter Grund
- a) Erlittenes Unrecht als gerechter Kriegsgrund
- b) Der weite Begriff „,bellum“
- c) Die Ausweitung der Strafgewalt des Fürsten
- d) Herkunft einer universell verbindlichen Rechtsordnung
- aa) Interpretation des Begriffes „orbis“
- bb) Das ius gentium als Rechtsgrundlage
- cc) Die Völkergemeinschaft als Gesetzgeber
- e) Die Rolle der Fürsten innerhalb der Völkergemeinschaft
- III. ANLAGE DER VERSCHIEDENEN ASPEKTE DES BEIDERSEITS GERECHTEN KRIEGES IM TEXT „DE BELLO“
- 1. Das Gerichtsverfahren
- a) Die Richterrolle der Fürsten
- b) Die Mitverantwortung des Volkes bzgl. des gerechten Grundes
- 2. Der beiderseits gerechte Krieg
- a) Die einzelnen Bestandteile
- b) Folgen der Möglichkeit eines beiderseits gerechten Krieges
- c) Erweiterung der „bellum-iustum“ – Lehre gegenüber Thomas
- d) Nicht erörterte Folgeprobleme
- e) Der besondere Reiz der Scholastik
- C) SCHLUSS
- I. DIE NATURRECHTLICH BEGRÜNDETE UNIVERSALORDNUNG
- II. KRIEG ALS PROBLEM DER „IUSTITIA“
- III. ENTWURF EINER UNIVERSELLEN RECHTSORDNUNG
- IV. DIE VERANTWORTUNG DER FÜRSTEN
- V. ERWEITERUNG DER „BELLUM-IUSTUM“ - LEHRE
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Lehre des Francisco de Vitoria zum gerechten Krieg, insbesondere mit seinen „Comentarios a la Secunda secundae de S. Th. Quaestio XL, de bello“. Die Arbeit analysiert Vitorias Auseinandersetzung mit der „bellum iustum“-Lehre des Thomas von Aquin und untersucht, wie er diese im Kontext der frühen Neuzeit weiterentwickelt. Dabei werden die naturrechtlichen Grundlagen von Vitorias Argumentation sowie seine Konzeption einer universellen Rechtsordnung im Völkerrecht beleuchtet.
- Die Rezeption und Weiterentwicklung der „bellum iustum“-Lehre des Thomas von Aquin
- Die naturrechtliche Begründung des Gemeinwesens und der universellen Rechtsordnung
- Die Rolle der Fürsten und des Volkes im Kontext des gerechten Krieges
- Die Bedeutung des ius gentium und die Herausbildung einer Völkergemeinschaft
- Die Erweiterung der „bellum iustum“-Lehre durch Vitoria
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Lebenslauf von Francisco de Vitoria sowie die zeitgeschichtliche Einordnung seiner Werke vor. Sie beleuchtet die Quellenlage, den Textbefund, die Datierung und die Zielgruppe der „Comentarios a la Secunda secundae de S. Th. Quaestio XL, de bello“.
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich der Fragestellung nach der „Thomas-Rezeption / Thomas-Evolution“ in Vitorias Werk. Er erläutert die „bellum iustum“-Lehre und analysiert die verschiedenen Aspekte des gerechten Krieges, die Vitoria in seinen „Comentarios“ behandelt. Dabei werden die Themen der legitimen Autorität, des gerechten Grundes, des Gerichtsverfahrens und des beiderseits gerechten Krieges im Detail betrachtet.
Der Schluss der Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und beleuchtet die Bedeutung von Vitorias Werk für die Entwicklung des Völkerrechts. Er betont die naturrechtliche Begründung der universellen Rechtsordnung, die Rolle des Krieges als Problem der „Iustitia“ und die Verantwortung der Fürsten im Kontext des gerechten Krieges.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den gerechten Krieg, die „bellum iustum“-Lehre, Francisco de Vitoria, Thomas von Aquin, Naturrecht, Völkerrecht, ius gentium, Gemeinwesen, Fürsten, Volk, Gerichtsverfahren, universelle Rechtsordnung, Kriegsethik, Spätscholastik, politische Theologie, Aristoteles.
- Quote paper
- Lennart Schmitt (Author), 2008, Francisco de Vitoria, Comentarios a la Secunda secundae de S. Th. Quaestio XL, de bello, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112674