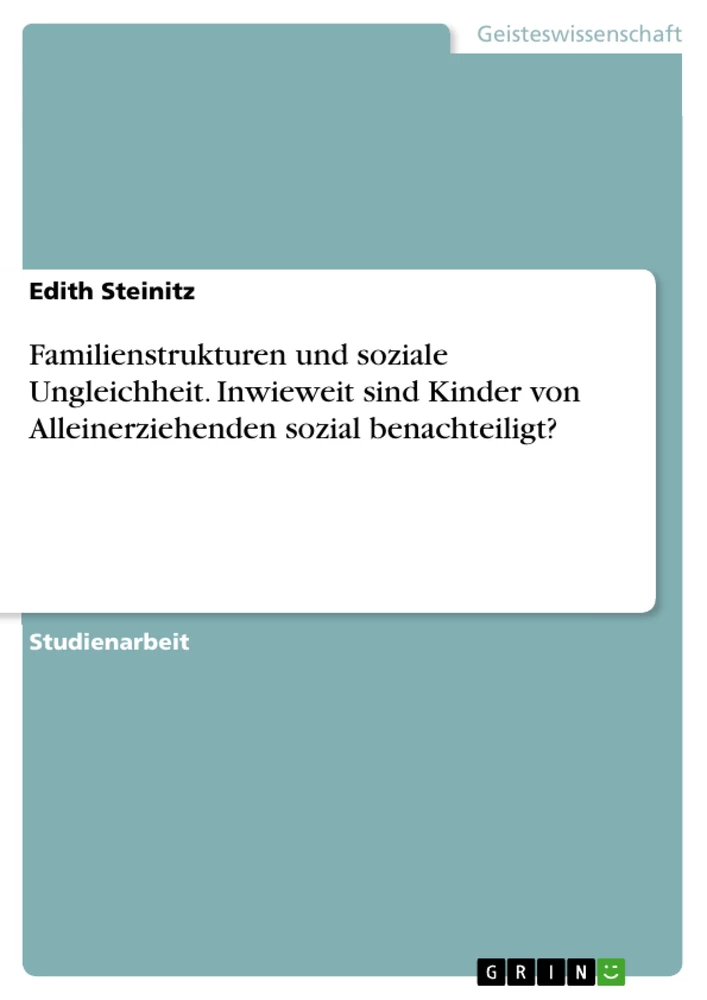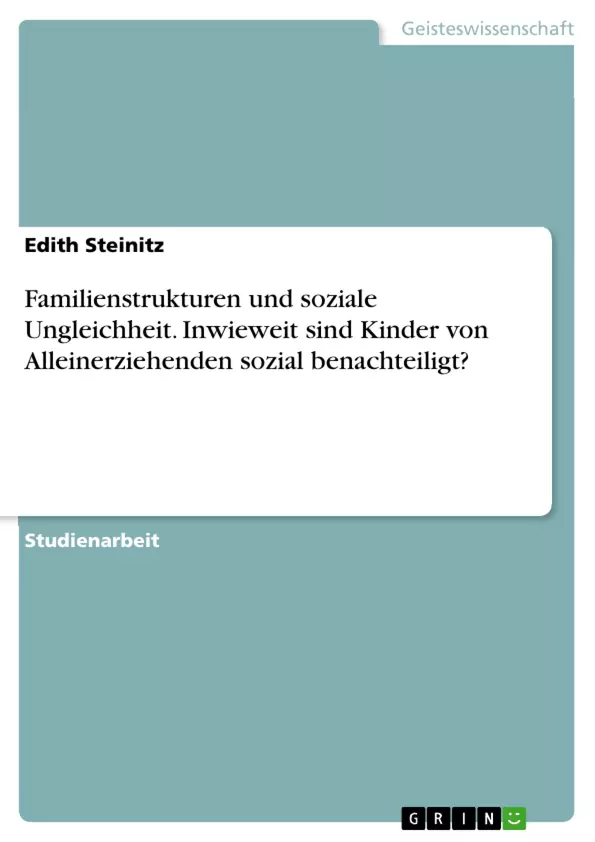In der Arbeit soll herausgearbeitet werden, inwiefern genau diese Familienform „Alleinerziehend“ benachteiligt sind. Wie wirkt sich das auf die Lebenschancen und Bildungschancen der beteiligten Kinder aus? Demzufolge wird ebenso der Zusammenhang auf die Chancengleichheit im Bildungswesen eingegangen, um darzustellen, dass ebenso Kinder aus sozial benachteiligten Schichten besonders stark davon betroffen sind und soziale Herkunft durchaus den Bildungsweg beeinflussen kann.
Hierfür werden Begriffe wie Familie, alleinerziehend und ebenso soziale Ungleichheit definiert und erläutert. Ebenso soll sich im Rahmen dieser Arbeit mit verschiedenen Erscheinungsformen von sozialer Ungleichheit beschäftigt werden, welche hier kurz definiert und erläutert werden sollen. Im weiteren Verlauf soll die Bildungsungleichheit im Kontext der sozialen Herkunft in Deutschland mit einbezogen werden, um im Zuge der Bildungsexpansion zu verdeutlichen, dass Bildungszugänge noch immer von der sozialen Herkunft beeinflusst werden.
Denn durch die Bildungsreformen sollte Chancengleichheit für jeden erzielt werden, ungeachtet von der Sprache, sozialen Herkunft, Konfession und seines Geschlechts. Dies entspricht nicht der Realität, auch wenn in den 1950er-Jahren die Bildungsexpansion zu verbesserten Bildungschancen führte, nahm gleichzeitig die Bildungsbenachteiligung verschiedener Schichten zu. Vor allem waren sozial benachteiligte wie Frauen und Kinder davon betroffen. Aus diesem Anlass soll die Arbeit ebenfalls einen allgemeinen Überblick über die Ursachen der Chancengleichheit im Bildungswesen sowie welche Folgen dies für Kinder aus sozial benachteiligten Schichten hat. Um das Vorgehen theoretisch fundieren zu können, soll auf die Theorie von Boudon zurückgegriffen werden, um abschließend die Frage beantworten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Familie
- Alleinerziehend oder Einelternfamilie
- Soziale Ungleichheit Definition
- Entstehung von Bildungsungleichheit und ihre Ursachen
- Theoretische Grundlage - der Ansatz von Boudon
- Allgemeine Auswirkungen auf Lebens- und Bildungschancen
- Soziale Herkunft Auslöser für Bildungsungleichheit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die soziale Benachteiligung von Kindern in Alleinerziehendenfamilien. Sie beleuchtet die Problematik im Kontext von Bildungsungleichheit und analysiert die Auswirkungen der Familienkonstellation auf Lebens- und Bildungschancen der Kinder. Dabei werden wichtige Begriffe wie Familie, Alleinerziehend und soziale Ungleichheit definiert und im Rahmen der Bildungsexpansion in Deutschland untersucht. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen und Folgen von Bildungsungleichheit im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft zu beleuchten.
- Definition und Herausforderungen der Familienform "Alleinerziehend"
- Bildungsungleichheit in Deutschland und die Rolle der sozialen Herkunft
- Einfluss der Familienstruktur auf Lebens- und Bildungschancen von Kindern
- Der Ansatz von Boudon zur Erklärung von Bildungsungleichheit
- Chancengleichheit im Bildungswesen und die Auswirkungen auf Kinder aus sozial benachteiligten Schichten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Thema Alleinerziehende wird im Kontext von Familien- und Bildungspolitik beleuchtet, wobei die soziale Ungleichheit in den Familienstrukturen, insbesondere bei Alleinerziehenden und Großfamilien, hervorgehoben wird. Die Arbeit untersucht die Benachteiligung von Alleinerziehenden und die Auswirkungen auf die Lebens- und Bildungschancen ihrer Kinder.
- Definition Familie: Die Arbeit erläutert die Problematik der Definition von "Familie" aufgrund kultureller Unterschiede und historischer Entwicklungen. Es werden verschiedene Ansätze und Definitionen vorgestellt, die von der traditionellen "Normalfamilie" bis hin zu modernen Familienformen reichen.
- Alleinerziehend oder Einelternfamilie: Die Definition von "Alleinerziehend" wird anhand des Statistischen Bundesamtes vorgestellt. Es werden die Schwierigkeiten und Kritikpunkte in Bezug auf die Benennung und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Alleinerziehenden aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Alleinerziehende, Einelternfamilien, soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Chancengleichheit, Familienstrukturen, Lebens- und Bildungschancen, soziale Herkunft, Bildungsexpansion, der Ansatz von Boudon, und die Auswirkungen auf Kinder aus sozial benachteiligten Schichten.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Kinder von Alleinerziehenden oft sozial benachteiligt?
Die Benachteiligung resultiert häufig aus geringeren finanziellen Ressourcen und einer stärkeren Belastung des alleinerziehenden Elternteils, was sich negativ auf die Bildungs- und Lebenschancen auswirken kann.
Welchen Einfluss hat die soziale Herkunft auf den Bildungsweg?
Trotz Bildungsreformen hängen Bildungszugänge in Deutschland nach wie vor stark von der sozialen Herkunft ab, wobei Kinder aus privilegierten Schichten deutlich bessere Chancen haben.
Was besagt die Theorie von Boudon im Kontext der Bildungsungleichheit?
Boudon unterscheidet zwischen primären und sekundären Herkunftseffekten, wobei letztere die Bildungsentscheidungen der Eltern aufgrund ihrer sozialen Position und Kosten-Nutzen-Abwägungen beschreiben.
Hat die Bildungsexpansion die Chancengleichheit verbessert?
Zwar führten die Reformen seit den 1950ern zu höheren Bildungsabschlüssen für viele, gleichzeitig nahm jedoch die relative Benachteiligung bestimmter Schichten, insbesondere von Kindern aus Einelternfamilien, zu.
Wie wird „Familie“ in der heutigen Forschung definiert?
Die Definition ist im Wandel; sie reicht von der traditionellen „Normalfamilie“ bis hin zu vielfältigen Formen wie Einelternfamilien, Patchworkfamilien oder Großfamilien.
- Citar trabajo
- Edith Steinitz (Autor), 2020, Familienstrukturen und soziale Ungleichheit. Inwieweit sind Kinder von Alleinerziehenden sozial benachteiligt?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127128