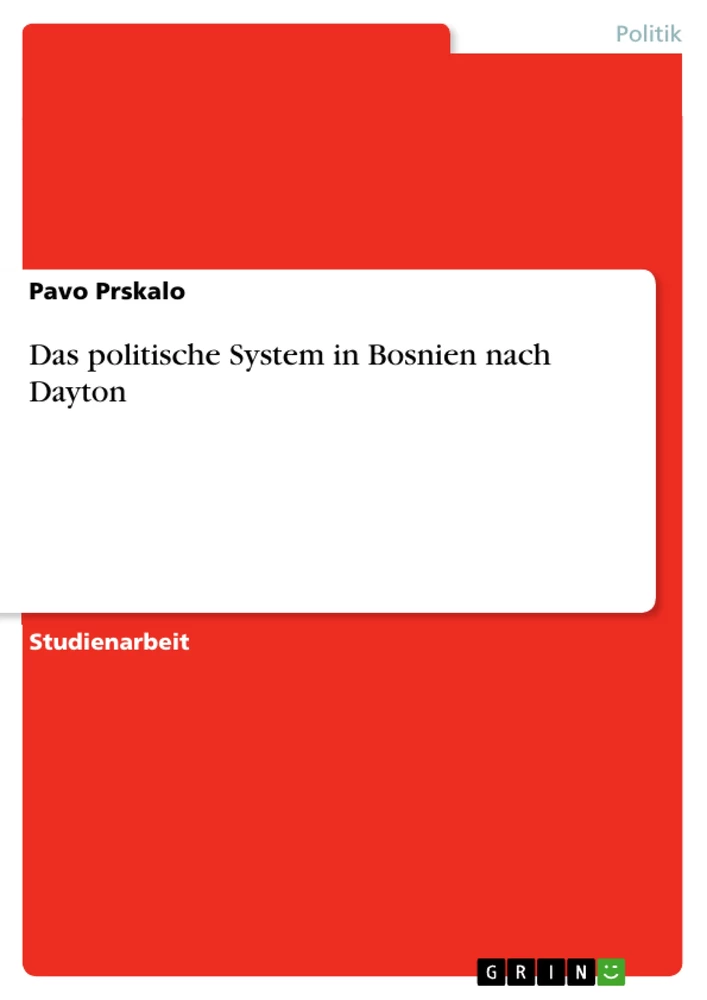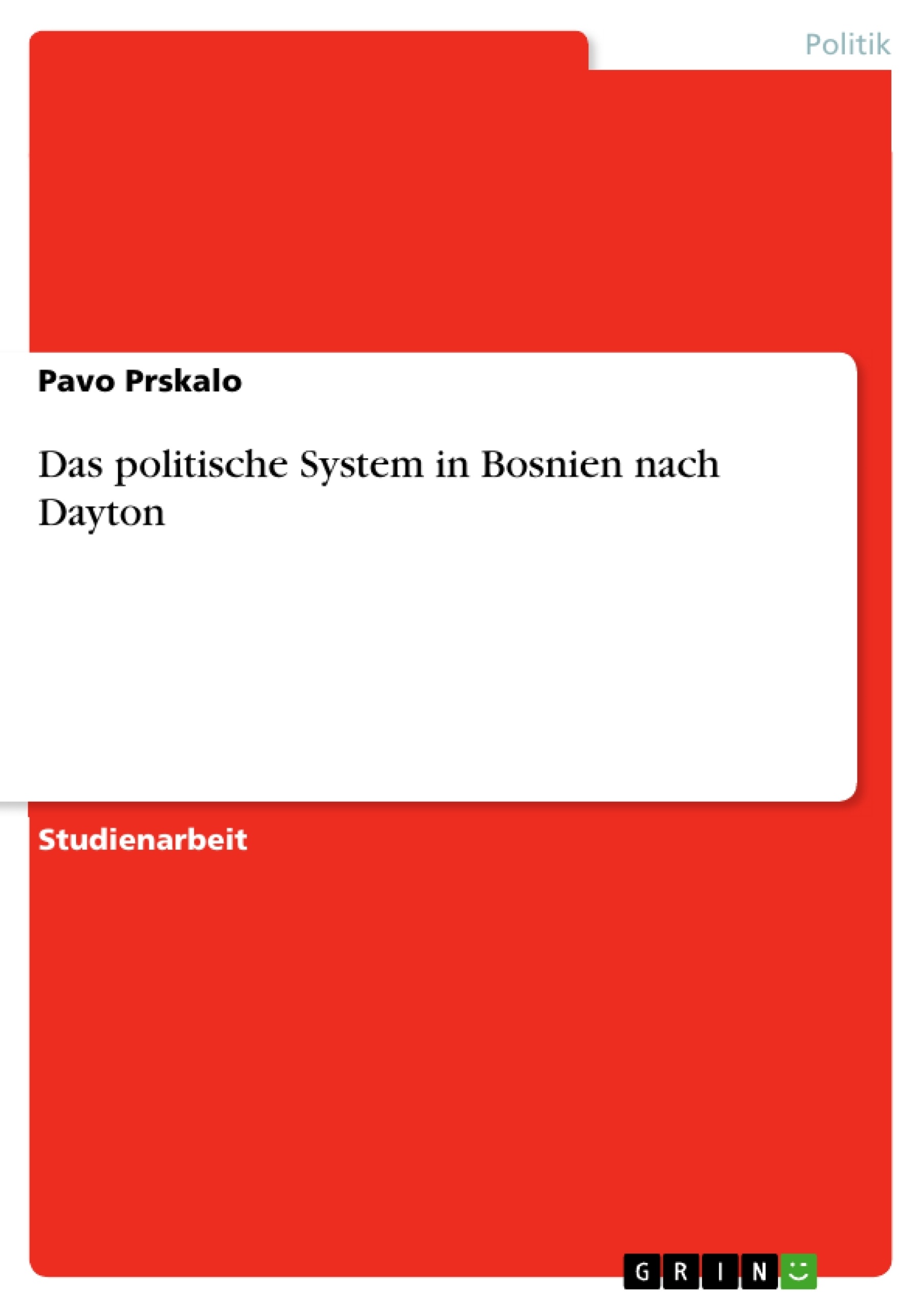Bomben, Flüchtlinge, Srebrenica, Friedensmission - dies sind nur einige Stichworte, die im Zusammenhang mit Bosnien-Herzegowina immer wieder genannt werden. Von 1992 bis 1995 tobte in dem Land, von der Fläche nur etwas größer als der deutsche Bundesstaat Niedersachsen – ein blutiger Bürgerkrieg zwischen drei Ethnien: Kroaten, Serben und Muslimen. Die Folge davon waren rund 300.000 Tote und mehr als eine Million Flüchtlinge.
Offiziell beendet wurden die Kriegshandlungen am 14. Dezember 1995 mit der Unterzeichnung des Daytoner Friedensabkommens in Paris. Der serbische Präsident Slobodan Milosevic, der kroatische Präsident Franjo Tudjman und der bosnische Präsident Alija Izetbegovic akzeptierten nach zähen Verhandlungen den Vorschlag des Vermittlers Richard Hoolbroke, einen einheitlichen und politisch unabhängigen Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina (BiH), bestehend aus der Föderation von BiH (FBiH) und Republika Srpska (RS) zu schaffen. Auf die genauen Punkte des Abkommens wird im Verlauf dieser Arbeit eingegangen.
Festzuhalten ist hier bereits, dass durch das Friedensabkommen zwar die Kampfhandlungen beendet wurden, die „Republia Bosna i Hercegovina“ (so die offizielle Bezeichnung) befindet sich aber auch rund zwölf Jahre nach Dayton in einer prekären Lage: So wurden im Abkommen eine äußerst komplizierte Regierungsform ausformuliert, die in Europa ihres Gleichen sucht. Die Befugnisse der Zentralregierung in Sarajewo sind gering, unter ihr gibt es noch regionale Parlamente. Über die größten Vollmachten verfügt der von der internationalen Gemeinschaft eingesetzte „Hohe Repräsentant“ (HR), derzeit der Deutsche CDU-Politiker Christian Schwarz-Schilling. Die Rolle des HR ist höchst umstritten, Kritiker sprechen von „außerdemokratischen Vollmachtnen“, die der HR Bosniens genießt.
Weitere Punkte des Dayton-Abkommens sind heute nach wie vor ungeklärt. So garantiert das Werk die vollständige Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimatorte, zugleich wird durch die Aufteilung in zwei Gebietseinheiten die ethnische Trennung verstärkt. Auch die Annäherung des Landes an die EU stockt durch mangelnde Zusammenarbeit der Akteure. Im Verlauf der Arbeit werden weitere Probleme aufgezeigt.
Zum Abschluss soll ein Ausblick erfolgen: Wohin führt der Weg Bosnien-Herzegowinas? Braucht das Land weiterhin die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft oder ist es zur Selbstverwaltung fähig? Wird es gelingen, eine nötige Verfassungsreform durchzusetzen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Friedensabkommen von Dayton
- Regierung
- Die Rolle des Hohen Repräsentanten
- Probleme
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das politische System Bosnien-Herzegowinas nach dem Dayton-Abkommen von 1995. Ziel ist es, die Komplexität des Systems, seine Stärken und Schwächen sowie die Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung des Landes zu beleuchten.
- Das Dayton-Abkommen und seine Folgen für die politische Ordnung Bosnien-Herzegowinas
- Die Struktur der Regierung und die Verteilung der Macht zwischen Zentralregierung und Entitäten
- Die Rolle des Hohen Repräsentanten und die damit verbundenen Kontroversen
- Die anhaltenden Probleme und Herausforderungen für die politische Stabilität
- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Landes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des bosnischen Bürgerkriegs und des Dayton-Abkommens ein. Sie beschreibt den Kontext des Konflikts, die hohen Opferzahlen und die Notwendigkeit eines Friedensabkommens. Der Fokus liegt auf der prekären Lage Bosnien-Herzegowinas nach zwölf Jahren Dayton, mit seiner komplizierten Regierungsform und der umstrittenen Rolle des Hohen Repräsentanten. Die Einleitung deutet auf ungeklärte Punkte des Abkommens hin, wie die Flüchtlingsfrage und die ethnische Trennung, und kündigt weitere Problemfelder an, die im Laufe der Arbeit behandelt werden. Sie mündet in einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Landes und die Fragen nach internationaler Unterstützung und einer notwendigen Verfassungsreform.
Das Friedensabkommen von Dayton: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Aushandlung des Dayton-Abkommens, von den ersten Gesprächen in Dayton, Ohio, bis zur Unterzeichnung in Paris. Es erläutert die wichtigsten Punkte des Abkommens: die Schaffung eines föderativen Staates aus zwei Teilrepubliken, der bosniakisch-kroatischen Föderation und der Republika Srpska, sowie den Sonderstatus des Brčko-Distrikts. Der Schwerpunkt liegt auf der territorialen Aufteilung und den damit verbundenen Implikationen für die ethnische Zusammensetzung und politische Machtverhältnisse. Das Kapitel verwendet Abbildungen, um die territoriale Aufteilung zu veranschaulichen und die Komplexität des Abkommens zu verdeutlichen. Die Darstellung der Kantone der Föderation und die Erwähnung der Quelle der Abbildungen unterstreichen den Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit.
Schlüsselwörter
Bosnien-Herzegowina, Dayton-Abkommen, Friedensvertrag, politische System, Föderation, Republika Srpska, Hohe Repräsentant, ethnische Konflikte, Verfassungsreform, EU-Annäherung, Nachkriegsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des politischen Systems Bosnien-Herzegowinas nach dem Dayton-Abkommen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das politische System Bosnien-Herzegowinas nach dem Dayton-Abkommen von 1995. Sie beleuchtet die Komplexität des Systems, seine Stärken und Schwächen sowie die Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung des Landes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Dayton-Abkommen und seine Folgen, die Struktur der Regierung und Machtverteilung, die Rolle des Hohen Repräsentanten und damit verbundene Kontroversen, anhaltende Probleme und Herausforderungen für die politische Stabilität sowie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Bosnien-Herzegowinas.
Was wird im Kapitel "Das Friedensabkommen von Dayton" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Aushandlungsprozess des Dayton-Abkommens, seine wichtigsten Punkte (Föderation aus zwei Teilrepubliken, Sonderstatus Brčko-Distrikt), die territoriale Aufteilung und deren Implikationen für die ethnische Zusammensetzung und politische Machtverhältnisse. Es verwendet Abbildungen zur Veranschaulichung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zum Dayton-Abkommen, zur Regierung, zur Rolle des Hohen Repräsentanten und zu bestehenden Problemen, sowie ein Fazit und Ausblick. Sie beinhaltet außerdem ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt der Hohe Repräsentant?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Hohen Repräsentanten und die damit verbundenen Kontroversen. Die Einleitung deutet bereits auf die umstrittene Rolle hin, die im Hauptteil genauer beleuchtet wird.
Welche Probleme werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit thematisiert anhaltende Probleme und Herausforderungen für die politische Stabilität Bosnien-Herzegowinas. Die Einleitung erwähnt ungeklärte Punkte des Abkommens wie die Flüchtlingsfrage und die ethnische Trennung als Beispiele.
Was ist das Fazit und der Ausblick?
Das Fazit und der Ausblick geben einen Überblick über die zukünftige Entwicklung Bosnien-Herzegowinas und die Fragen nach internationaler Unterstützung und einer notwendigen Verfassungsreform. Der genaue Inhalt wird im entsprechenden Kapitel der Arbeit detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bosnien-Herzegowina, Dayton-Abkommen, Friedensvertrag, politisches System, Föderation, Republika Srpska, Hohe Repräsentant, ethnische Konflikte, Verfassungsreform, EU-Annäherung, Nachkriegsentwicklung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse von Themen im bosnischen Kontext in strukturierter und professioneller Weise.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere detaillierte Informationen finden sich in den einzelnen Kapiteln der vollständigen Arbeit.
- Citation du texte
- Pavo Prskalo (Auteur), 2007, Das politische System in Bosnien nach Dayton, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112733