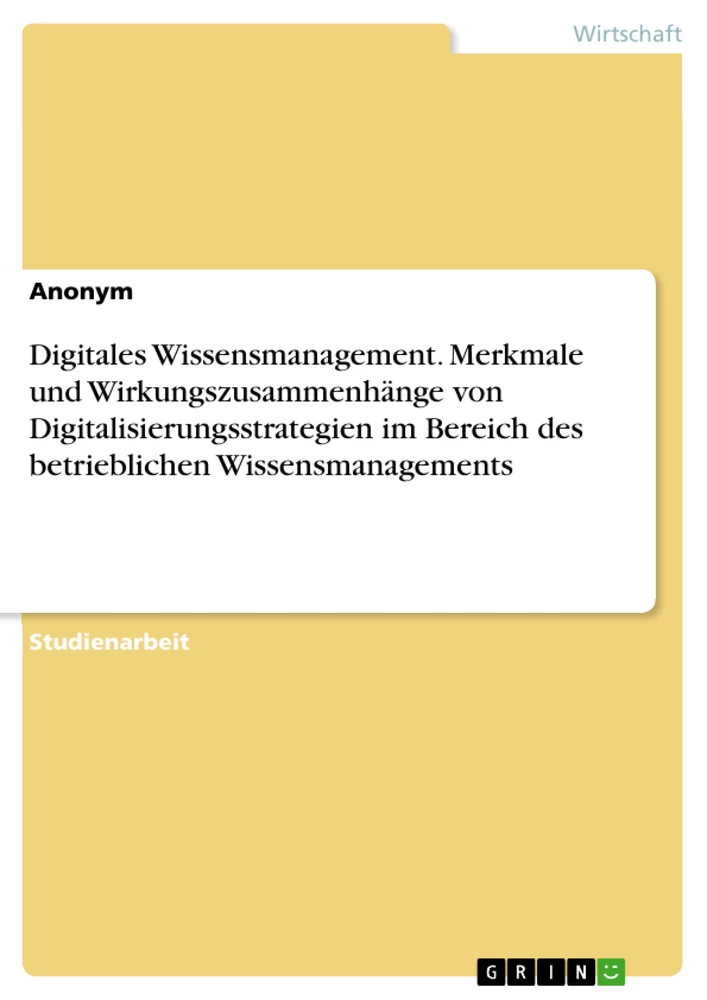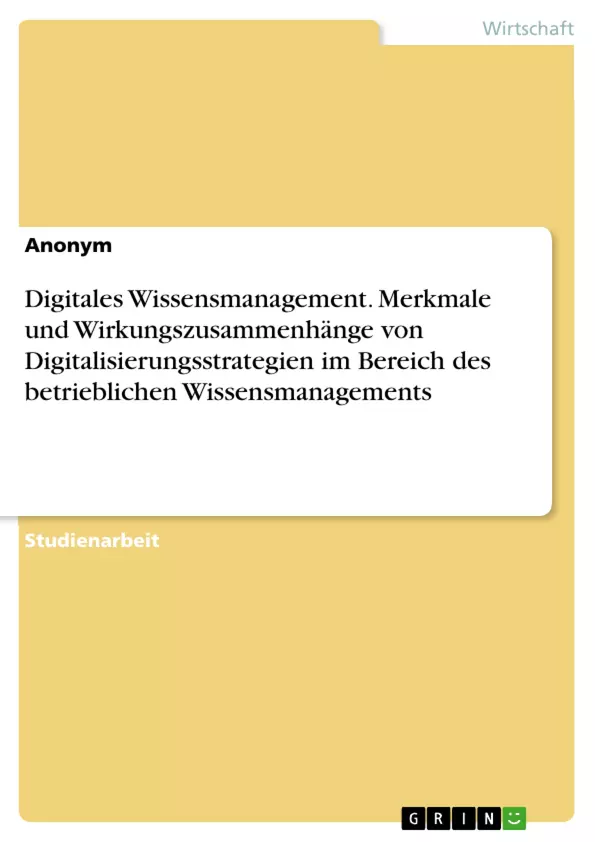Ziel dieser Arbeit ist die Einführung in die Thematik des digitalen Wissensmanagements. Vor diesem Hintergrund werden Merkmale und Wirkungszusammenhänge von Digitalisierungsstrategien im Bereich des betrieblichen Wissensmanagements vorgestellt. Dabei wird konkret auf die Teilaufgaben des Wissensmanagements und einige Tools des eingegangen, um einen Praxisbezug herzustellen.
Zunächst werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen zu den Begriffen Wissen und Wissensgesellschaft, Wissensmanagement und Digitalisierung erläutert. Im Kapitel 3 wird das digitale Wissensmanagement sowie die Merkmale und Wirkungszusammenhänge von Digitalisierungsstrategien vorgestellt und auf die Tools eingegangen. Nachdem die Ziele der Arbeit in Kapitel 3 erreicht wurden, erfolgt in Kapitel 4 eine kritische Reflexion der eingesetzten Literatur sowie der Arbeit selbst. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick in Kapitel 5 ab.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Wissen als relevanter Erfolgsfaktor
1.2 Zielsetzung
1.3 Aufbau der Hausarbeit
2 Theoretischen Grundlagen zum Digitalen Wissensmanagement
2.1 Wissen und Wissensgesellschaft
2.2 Wissensmanagement
2.3 Digitalisierung
3 DigitalesWissensmanagement
3.1 Grundlagen und Merkmale des digitalen Wissensmanagement
3.2 Teilaufgaben und Tools des digitalen Wissensmanagements
3.2.1 ErzeugungvonWissen
3.2.2 Anwendung und Entwicklung von Wissen
3.2.3 (Ver-)Teilung von Wissen
3.2.4 Speicherung von Wissen
4 Kritische Reflexion
4.1 Reflexion der eingesetzten Quellen
4.2 Reflexion der Ergebnisse
5 FazitundAusblick
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist digitales Wissensmanagement?
Es ist der Einsatz digitaler Technologien, um Wissen in einer Organisation effizient zu erzeugen, zu speichern, zu verteilen und anzuwenden.
Warum ist Wissen ein relevanter Erfolgsfaktor?
In der Wissensgesellschaft ist das Know-how der Mitarbeiter die wichtigste Ressource, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen und Innovationen voranzutreiben.
Welche Tools werden im Wissensmanagement genutzt?
Dazu gehören Intranets, Wikis, Dokumentenmanagementsysteme (DMS), Collaboration-Tools wie Microsoft Teams und Expertendatenbanken.
Was sind die Teilaufgaben des Wissensmanagements?
Die Kernaufgaben sind die Wissensidentifikation, der Wissenserwerb, die Wissensentwicklung, die Wissensverteilung, die Wissensnutzung und die Wissensbewahrung.
Wie fördert Digitalisierung den Wissensaustausch?
Sie ermöglicht den zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Informationen und erleichtert die Vernetzung von Experten über Abteilungsgrenzen hinweg.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Digitales Wissensmanagement. Merkmale und Wirkungszusammenhänge von Digitalisierungsstrategien im Bereich des betrieblichen Wissensmanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127790