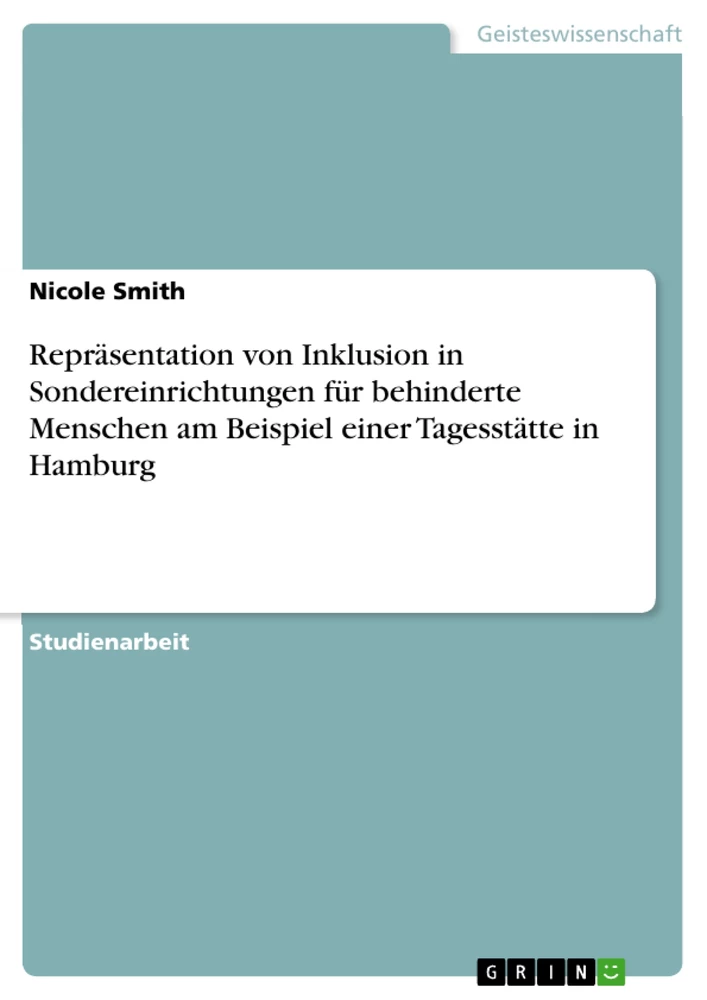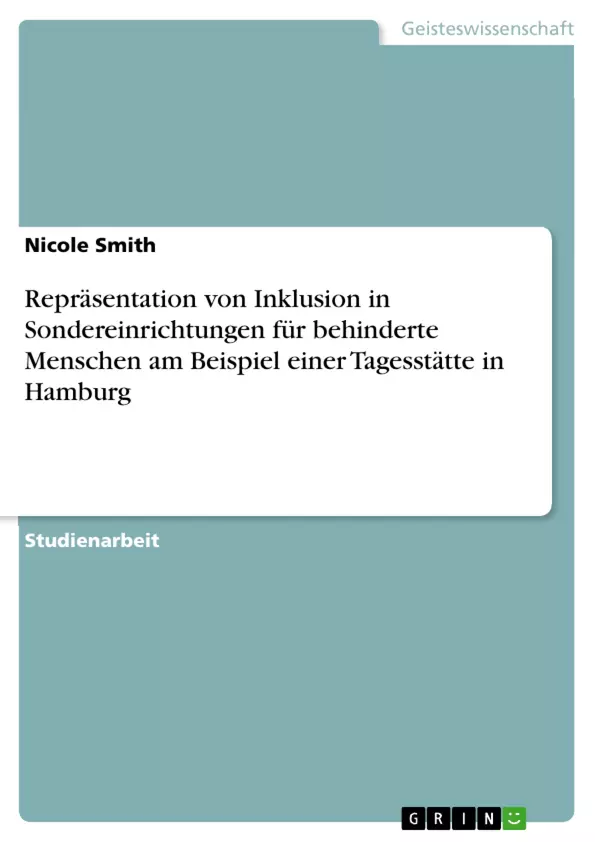Das Thema Inklusion wird viel besprochen und ausgehandelt. Doch behinderte Menschen sind vorrangig in Sondereinrichtungen sichtbar. Sie stellen für viele Menschen einen geschlossenen Lebensraum dar, der jeden Moment in ihrem Alltag begleitet und bestimmt. Vom Wohnen und Leben in einer betreuten Wohneinrichtung, dem Arbeiten in Werkstätten oder Tagesförderstätten und der institutionalisierten Freizeitgestaltung, bis hin zu vollständig organisierten Ferienreisen und Fortbildungen zur Alltagsbewältigung wie Liebe und Beziehung oder Kochen. So ist es keine Seltenheit, dass ein einziger sozialer Träger jeden Lebensbereich einer behinderten Person ausfüllt, gestaltet und prägt. Dabei ist es folgerichtig, dass die Mitarbeitenden im Leben der Menschen oftmals zu den wichtigsten Bezugspersonen werden. Dies stellt eine enorme Verantwortung dar. Für die Mitarbeitende ist die Inklusion ihrer KlientInnen ihre berufliche Aufgabe und stellt die Handlungsnorm jeglicher pädagogischen Maßnahme dar. Umgekehrt bedeutet Inklusion für die KlientInnen einen Handlungsrahmen und Erwartungshorizont, welcher Einfluss auf alle Lebensbereiche nimmt.
Dabei wird in dieser Arbeit die konkrete Forschungsfrage gestellt: Wie wirkt sich die Handlungsnorm der Inklusion auf die Arbeit der Alltagsassistenz im Feld der Sondereinrichtungen, am Beispiel einer Tagesförderstätte für behinderte Menschen aus? Aus den Beobachtungen im Arbeitsalltag einer Tagesförderstätte in Hamburg geht die Hypothese hervor: Die sozialen Beziehungen zwischen MitarbeiterInnen und KlientInnen sind geprägt von Machtasymetrien, welche in der täglichen Praxis reproduziert werden.
Für die Beantwortung der Forschungsfrage wird im Anschluss an den aktuellen Forschungsstand eine begriffliche Einordnung der Konzepte Behinderung und Inklusion vorgenommen. Im Anschluss daran wird die Verwendung der autoethnografischen Methode begründet und die eigene Rolle offengelegt. Das darauffolgende Kapitel geht über in die Beschreibung des Feldes: der Tagesförderstelle unter dem Träger Leben mit Behinderung Hamburg. Die darauffolgend beschriebenen Beobachtungen werden mit Theorien von produktiver Arbeit und Disziplinarmacht im Kontext von Inklusion besprochen. Im Fazit wird die Forschungsfrage und die Hypothese noch einmal aufgegriffen und zusammenfassend in Anlehnung an die voran gegangene Analyse beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktueller Forschungsstand
- Begriff und Kontext
- Behinderung
- Handlungsnorm Inklusion
- Autoethnografische Methode
- Die eigene Rolle und weiteres Vorgehen
- Das Feld: Leben mit Behinderung Hamburg
- Tagesgeschäft in der Tagesförderstätte
- Arbeit und Produktivität
- Disziplinartechniken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Handlungsnorm Inklusion auf die Arbeit der Alltagsassistenz in einer Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderung. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirkt sich die Handlungsnorm der Inklusion auf die Arbeit der Alltagsassistenz im Feld der Sondereinrichtungen, am Beispiel einer Tagesförderstätte für behinderte Menschen aus? Die Arbeit basiert auf Beobachtungen im Arbeitsalltag und analysiert die sozialen Beziehungen zwischen Mitarbeiter*innen und Klient*innen.
- Die soziale Konstruktion von Behinderung
- Inklusion als Handlungsnorm und ihre praktische Umsetzung
- Machtstrukturen und Machtasymetrien in der Alltagsassistenz
- Disziplinartechniken im Kontext von Inklusion
- Produktivität und Arbeit in der Tagesförderstätte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Inklusion ein und präsentiert den zentralen Forschungsgegenstand: die Auswirkungen der Inklusionsnorm auf die Arbeit der Alltagsassistenz in einer Tagesförderstätte. Sie hebt die Diskrepanz zwischen dem propagierten Ideal der Inklusion und der Realität in Sondereinrichtungen hervor und formuliert die Forschungsfrage und Hypothese der Arbeit. Die allgegenwärtige Präsenz des Inklusionsdiskurses, der sich in Einrichtungen für Menschen mit kognitiven Behinderungen widerspiegelt, wird kritisch beleuchtet. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die gewählte methodische Herangehensweise.
Aktueller Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet den bisherigen Forschungsstand zum Thema Behinderung und Inklusion in der Sozial- und Kulturanthropologie. Es wird die geringe Beachtung der "Kultur der Behinderung" in dieser Disziplin kritisiert und der Fokus auf materielle und politökonomische Analysen von Institutionen für Menschen mit Behinderungen herausgestellt. Der Beitrag der Disability Studies mit ihrer Kritik am Rehabilitationsparadigma und ihrer Fokussierung auf die gesellschaftliche Konstruktion von Behinderung wird hervorgehoben, insbesondere die Arbeit von Mike Oliver. Der Bezug auf Foucault ("Überwachen und Strafen") und Weber ("Die protestantische Ethik") wird begründet, um Machtstrukturen und den Funktionalitätsanspruch im Kontext von Inklusion zu analysieren.
Begriff und Kontext: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe "Behinderung" und "Inklusion". Es werden verschiedene Perspektiven (medizinisch, juristisch, sozial) auf Behinderung gegenübergestellt, um die Komplexität des Konzepts und die Uneinigkeit in der Literatur aufzuzeigen. Die sozial konstruktivistische Perspektive der Disability Studies, die Behinderung als Produkt sozialer Ausschlussmechanismen begreift, wird besonders hervorgehoben und mit anderen Kategorien sozialer Differenzierung wie Geschlecht oder Herkunft in Verbindung gebracht. Die unterschiedlichen Definitionen von Behinderung werden diskutiert, von der medizinischen Pathologie bis hin zur sozialen Konstruktion.
Autoethnografische Methode: Dieses Kapitel begründet die Wahl der autoethnografischen Methode und erläutert die Rolle der Autorin im Forschungsprozess. Es wird auf die Herausforderungen und die ethischen Implikationen dieser Methode eingegangen. Die Reflexion der eigenen Positionierung und die möglichen Beeinträchtigungen der Objektivität durch die subjektive Perspektive werden thematisiert. Es wird dargelegt, wie die Autorin ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven in die Forschungsarbeit integriert, ohne die wissenschaftliche Integrität zu gefährden.
Das Feld: Leben mit Behinderung Hamburg: Dieser Abschnitt beschreibt die untersuchte Tagesförderstätte und den Träger "Leben mit Behinderung Hamburg". Es werden Beobachtungen aus dem Arbeitsalltag geschildert, die mit Theorien produktiver Arbeit und Disziplinarmacht im Kontext von Inklusion in Verbindung gebracht werden. Die Zusammenhänge zwischen dem alltäglichen Handeln der Mitarbeiter*innen und den theoretischen Konzepten werden aufgezeigt und analysiert. Die Kapitel behandeln den Alltag in der Einrichtung, die Arbeitsorganisation, und die sozialen Beziehungen zwischen Mitarbeiter*innen und Klient*innen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Behinderung, Disability Studies, Alltagsassistenz, Tagesförderstätte, Machtasymetrien, Disziplinartechniken, produktive Arbeit, soziale Konstruktion, Handlungsnorm.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Auswirkungen der Handlungsnorm Inklusion auf die Arbeit der Alltagsassistenz
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Handlungsnorm Inklusion auf die Arbeit der Alltagsassistenz in einer Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderung in Hamburg. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirkt sich die Handlungsnorm der Inklusion auf die Arbeit der Alltagsassistenz im Feld der Sondereinrichtungen, am Beispiel einer Tagesförderstätte für behinderte Menschen aus?
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine autoethnografische Methode. Die Autorin integriert ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven in die Forschung, wobei die Herausforderungen und ethischen Implikationen dieser Methode reflektiert werden.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Fragen: Die soziale Konstruktion von Behinderung, Inklusion als Handlungsnorm und ihre praktische Umsetzung, Machtstrukturen und Machtasymetrien in der Alltagsassistenz, Disziplinartechniken im Kontext von Inklusion, und Produktivität und Arbeit in der Tagesförderstätte.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert die zentralen Begriffe "Behinderung" und "Inklusion" aus verschiedenen Perspektiven (medizinisch, juristisch, sozial). Der sozialkonstruktivistische Ansatz der Disability Studies wird besonders hervorgehoben.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Theorien von Foucault ("Überwachen und Strafen"), Weber ("Die protestantische Ethik") und die Disability Studies, um Machtstrukturen, den Funktionalitätsanspruch im Kontext von Inklusion, und die soziale Konstruktion von Behinderung zu analysieren. Die Arbeit kritisiert den bisherigen Forschungsstand zur "Kultur der Behinderung" in der Sozial- und Kulturanthropologie und hebt den Beitrag der Disability Studies hervor.
Welche Aspekte des Arbeitsalltags werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das Tagesgeschäft in der Tagesförderstätte, Arbeit und Produktivität, und Disziplinartechniken. Sie untersucht die sozialen Beziehungen zwischen Mitarbeiter*innen und Klient*innen und verbindet Beobachtungen aus dem Arbeitsalltag mit Theorien produktiver Arbeit und Disziplinarmacht.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit in der Zusammenfassung der Kapitel enthalten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Beschreibung der Methodik, der theoretischen Fundierung und der empirischen Ergebnisse.)
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Inklusion, Behinderung, Disability Studies, Alltagsassistenz, Tagesförderstätte, Machtasymetrien, Disziplinartechniken, produktive Arbeit, soziale Konstruktion, Handlungsnorm.
Wo wurde die Forschung durchgeführt?
Die Feldforschung wurde in einer Tagesförderstätte des Trägers "Leben mit Behinderung Hamburg" durchgeführt.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Aktueller Forschungsstand, Begriff und Kontext, Autoethnografische Methode, Das Feld: Leben mit Behinderung Hamburg, und Fazit.
- Quote paper
- Nicole Smith (Author), 2020, Repräsentation von Inklusion in Sondereinrichtungen für behinderte Menschen am Beispiel einer Tagesstätte in Hamburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127836