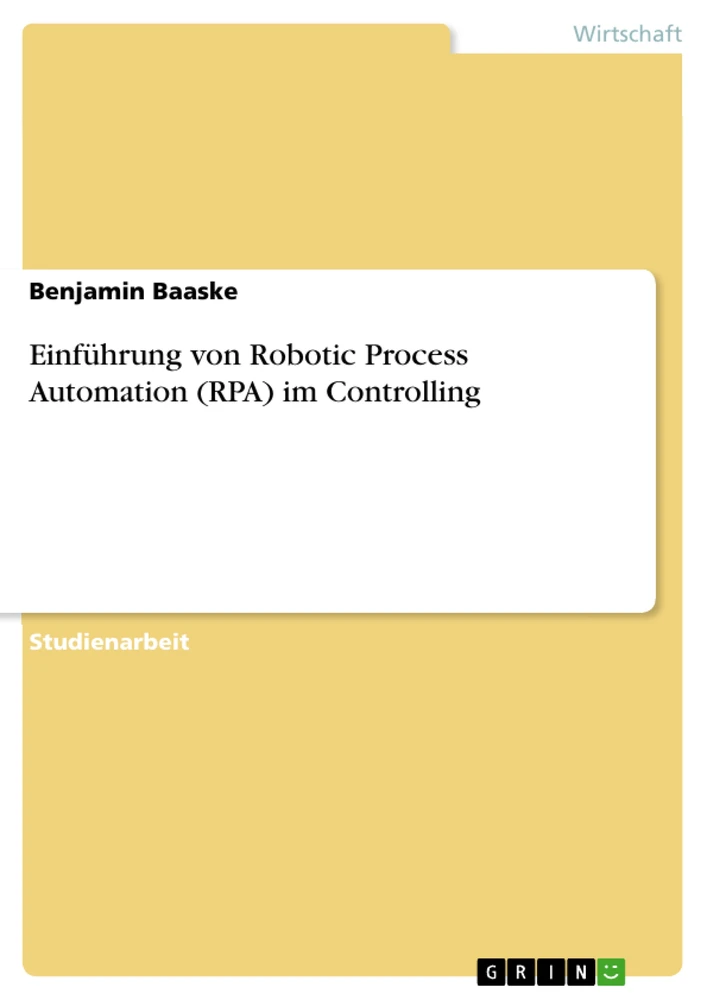Die Zielsetzung dieser Arbeit ist, das Thema RPA ganz allgemein zu erläutern sowie im weiteren Verlauf einen Implementierungsprozess darzustellen und abschließend einen Beispielprozess aus dem Controlling auszuführen.
Die vorliegende Arbeit besteht aus vier Kapiteln. Im ersten Kapitel der vorliegenden Seminararbeit wird in das Thema eingeführt und zur Fragestellung hingeleitet. Des Weiteren wird der methodische Aufbau erläutert. In Kapitel zwei werden theoretische Grundlagen erläutert, die für das Verständnis des Themas nötig sind. Dazu wird als erstes der Begriff RPA definiert und erläutert. Darüber hinaus wird kurz erläutert wie RPA funktioniert. Zusätzlich werden die Vorteile und Nachteile beim Einsatz von Robotic Process Automation erläutert.
Im praktischen Hauptteil der vorliegenden Seminararbeit, dem Kapitel drei, wird dargelegt wie ein Implementierungsprozess von RPA innerhalb eines Unternehmens durchgeführt werden kann. Dazu wird auf verschiedene Aspekte innerhalb dieser Implementierung (z.B. Governance, Operation Model) eingegangen. Abschließend wird ein Beispielprozess aus dem Bereich Controlling skizziert, der mit Hilfe von RPA teilweise automatisiert werden könnte. In einem Fazit werden die untersuchten Ergebnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung der Arbeit
- 1.2 Zielsetzung und methodischer Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlage
- 2.1 Grundlagen von Robotic Process Automation (RPA)
- 2.2 Vorteile von RPA
- 2.3 Nachteile von RPA
- 3. Einführung von RPA im Controlling
- 3.1 Die vier Phasen bei einer Einführung von RPA in Unternehmen
- 3.2 Prozessauswahl für RPA
- 3.3 RPA-Rollen im Unternehmen
- 3.4 RPA und Governance
- 3.5 Operating Model für RPA
- 3.6 Change-Management
- 3.7 RPA im Controlling – Anwendungsbeispiel
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Einführung von Robotic Process Automation (RPA) im Controlling. Ziel ist es, RPA allgemein zu erläutern, einen Implementierungsprozess darzustellen und ein Beispiel aus dem Controlling zu präsentieren. Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen praktischen Teil und ein Fazit.
- Einführung und Definition von RPA
- Vorteile und Nachteile des Einsatzes von RPA
- Implementierungsprozess von RPA in Unternehmen
- RPA-Governance und -Operating Model
- Anwendungsbeispiel RPA im Controlling
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Problemstellung. Es wird auf eine Studie von Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut Bezug genommen, die den Wunsch vieler Unternehmen nach effizienteren Prozessen durch Automatisierung aufzeigt. Die zunehmende Bedeutung von Digitalisierung und Automatisierung, verstärkt durch die Corona-Krise, wird hervorgehoben. Robotic Process Automation (RPA) wird als Lösungsansatz vorgestellt, der Unternehmen bei der Effizienzsteigerung unterstützen kann. Die Zielsetzung der Arbeit und der methodische Aufbau werden ebenfalls dargelegt.
2. Theoretische Grundlage: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von RPA dar. Es definiert den Begriff RPA, erläutert seine Funktionsweise und geht detailliert auf die Vor- und Nachteile des Einsatzes von RPA ein. Diese umfassende Betrachtung der theoretischen Aspekte bildet die Grundlage für die praktische Anwendung im folgenden Kapitel.
3. Einführung von RPA im Controlling: Dieses Kapitel beschreibt den Implementierungsprozess von RPA in Unternehmen. Es werden die verschiedenen Phasen einer solchen Einführung beleuchtet, von der Prozessauswahl bis hin zum Change-Management. Es werden wichtige Aspekte wie die Rolle von RPA im Unternehmen, die Governance, das Operating Model und ein Anwendungsbeispiel aus dem Controlling detailliert erklärt. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und den Herausforderungen bei der Einführung von RPA.
Schlüsselwörter
Robotic Process Automation (RPA), Controlling, Prozessautomatisierung, Digitalisierung, Implementierung, Effizienzsteigerung, Governance, Operating Model, Change-Management.
FAQ: Einführung von Robotic Process Automation (RPA) im Controlling
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Einführung von Robotic Process Automation (RPA) im Controlling. Sie umfasst eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen praktischen Teil und ein Fazit. Die Arbeit erläutert RPA allgemein, beschreibt einen Implementierungsprozess und präsentiert ein Anwendungsbeispiel aus dem Controlling. Sie bezieht sich auf eine Studie von Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut, die den Bedarf an effizienteren Prozessen durch Automatisierung aufzeigt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Einführung und Definition von RPA, Vorteile und Nachteile des Einsatzes von RPA, Implementierungsprozess von RPA in Unternehmen (inkl. Prozessauswahl, RPA-Rollen, Governance, Operating Model und Change-Management), sowie ein Anwendungsbeispiel von RPA im Controlling.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung): Stellt die Problemstellung vor, bezieht sich auf die Studie von Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut und beschreibt die Zielsetzung und den methodischen Aufbau. Kapitel 2 (Theoretische Grundlage): Definiert RPA, erläutert seine Funktionsweise und beleuchtet Vor- und Nachteile. Kapitel 3 (Einführung von RPA im Controlling): Beschreibt den Implementierungsprozess, verschiedene Phasen der Einführung, Rollen im Unternehmen, Governance, Operating Model, Change-Management und ein Anwendungsbeispiel aus dem Controlling. Kapitel 4 (Fazit und Ausblick): Fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Vorteile und Nachteile von RPA werden behandelt?
Die Arbeit erläutert detailliert die Vorteile und Nachteile des Einsatzes von RPA. Konkrete Punkte werden jedoch nicht im Preview genannt. Diese Informationen finden sich im Hauptteil der Arbeit.
Wie ist der Implementierungsprozess von RPA in Unternehmen aufgebaut?
Der Implementierungsprozess wird in mehreren Phasen dargestellt, beginnend mit der Prozessauswahl und endend mit dem Change-Management. Weitere Aspekte wie die Definition von RPA-Rollen, Governance und das Operating Model werden ebenfalls behandelt. Die genauen Phasen und Schritte sind im Hauptteil der Arbeit detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Robotic Process Automation (RPA), Controlling, Prozessautomatisierung, Digitalisierung, Implementierung, Effizienzsteigerung, Governance, Operating Model und Change-Management.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese Zusammenfassung enthält nur einen Auszug aus dem Inhalt der Seminararbeit. Für detaillierte Informationen und eine vollständige Analyse der Thematik ist die Lektüre der vollständigen Arbeit erforderlich.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Baaske (Autor:in), 2021, Einführung von Robotic Process Automation (RPA) im Controlling, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127959