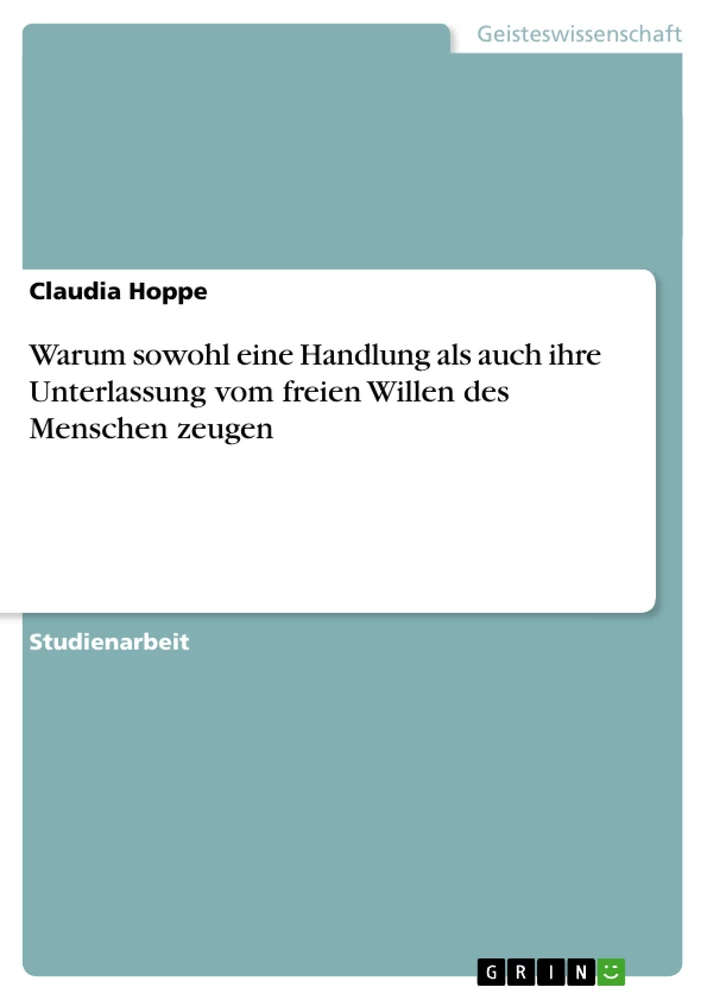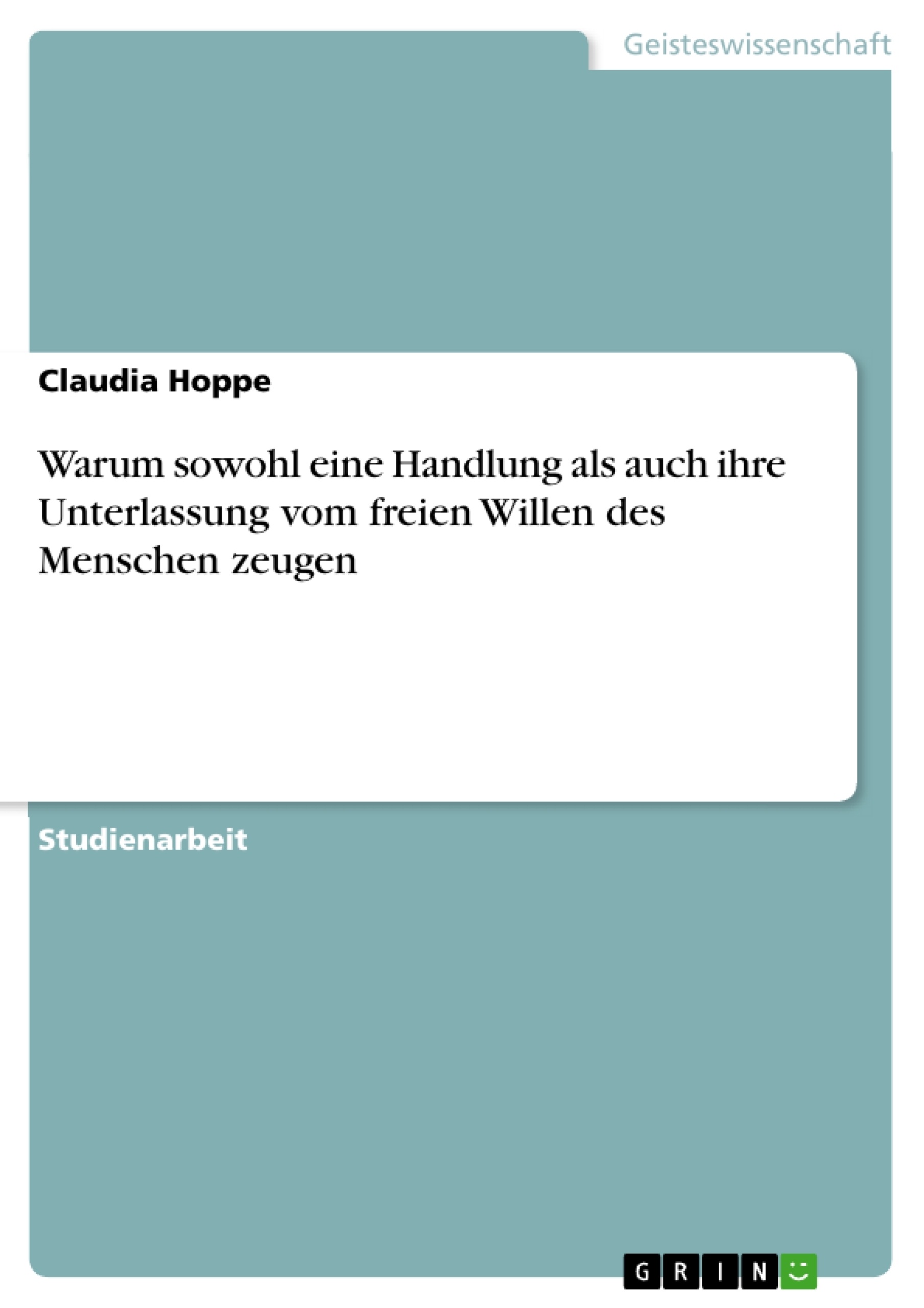In Immanuel Kants bedeutendsten Schriften, der „Kritik der reinen" sowie „der praktischen Vernunft" ist es eine der wichtigsten Fragestellungen, ob der Mensch Freiheit besitzt und wenn ja, worin diese sich äußert. Ist der Mensch in der Lage, frei zu handeln und - nach dem Kausalprinzip - selbst eine Ursache zu stiften, oder läuft die Welt lediglich nach dem Schema ab, daß alles, was geschieht, eine Ursache hat, die in der Zeit vorausgeht und welche wiederum selbst eine Ursache hat usw.? Angenommen, der Mensch ist dazu fähig, von sich aus, d.h. aus Freiheit eine Ursache zu stiften, also zu handeln, dann hat diese Handlung, die ja dann Ursache ist, auch immer eine Wirkung in der Zeit, die man mit Hilfe seines Sinnenapparates wahrnehmen kann. Jedoch kann man nicht nur die Wirkungen seiner Hand¬lungen wahrnehmen, sondern schon die Handlung selbst. Was ist nun aber mit dem Fall, in dem ein Mensch sich entscheidet, eine Hand¬lung, die er soeben noch vollziehen wollte, doch nicht auszuführen, gerade um zu demonstrieren, daß er frei ist? Dieser Mensch hat dann keine Handlung vollzogen, die durch eine Körperbewegung in Raum und Zeit charakterisiert ist. Hat er dann überhaupt eine Handlung vollzogen? Wenn ja, heißt das dann, daß sowohl eine Handlung als auch ihre Unterlassung vom freien Willen dieses Menschen zeugen? Oder ist es so, daß, wenn Kant vom freien Willen des Menschen und dessen Fähigkeit, frei zu handeln spricht, er in dieses „Handeln" nur das aktive Handeln einschließt, das wir jederzeit vermittelst unserer Sinne bemerken können? Diese Fragen werde ich auf den folgenden Seiten zu beantworten versuchen. Dazu werde ich zuerst näher darauf eingehen, wie Freiheit für Kant überhaupt erst möglich ist und welche Rolle das Kausalitätsprinzip, nach dem alle Dinge in der Erscheinung eine ihnen in der Zeit vorausgehende Ursache haben, dabei spielt. Anschließend werde ich erläutern, warum ein freier Wille ein Wille unter sittlichen Gesetzen und damit verbunden eine freie Handlung eine moralische Handlung ist, und im Zusammenhang damit wiederum darlegen, inwieweit nun auch die Unterlassung einer Handlung eine moralisch bewertbare Tat ist.
In Immanuel Kants bedeutendsten Schriften, der „Kritik der reinen" sowie „der praktischen Vernunft" ist es eine der wichtigsten Fragestellungen, ob der Mensch Freiheit besitzt und wenn ja, worin diese sich äußert. Ist der Mensch in der Lage, frei zu handeln und - nach dem Kausalprinzip - selbst eine Ursache zu stiften, oder läuft die Welt lediglich nach dem Schema ab, daß alles, was geschieht, eine Ursache hat, die in der Zeit vorausgeht und welche wiederum selbst eine Ursache hat usw.? Angenommen, der Mensch ist dazu fähig, von sich aus, d.h. aus Freiheit eine Ursache zu stiften, also zu handeln, dann hat diese Handlung, die ja dann Ursache ist, auch immer eine Wirkung in der Zeit, die man mit Hilfe seines Sinnenapparates wahrnehmen kann. Jedoch kann man nicht nur die Wirkungen seiner Handlungen wahrnehmen, sondern schon die Handlung selbst. Was ist nun aber mit dem Fall, in dem ein Mensch sich entscheidet, eine Handlung, die er soeben noch vollziehen wollte, doch nicht auszuführen, gerade um zu demonstrieren, daß er frei ist? Dieser Mensch hat dann keine Handlung vollzogen, die durch eine Körperbewegung in Raum und Zeit charakterisiert ist. Hat er dann überhaupt eine Handlung vollzogen? Wenn ja, heißt das dann, daß sowohl eine Handlung als auch ihre Unterlassung vom freien Willen dieses Menschen zeugen? Oder ist es so, daß, wenn Kant vom freien Willen des Menschen und dessen Fähigkeit, frei zu handeln spricht, er in dieses „Handeln" nur das aktive Handeln einschließt, das wir jederzeit vermittelst unserer Sinne bemerken können? Diese Fragen werde ich auf den folgenden Seiten zu beantworten versuchen. Dazu werde ich zuerst näher darauf eingehen, wie Freiheit für Kant überhaupt erst möglich ist und welche Rolle das Kausalitätsprinzip, nach dem alle Dinge in der Erscheinung eine ihnen in der Zeit vorausgehende Ursache haben, dabei spielt. Anschließend werde ich erläutern, warum ein freier Wille ein Wille unter sittlichen Gesetzen und damit verbunden eine freie Handlung eine moralische Handlung ist, und im Zusammenhang damit wiederum darlegen, inwieweit nun auch die Unterlassung einer Handlung eine moralisch bewertbare Tat ist.
Für Kant ist Freiheit, wie oben schon erwähnt, die Fähigkeit eines Subjekts, durch eine Handlung von sich aus eine Ursache in der Welt zu setzen, und damit eine Kette kausaler Verknüpfungen in Gang zu setzen, d.h. die gesetzte Ursache hat eine Wirkung welche wiederum gleichzeitig Ursache ist, die auch wieder eine Wirkung hat usw. . Nun sagt Kant aber weiter, daß alles, was in der Welt der Erscheinung passiert, nach diesem Naturgesetz abläuft, d.h. keine Begebenheit existieren kann, die nicht eine in der Zeit vorausgehende Ursache hat. Da wir als Menschen mit unserem Sinnesapparat Ereignisse und Dinge gar nicht anders wahrnehmen können als als Erscheinungen, können wir diese also auch gar nicht anders als nach dem Kausalprinzip verknüpft wahrnehmen. Hieraus ergibt sich ein Widerspruch, denn wie soll der Mensch aus Freiheit selbst eine Ursache stiften, wenn jede Ursache nach dem Naturgesetz selbst wieder eine Wirkung ist, die auch eine Ursache hat ? Diesen Widerspruch handelt Kant in der „Freiheitsantinomie"[1] ab, wo er sowohl den Beweis für die Thesis, daß „Kausalität nach Gesetzen der Natur... nicht die einzige [ist] ..."[2], als auch den für die Antithesis, daß es keine Freiheit gibt sondern alles in der Welt lediglich nach Gesetzen der Natur geschieht, darlegt. Den Beweis für die Thesis führt Kant darüber, daß er sagt: wenn es für alles, was geschieht, eine Ursache gibt, so muß diese Ursache auch wieder etwas in der Zeit vorausgehendes haben, und sie ist damit wieder nur Wirkung einer anderen Ursache usw. . Wenn dies also tatsächlich so ist, kann es niemals einen „ersten Anfang"[3] geben, und die Kausalreihe wäre nicht vollständig. Weiter argumentiert Kant damit, daß er sagt, es ist a priori einsehbar, daß ohne Ursache nichts geschieht, womit der Satz, daß „alle Kausalität nur nach Naturgesetzen möglich sei, sich selbst in seiner unbeschränkten Allgemeinheit [widerspricht]"[4], und es noch eine andere Kausalität geben muß, nämlich eine aus Freiheit, d.h. ein Vermögen, „eine Reihe von Erscheinungen, die nach Naturgesetzen läuft, von selbst anzufangen"[5].
Die Antithesis beweist Kant, indem er annimmt, es gäbe so etwas wie Freiheit als ein Vermögen, eine Reihe von Ereignissen von selbst zu starten, so würde auch die Kausalität einfach „von selbst anfangen", d.h. der Mensch hätte sie durch seine Fähigkeit, Ursachen stiften zu können, erst erschaffen. Weiter ist Kant davon überzeugt, daß „ein jeder Anfang zu handeln einen Zustand der noch nicht handelnden Ursache voraus[setzt]"[6] und jeder „dynamisch erste Anfang der Handlung"[7] würde unter der Freiheit überhaupt keinen Zusammenhang mit den der Handlung vorhergehenden und sie verursachenden Ursachen aufweisen können, und somit wäre die transzendentale Freiheit dem Kausalgesetz entgegen und selbige würde ausscheiden. Demnach wäre keine „Einheit der Erfahrung möglich"[8], auch könnte man die Kausalität in keiner Erfahrung antreffen und sie wäre mithin „ein leeres Gedankending"[9].
Da Freiheit Unabhängigkeit von dem Naturgesetz bedeutet, „ist [sie] zwar eine Befreiung vom Zwange, aber auch vom Leitfaden aller Regeln"[10], denn Gesetze der Freiheit können in der empirischen Welt nie mit dem Kausalitätsgesetz korrespondieren, denn wäre die Freiheit nach dem Naturgesetz bestimmt, wäre sie selbst „nichts anderes als Natur"[11]. „Natur also und transzendentale Freiheit unterscheiden sich wie Gesetzmäßigkeit und Gesetzlosigkeit"[12]. Freiheit, da sie selbst nicht nach dem Gesetz der Natur funktioniert, „[reißt] den Leitfaden der Regeln [ab], an welchem allein eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung möglich ist"[13].
Die Auflösung dieser Antinomie nimmt Kant weiter hinten in der Kritik der reinen Vernunft vor, sie muß transzendental sein, da diese Aufgabe eine der „sich über die Grenzen möglicher Erfahrung hinauswagenden Vernunft"[14] ist.
Nun geht Kant zunächst von einer falschen Voraussetzung aus: Angenommen, Erscheinungen wären Dinge an sich selbst, dann wären auch Raum und Zeit Formen des Daseins der Dinge an sich selbst und es gäbe kein anderes Gesetz, nach dem Dinge passieren könnten, als das der Kausalität. Wäre dies tatsächlich so, könnte es so etwas wie transzendentale Freiheit gar nicht geben, denn alle Ereignisse stünden in einem strengen, zeitlich gegliederten Ursache-Wirkungs-Verhältnis, d.h. es gäbe kein Ereignis, das nicht vorher schon durch ein anderes verursacht worden wäre. In Wahrheit ist es aber nicht so, daß Erscheinungen Dinge an sich selbst sind, „sondern bloße Vorstellungen, die nach empirischen Gesetzen zusammenhängen"[15]. Erscheinungen haben aber noch etwas, was „hinter" ihnen steht, nämlich die Dinge an sich, d.h. die letzteren, von denen wir zwar nichts wissen können, liefern uns das Material das unser Verstand zuerst nach den apriorischen Formen der Sinnlichkeit, Raum und Zeit ordnet und anschließend mit Hilfe der Verstandeskategorien weiter verwertbar macht. Und hier passiert Kant etwas Merkwürdiges, denn er schreibt, die Dinge an sich verursachten die Erscheinungen, d.h. ein Ding an sich sei eine Ursache, deren Wirkung die dazugehörige Erscheinung ist - Kant wendet also das Kausalitätsprinzip auf das Verhältnis von Ding an sich und Erscheinung an. Dies ist nun insofern merkwürdig, da die Kausalität nach Kant selbst eine Kategorie unseres Verstandes ist, mit deren Hilfe es uns möglich ist, das Material, das uns die Sinnlichkeit liefert, überhaupt erst in einen für uns logischen Zusammenhang zu bringen. D.h. daß das, was hinter dem Vorhang der Erscheinung, also in der Welt des Dinges an sich passiert in keinerlei kausalen Beziehungen zueinander steht, und es daher auch unmöglich sein dürfte, daß zwischen Ding an sich und Erscheinung ein kausales Verhältnis besteht, denn die Kausalität ist nur auf die Welt der (für den Mensch wahrnehmbaren) Erscheinungen beschränkt. Dennoch beruht auf dieser Behauptung die ganze Auflösung der Freiheitsantinomie, denn so kann eine Wirkung, da ihre Ursache nicht in der Reihe der Erscheinungen zu suchen ist, frei sein „und doch zugleich in Ansehung der Erscheinungen als Erfolg aus denselben nach der Notwendigkeit der Natur, angesehen werden"[16]. Ein handelndes Wesen kann man demnach aus zwei Seiten betrachten: einmal als intelligibel, d.h. als Ding an sich, das handelt und Ursachen dadurch stiftet, und als sensibel, als Erscheinung in der Sinnenwelt dessen Wirkungen mit den anderen Erscheinungen kausal verknüpft zu sein scheinen. Kant spricht auch vom „empirischen Charakter" des Subjekts, „wodurch seine Handlungen, als Erscheinungen durch und durch mit anderen Erscheinungen nach beständigen Naturgesetzen im Zusammenhange"[17] stehen, es also so aussieht, als ließe sich jede Handlung des Menschen durch andere erklären bzw. als stünden sie alle als „Glieder einer einzigen Reihe der Naturordnung"[18] hintereinander. Weiter, behauptet Kant, hätte das Subjekt auch noch einen „intelligiblen Charakter", d.h. einen, der außerhalb der Welt der Erscheinungen, im Bereich des Dinges an sich angesiedelt ist, und mit dem allein es dem Subjekt möglich ist, freie Entscheidungen zu treffen. Dieser intelligible Charakter ist zwar selbst Ursache aller Handlungen, steht allerdings unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit.
[...]
[1] I. Kant. Kritik der reinen Vernunft. A 444 / B 472 - A451 / B479
[2] I. Kam, K. r. V., A 444 / B472
[3] I. Kant, K. r. V., A 446/ B 474
[4] siehe Fußnote Nr. 3
[5] siehe Fußnote Nr. 3
[6] siehe Fußnote Nr. 3
[7] siehe Fußnote Nr. 3
[8] I. Kant, K. r. V.. A 447 / B 475
[9] siehe Fußnote Nr. 8
[10] siehe Fußnote Nr. 8
[11] siehe Fußnote Nr. 8
[12] siehe Fußnote Nr. 8
[13] I. Kant, K. r. V..A 450/ B 478
[14] 1. Kant. K. r. V.. A 535 / B 563
[15] I. Kant, K. r. V., A 537 / B 565
[16] siehe Fußnote Nr. 15
[17] I. Kant, K. r. V. A 539 / B567
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptfragestellungen in Immanuel Kants Schriften bezüglich Freiheit?
In Kants Werken, insbesondere der „Kritik der reinen" und „der praktischen Vernunft", wird untersucht, ob der Mensch Freiheit besitzt und worin diese sich äußert. Es geht darum, ob menschliches Handeln frei und selbstverursacht sein kann, oder ob die Welt ausschließlich nach dem Kausalprinzip abläuft.
Wie definiert Kant Freiheit?
Für Kant ist Freiheit die Fähigkeit eines Subjekts, durch eine Handlung von sich aus eine Ursache in der Welt zu setzen und damit eine Kette kausaler Verknüpfungen in Gang zu bringen.
Was ist die Freiheitsantinomie und wie löst Kant sie auf?
Die Freiheitsantinomie entsteht durch den Widerspruch, dass einerseits alles in der Welt der Erscheinung nach dem Kausalgesetz abläuft, andererseits der Mensch aus Freiheit selbst eine Ursache stiften soll. Kant löst die Antinomie auf, indem er zwischen der Welt der Erscheinungen und der Welt der Dinge an sich unterscheidet. Erscheinungen sind Vorstellungen, die nach empirischen Gesetzen zusammenhängen, während die Dinge an sich die Ursache der Erscheinungen sind. Dadurch kann eine Handlung frei sein, während ihre Wirkung in der Welt der Erscheinungen kausal verknüpft ist.
Was bedeutet der "empirische Charakter" und der "intelligible Charakter" des Subjekts?
Der empirische Charakter beschreibt, wie die Handlungen eines Subjekts in der Welt der Erscheinungen mit anderen Erscheinungen nach Naturgesetzen zusammenhängen. Der intelligible Charakter hingegen ist außerhalb der Welt der Erscheinungen angesiedelt und ermöglicht dem Subjekt, freie Entscheidungen zu treffen.
Wie verhält sich Freiheit zum Kausalitätsprinzip?
Freiheit bedeutet Unabhängigkeit vom Naturgesetz und damit auch vom Kausalitätsprinzip. Gesetze der Freiheit können in der empirischen Welt nicht mit dem Kausalitätsgesetz korrespondieren.
Warum ist die Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich wichtig für Kants Freiheitslehre?
Die Unterscheidung ermöglicht es Kant, Freiheit und Kausalität miteinander zu vereinbaren. Eine Handlung kann als Erscheinung Teil der kausalen Kette sein, während sie gleichzeitig in ihrem Ursprung (dem Ding an sich) frei sein kann.
Was ist die Bedeutung der Unterlassung einer Handlung im Kontext von Kants Freiheitslehre?
Der Text deutet an, dass die Frage, ob die Unterlassung einer Handlung ebenfalls eine moralisch bewertbare Tat ist, im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht wird. Es wird gefragt, inwieweit auch die Unterlassung einer Handlung eine moralisch bewertbare Tat ist.
- Quote paper
- M.A. Claudia Hoppe (Author), 1998, Warum sowohl eine Handlung als auch ihre Unterlassung vom freien Willen des Menschen zeugen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112803