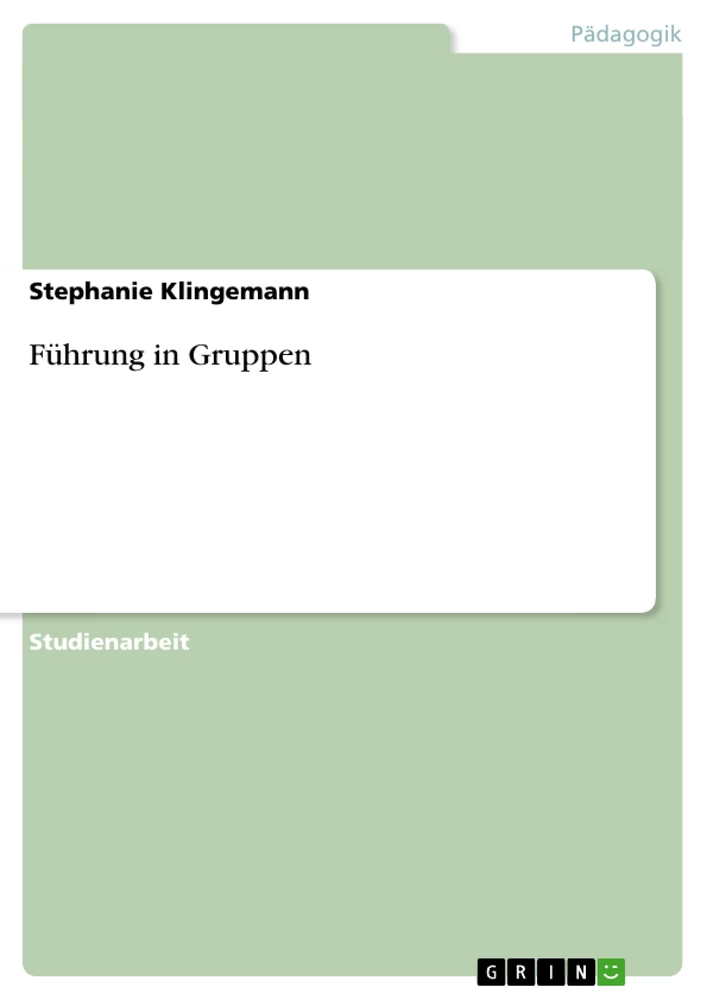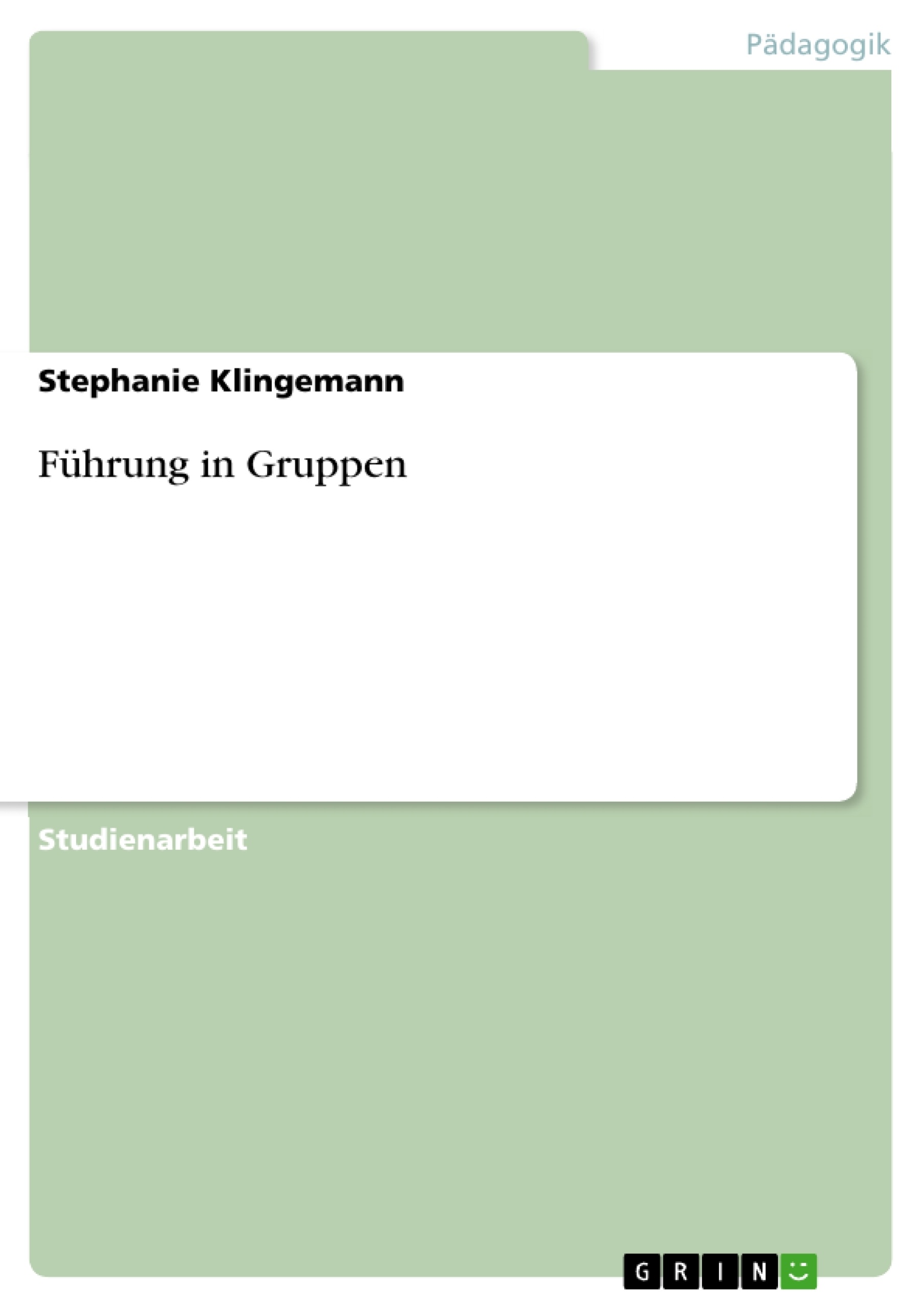Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Prozess der Gruppenführung und den verschiedenen Arten ihrer Ausführung.
Die zentrale Bedeutung der Führung in der Gruppenforschung wird anhand der zahlreichen Untersuchungen ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts und den vielen Ausführungen in der Literatur überdeutlich.
Ich habe mich in meiner Arbeit auf die Untersuchungen von Lewin, Lippitt &White (1939), Hemphill, Fleishman, Stogdill und Shartle aus den 50er Jahren und Fiedler aus dem Jahre 1967 beschränkt, um die einzelnen theoretischen Ansätze der Führungsforschung näher zu erläutern.
Lewin et al. beschäftigen sich mit den einzelnen Führungsstilen, Hemphill et al. beziehen außerdem noch das Verhalten der Führer aus Sicht der Geführten in ihre Untersuchungen mit ein.
Dann stelle ich noch das Kontingenzmodell von Fiedler vor, der davon ausgeht, dass der Führungserfolg von vielen verschiedenen Variablen abhängt und nicht nur vom Führungsverhalten.
Am Ende dieser Arbeit beschäftige ich mich mit der Frage, ob eine Gruppe ohne Führung erfolgreich sein kann und beziehe dazu das Beispiel der Selbsthilfegruppen in meine Überlegungen mit ein.
Wegen der Fülle an Literatur und der Begrenztheit dieser Arbeit habe ich nur eine Auswahl an Literatur und Untersuchungen herangezogen, die aber meiner Meinung nach einen guten Überblick über den Prozess der Gruppenführung geben.
II. Führung und Führungsforschung
1. Was ist Führung?
In einer Gruppe entsteht durch die wechselseitige Beeinflussung ihrer Mitglieder eine Dynamik, die auf das Erreichen der gruppenintern festgelegten Ziele gerichtet ist.
Die Personen, die Einfluss auf die Gruppe nehmen und das Gruppenvorhaben maßgeblich bestimmen und koordinieren, werden Gruppenführer genannt (Wellhöfer, 1993, S. 83).
Rosenstiel, Molt und Rüttinger (1988) bezeichnen Führung als „zielbezogene Einflussnahme auf andere“ (zitiert nach Brodbeck, Maier und Frey, 2002, S. 329), wobei man zwischen menschlicher Führung und struktureller Führung unterscheiden muss.
Ein menschlicher Führer hat die Aufgabe, Einfluss auf die Mitglieder seiner Gruppe auszuüben, sie zu motivieren und sie in der Gemeinschaft zusammenzuhalten, damit das Erreichen der vereinbarten Ziele im Kollektiv möglich ist (Brodbeck, Maier und Frey, 2002, S. 329).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Führung und Führungsforschung
- 1. Was ist Führung?
- 2. Theoretische Ansätze der Führungsforschung
- 2.1 Personalistische Ansätze
- 2.2 Verhaltensorientierte Ansätze
- 2.2.1 Gibt es den erfolgreichen Führungsstil?
- 2.2.2 Das Ohio State - Führungsforschungsprojekt
- 2.2.3 Kritik
- 2.3 Kontingenztheoretische Ansätze
- 2.3.1 Fiedlers Kontingenzmodell (1967)
- III. Gruppe ohne Führung – Chaos oder Chance?
- Selbsthilfegruppen und ihre prinzipielle Führerlosigkeit
- IV. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Prozess der Gruppenführung und den verschiedenen Arten ihrer Ausführung. Sie analysiert verschiedene theoretische Ansätze der Führungsforschung, insbesondere die personalistischen, verhaltensorientierten und kontingenztheoretischen Ansätze. Die Arbeit untersucht auch die Frage, ob eine Gruppe ohne Führung erfolgreich sein kann, und bezieht dazu das Beispiel der Selbsthilfegruppen ein.
- Analyse verschiedener theoretischer Ansätze der Führungsforschung
- Untersuchung der Bedeutung von Führungsstilen und deren Einfluss auf Gruppenprozesse
- Bewertung der Rolle von Führung in der Gruppenentwicklung und -dynamik
- Diskussion der Frage, ob Gruppen ohne Führung erfolgreich sein können
- Analyse von Selbsthilfegruppen als Beispiel für Gruppen ohne Führung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Gruppenführung ein und erläutert die zentrale Bedeutung der Führung in der Gruppenforschung. Sie stellt die wichtigsten Forschungsarbeiten und theoretischen Ansätze vor, die in der Arbeit behandelt werden.
Das Kapitel "Führung und Führungsforschung" definiert den Begriff der Führung und unterscheidet zwischen menschlicher und struktureller Führung. Es stellt verschiedene theoretische Ansätze der Führungsforschung vor, darunter die personalistischen, verhaltensorientierten und kontingenztheoretischen Ansätze. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Führungsstile und deren Einfluss auf Gruppenprozesse.
Das Kapitel "Gruppe ohne Führung – Chaos oder Chance?" untersucht die Frage, ob eine Gruppe ohne Führung erfolgreich sein kann. Es analysiert das Beispiel der Selbsthilfegruppen und zeigt, dass Gruppen auch ohne explizite Führungsstruktur erfolgreich sein können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gruppenführung, Führungsforschung, Führungsstile, Selbsthilfegruppen, Gruppenprozesse, Gruppenentwicklung, Gruppendynamik, Einflussnahme, Motivation, Zielerreichung, Kontingenzmodell, Personalistische Ansätze, Verhaltensorientierte Ansätze, Ohio State - Führungsforschungsprojekt, Fiedlers Kontingenzmodell.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Führung in einer Gruppe?
Führung wird als zielbezogene Einflussnahme auf andere definiert, um Gruppenprozesse zu koordinieren und gemeinsame Ziele zu erreichen.
Gibt es einen "perfekten" Führungsstil?
Die Forschung (z.B. Fiedlers Kontingenzmodell) legt nahe, dass der Erfolg eines Führungsstils von der jeweiligen Situation und verschiedenen Variablen abhängt.
Kann eine Gruppe ohne Führung erfolgreich sein?
Ja, das Beispiel der Selbsthilfegruppen zeigt, dass Gruppen durch Selbstorganisation auch ohne formale Leitung effektiv funktionieren können.
Was ist der Unterschied zwischen menschlicher und struktureller Führung?
Menschliche Führung basiert auf direkter Interaktion und Motivation, während strukturelle Führung durch Rahmenbedingungen und Regeln erfolgt.
Welche klassischen Ansätze der Führungsforschung werden untersucht?
Die Arbeit behandelt personalistische Ansätze (Eigenschaften des Führers), verhaltensorientierte Ansätze (Führungsstile) und kontingenztheoretische Ansätze.
- Citation du texte
- Stephanie Klingemann (Auteur), 2006, Führung in Gruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112904