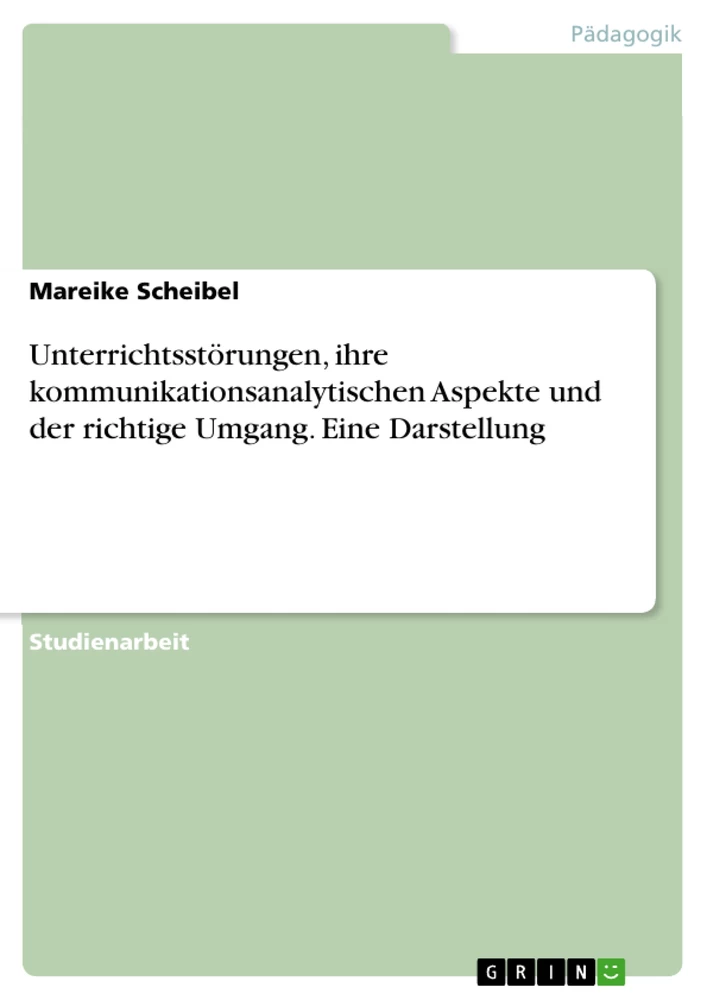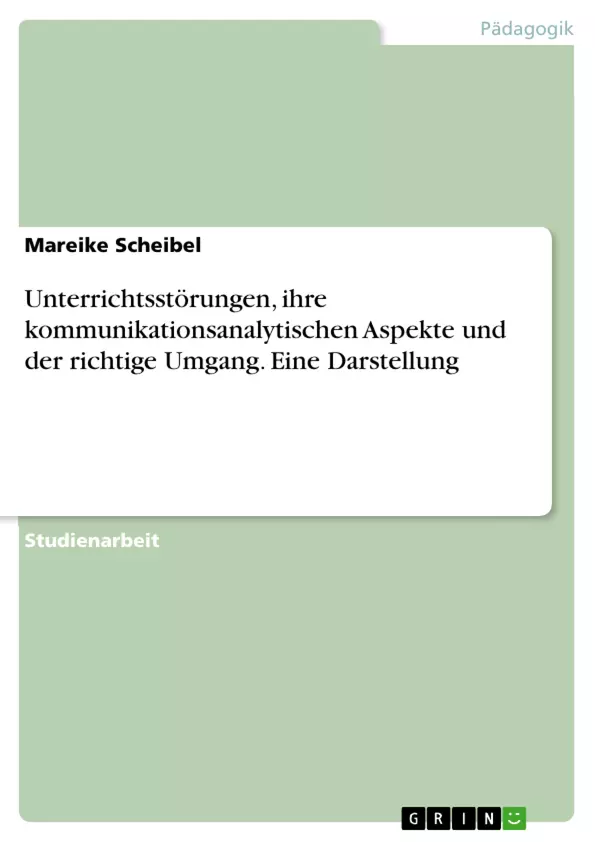Diese Arbeit stellt sich die Fragen: Wie reagieren die Lehrpersonen in welchem Umfang individuell auf welche Art von Unterrichtsstörungen und welche Einflüsse hat die Disziplinierung auf den betreffenden Lernenden sowie das situativ verortete Umfeld?
Dieser Thematik wird besondere Relevanz zugesprochen, weil der Umgang mit Unterrichtsstörungen in der LehrerInnenbildung eine untergeordnete Rolle spielt, aber im Rahmen der Klassenführung, der interpersonellen Interaktion und der langfristigen psychischen Spannungen der Lernenden und Lehrenden einen äußert wichtigen Platz einnimmt. Zudem kann es hilfreich sein, um im Beruf als Lehrkraft Gründe für das Auftreten von Störungen identifizieren und ihnen kompetent begegnen zu können.
Während Unterrichtshospitationen offenbaren sich eine Vielzahl von Eindrücken der erzieherischen Arbeit eines/r Pädagogen/In. Neben der Lehrtätigkeit obliegt diesem/r auch die anspruchsvolle Aufgabe der Disziplinierung bei Fehlverhalten und Störungen im Unterricht. Darunter versteht man im Allgemeinen das Verhalten eines Individuums oder mehrerer Personen, die zum Unterbrechen des Unterrichtsverlaufes führen und direkte oder indirekte pädagogische Interventionen erfordern.
Besonders auffallend sind in diesem Kontext die unterschiedliche Einschätzung von Unterrichtsstörungen durch die Lehrkräfte selbst sowie die personell variierenden Möglichkeiten der Disziplinierung und deren Wahrnehmung im Kollektiv ins Auge.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche Einordnung
- 2.1 Aspekte der Klassenführung
- 2.2 Konkretisierungen des Störungsbegriffes
- 2.3 Ursachen für Störungen
- 3. Aspekt geleitete Beobachtung während der Hospitation
- 3.1 Darlegung der beobachteten Situation
- 3.2 Betrachtungen unter dem Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun
- 3.3 Problembereiche der dargelegten Reaktionen
- 4. Alternative Gestaltungsmöglichkeiten
- 4.1 Verfahrens- und Verhaltensregeln
- 4.2 konstruierte Verhaltensregeln im Interaktionsprozess
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit Unterrichtsstörungen und deren Einfluss auf Lernende und Lehrende. Die Autorin befasst sich mit der Frage, wie Lehrkräfte auf unterschiedliche Störungen reagieren und welche Auswirkungen die gewählte Disziplinierung auf das Lernumfeld hat. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der mangelnden Berücksichtigung dieses Themas in der Lehrerbildung.
- Klassenführung und deren Einfluss auf das Auftreten von Störungen
- Definition und Ursachen von Unterrichtsstörungen
- Analyse einer beobachteten Störungssequenz unter Anwendung des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun
- Problembereiche der Reaktionen auf Störungen
- Alternative Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Störungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit dem Thema Unterrichtsstörungen auseinanderzusetzen. Sie hebt die Diskrepanz zwischen der Bedeutung des Umgangs mit Störungen im Lehreralltag und der untergeordneten Rolle in der Lehrerbildung hervor. Die Autorin stellt zentrale Forschungsfragen und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Analyse einer beobachteten Situation und die Entwicklung von alternativen Gestaltungsmöglichkeiten konzentriert.
2. Begriffliche Einordnung: Dieses Kapitel bietet eine begriffliche Klärung von Klassenführung und Unterrichtsstörungen. Es werden verschiedene Definitionen von Klassenführung vorgestellt, wobei der Fokus auf den erzieherischen Aspekten und der Bewältigung von Verhaltensauffälligkeiten liegt. Die Autoren diskutieren die Herausforderungen der Klassenführung in heterogenen Lerngruppen und betonen die unzureichende Berücksichtigung erzieherischer Kompetenzen in der Lehrerbildung. Der Begriff der Unterrichtsstörung wird anhand verschiedener Definitionen konkretisiert, wobei die unterschiedlichen Perspektiven auf Störungen als individuelle Verhaltensweisen oder als interaktive Ereignisse herausgestellt werden.
3. Aspekt geleitete Beobachtung während der Hospitation: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer beobachteten Störungssequenz im Unterricht. Die Autorin beschreibt detailliert die Situation und analysiert diese anhand des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun. Die Analyse beleuchtet die verschiedenen Ebenen der Kommunikation (Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appell-Ebene) und zeigt auf, wie Missverständnisse und Konflikte entstehen können. Die daraus resultierenden Problembereiche der beobachteten Reaktionen werden ausführlich diskutiert.
4. Alternative Gestaltungsmöglichkeiten: Aufbauend auf der Analyse der beobachteten Situation im vorherigen Kapitel, entwickelt dieses Kapitel alternative Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Unterrichtsstörungen. Es werden exemplarische Verfahrens- und Verhaltensregeln vorgestellt und deren Anwendung im Interaktionsprozess konstruiert. Der Fokus liegt auf proaktiven Strategien der Klassenführung, die präventiv Störungen entgegenwirken sollen und zu einem konstruktiven Lernklima beitragen.
Schlüsselwörter
Klassenführung, Unterrichtsstörungen, Kommunikation im Unterricht, Kommunikationsmodell Schulz von Thun, Verhaltensregeln, Lehrerbildung, Prävention, Interaktion, heterogene Lerngruppen.
Häufig gestellte Fragen zu: Umgang mit Unterrichtsstörungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Umgang mit Unterrichtsstörungen und deren Einfluss auf Lernende und Lehrende. Sie analysiert, wie Lehrkräfte auf Störungen reagieren und welche Auswirkungen die gewählte Disziplinierung auf das Lernumfeld hat. Ein Schwerpunkt liegt auf der unzureichenden Berücksichtigung dieses Themas in der Lehrerbildung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Klassenführung und deren Einfluss auf das Auftreten von Störungen, Definition und Ursachen von Unterrichtsstörungen, Analyse einer beobachteten Störungssequenz mit dem Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun, Problembereiche der Reaktionen auf Störungen und alternative Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Störungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffliche Einordnung (inkl. Aspekte der Klassenführung, Konkretisierungen des Störungsbegriffes und Ursachen für Störungen), Aspekt geleitete Beobachtung während der Hospitation (inkl. Darlegung der beobachteten Situation, Betrachtungen unter dem Kommunikationsmodell von Schulz von Thun und Problembereiche der dargelegten Reaktionen), Alternative Gestaltungsmöglichkeiten (inkl. Verfahrens- und Verhaltensregeln und konstruierte Verhaltensregeln im Interaktionsprozess) und Fazit.
Wie wird die beobachtete Störungssequenz analysiert?
Die Analyse der beobachteten Störungssequenz erfolgt anhand des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun. Dabei werden die verschiedenen Kommunikationsebenen (Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appell-Ebene) betrachtet, um Missverständnisse und Konflikte aufzuzeigen.
Welche Lösungsansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit entwickelt alternative Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Unterrichtsstörungen. Es werden exemplarische Verfahrens- und Verhaltensregeln vorgestellt und deren Anwendung im Interaktionsprozess konstruiert. Der Fokus liegt auf proaktiven Strategien der Klassenführung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Klassenführung, Unterrichtsstörungen, Kommunikation im Unterricht, Kommunikationsmodell Schulz von Thun, Verhaltensregeln, Lehrerbildung, Prävention, Interaktion, heterogene Lerngruppen.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen der Bedeutung des Umgangs mit Störungen im Lehreralltag und der untergeordneten Rolle in der Lehrerbildung. Zentrale Fragen sind, wie Lehrkräfte auf unterschiedliche Störungen reagieren und welche Auswirkungen die gewählte Disziplinierung auf das Lernumfeld hat.
Welche Methode wird verwendet?
Es wird eine aspektgeleitete Beobachtung während einer Hospitation eingesetzt, um eine Störungssequenz zu analysieren. Die Analyse erfolgt unter Anwendung des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun.
- Quote paper
- Mareike Scheibel (Author), 2020, Unterrichtsstörungen, ihre kommunikationsanalytischen Aspekte und der richtige Umgang. Eine Darstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129902