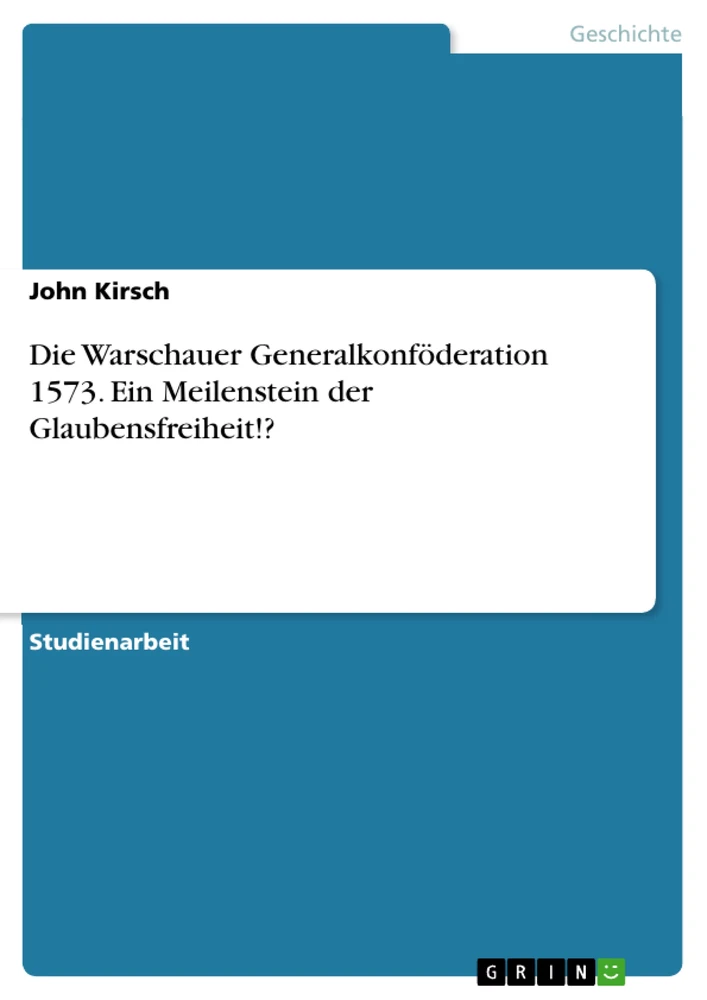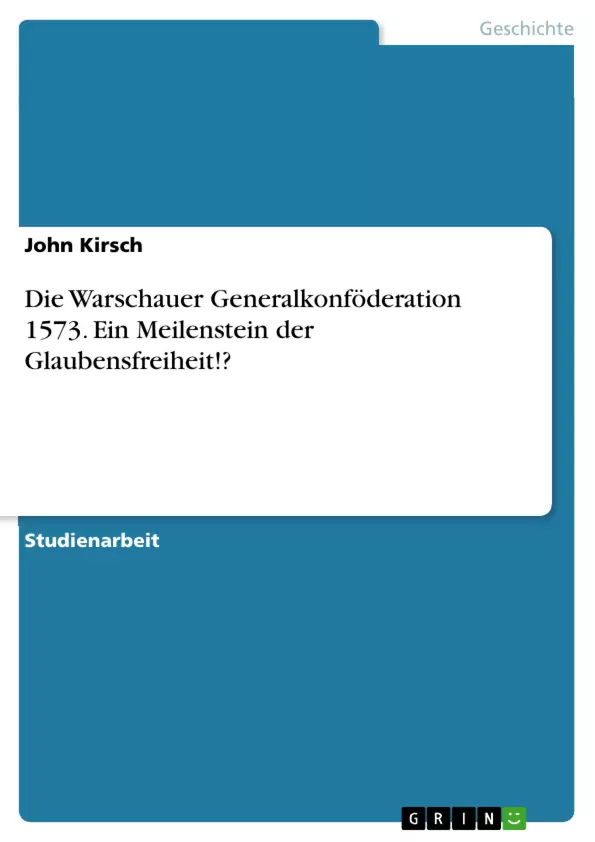In dieser Arbeit wird die Generalkonföderation aus dem Jahre 1573 bezüglich der in ihr enthaltenen Beschlüsse analysiert.
Es soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern die Bestimmungen die Glaubensfreiheit der polnisch-litauischen Bevölkerung gewährleisteten und welche Motive der protestantische Adel hierbei verfolgte.
Zu Beginn der Arbeit wird die konfessionelle Situation in Polen hinsichtlich der Reformation im 16. Jahrhundert beleuchtet. Anschließend werden die 13 Artikel des Rechtsaktes im Hinblick auf religiöse Aspekte untersucht, gefolgt von einer Analyse der Motive des protestantischen Adels.
„Verheischen und versprechen einander vor uns und unsere Nachkommene zu ewigen Zeitten kraft gelaisten Aydschwur bei unserem gutten Glauben, Ehren und Gewissen, das wir uns obschon ungleich in geistlichen Gewissenssachen gesint, des lieben Friedens untereinander befleissen und wegen Übung dieser oder jener Religion oder Enderung des Gottesdienstes kein Menschen Blut zu irgendeiner Zeit vergissen wollen“.
Nur wenige Monate zuvor, im August 1572, wurden in Frankreich Tausende reformierte Gläubige auf grausame Weise massakriert. Während das Recht der Glaubensfreiheit im immer noch überwiegend katholischen Frankreich nicht in Frage kam, schlug die polnische Regierung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls mit der Bewältigung von religiösen Konflikten konfrontiert sah, einen vermeintlich anderen Weg ein.
Was die Forschungslage zu der Warschauer Generalkonföderation betrifft, ist unter anderem von Tazbir untersucht worden, inwieweit Menschen, die sich der Reformation anschlossen, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts toleriert wurden und wie diese Toleranz aufrechterhalten werden sollte. Preusse ging in seiner Abhandlung zu dem genannten Rechtsakt auf die Ausdifferenzierung von Politik und Religion in Polen-Litauen ein. Des Weiteren liegt von Schramm ein ausführlicher Forschungsbericht zu dem Ursprung der Warschauer Konföderation vor, sowie ein Beitrag zur Geschichte des polnischen Adels zur Zeit der Reformation.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das konfessionelle Polen im 16. Jahrhundert
- 3. Die Warschauer Generalkonföderation vom 28. Januar 1573.
- 3.1 Die konfessionellen Maßnahmen
- 3.2 Die Motive des protestantischen Adels
- 4. Fazit
- 5. Quellenverzeichnis.
- 6. Literaturverzeichnis...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Generalkonföderation vom 28. Januar 1573, um zu untersuchen, inwieweit ihre Bestimmungen die Glaubensfreiheit der polnisch-litauischen Bevölkerung gewährleisteten und welche Motive der protestantische Adel dabei verfolgte. Die Arbeit beleuchtet zunächst die konfessionelle Situation in Polen während der Reformation im 16. Jahrhundert. Anschließend werden die 13 Artikel des Rechtsaktes im Hinblick auf religiöse Aspekte untersucht, gefolgt von einer Analyse der Motive des protestantischen Adels.
- Konfessionelle Situation in Polen im 16. Jahrhundert
- Bestimmungen der Generalkonföderation von 1573 bezüglich der Glaubensfreiheit
- Motive des protestantischen Adels
- Einfluss der Generalkonföderation auf die polnisch-litauische Gesellschaft
- Bedeutung der Warschauer Generalkonföderation für die Geschichte der Religionsfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Warschauer Generalkonföderation von 1573 ein und beleuchtet die historische und konfessionelle Situation in Polen-Litauen im 16. Jahrhundert. Sie stellt die Frage nach der Gewährleistung der Glaubensfreiheit durch die Bestimmungen der Konföderation und die Motive des protestantischen Adels. Die Einleitung bezieht sich auf die Forschungsliteratur zu diesem Thema und gibt einen Überblick über die Struktur der Hausarbeit.
2. Das konfessionelle Polen im 16. Jahrhundert
Dieses Kapitel befasst sich mit der konfessionellen Situation in Polen im 16. Jahrhundert, insbesondere mit der Verbreitung der Reformation. Es beschreibt die politische und gesellschaftliche Situation in Polen während des „Goldenen Zeitalters“ und beleuchtet den Einfluss des Humanismus sowie die Reaktion des polnischen Königs auf die Verbreitung reformatorischer Ideen.
3. Die Warschauer Generalkonföderation vom 28. Januar 1573.
Dieses Kapitel analysiert die Warschauer Generalkonföderation vom 28. Januar 1573. Es betrachtet die konfessionellen Maßnahmen der Konföderation und untersucht die Motive des protestantischen Adels. Das Kapitel geht auf die historischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Konföderation sowie auf die Rolle der Glaubensfreiheit für die polnische Gesellschaft ein.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Warschauer Generalkonföderation, Glaubensfreiheit, Konfession, Reformation, Protestantismus, Polen-Litauen, 16. Jahrhundert, polnischer Adel, religiöse Toleranz, Wahlkönigtum.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Warschauer Generalkonföderation von 1573?
Die Warschauer Generalkonföderation war ein bedeutender Rechtsakt in Polen-Litauen, der den Religionsfrieden sicherte und als Meilenstein der Glaubensfreiheit in Europa gilt.
Welche Bedeutung hatte die Konföderation für die Religionsfreiheit?
Die Mitglieder versprachen einander, trotz unterschiedlicher religiöser Ansichten Frieden zu halten und wegen des Glaubens kein Blut zu vergießen.
Warum war das Jahr 1573 für den Adel so wichtig?
Nach dem Tod des letzten Jagiellonen-Königs befand sich Polen im Interregnum. Der Adel musste Regeln für das zukünftige Zusammenleben und die Wahlkönige festlegen, um Bürgerkriege zu vermeiden.
Welche Motive verfolgte der protestantische Adel?
Der protestantische Adel wollte seine rechtliche Gleichstellung gegenüber der katholischen Mehrheit absichern und verhindern, dass religiöse Verfolgungen wie in Frankreich (Bartholomäusnacht) stattfanden.
Wie unterschied sich Polen-Litauen von anderen europäischen Staaten jener Zeit?
Während in Ländern wie Frankreich religiöse Minderheiten massakriert wurden, etablierte Polen-Litauen durch die Konföderation ein System der rechtlich garantierten Toleranz.
- Citar trabajo
- John Kirsch (Autor), 2021, Die Warschauer Generalkonföderation 1573. Ein Meilenstein der Glaubensfreiheit!?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129909