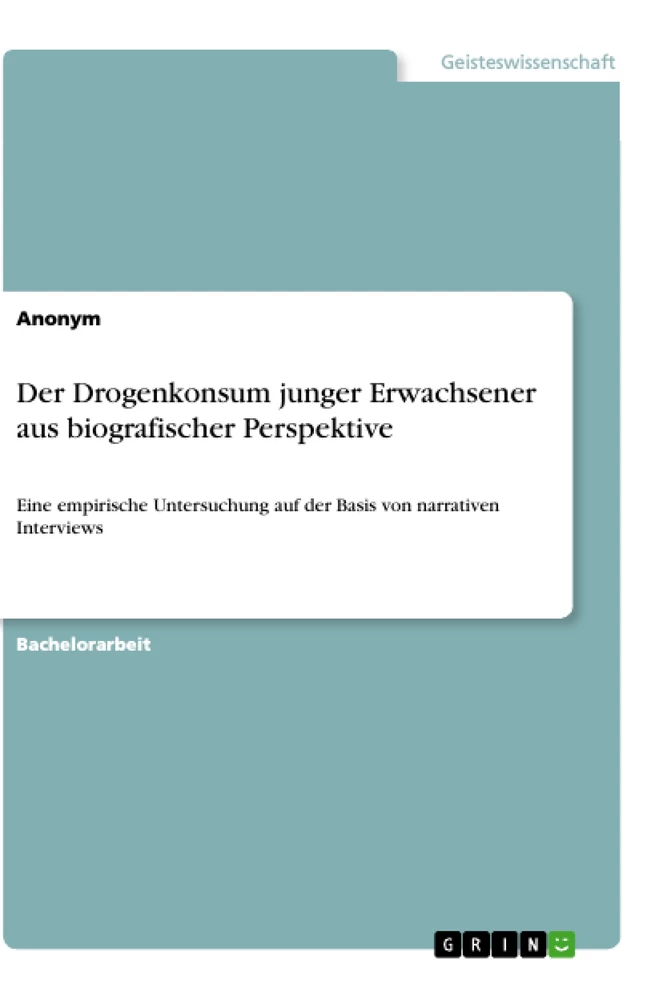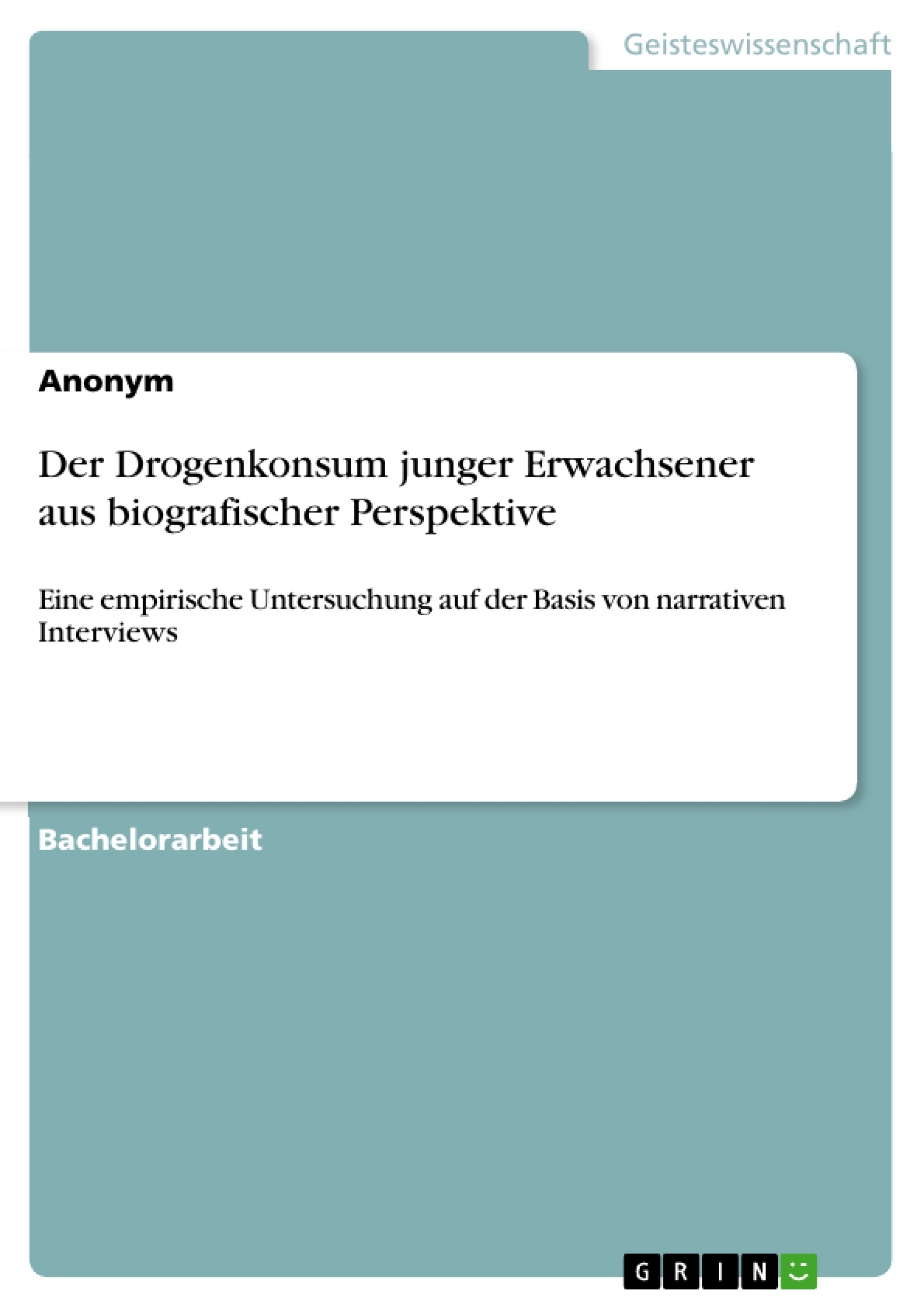Diese Arbeit beschäftigt sich mit substanzmittelbezogenen Risikoverhaltensweisen von jungen Erwachsenen.
Es wird der Frage nachgegangen, wie sich der individuelle Drogenkonsum am Übergang vom Jugend- bis ins Erwachsenenalter verändert. Ziel ist es zu klären, ob der Drogenkonsum in der Lebensphase der Erwachsenen fortgesetzt wird, und wenn ja,
auf welche Weise. Ein direkter Vergleich wird ermöglicht, indem die Beweggründe und Motive für den risikoreichen Substanzkonsum sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenalter ermittelt werden.
Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden narrative Interviews mit jungen Erwachsenen geführt. Diese berichten über den Beginn des Drogenkonsums im Jugendalter und die Entwicklung oder die Veränderung des Substanzgebrauchs in der bisherigen Biografie. Die Ergebnisse werden mit der theoretischen Grundlage aus der Fachliteratur diskutiert.
Die individuellen Drogengebrauchsentwicklungen zeigen eine allgemeine Abnahme des risikoreichen Konsumverhaltens, mit einer einhergehenden Abnahme der Häufigkeit und Zunahme der Verantwortung im Alltag durch die Berufstätigkeit, Gründung einer Familie, Umzug in eine eigene Wohnung oder Partnerschaft.
Dennoch wird deutlich, dass der Fokus von substanzmittelbezogenen Risikoverhaltensweisen nicht allein auf das Jugendalter gelegt werden sollte, sondern der Übergang und selbst der Eintritt in das Erwachsenenalter nicht
unbedingt den Ausstieg aus dem Substanzkonsum bedeuten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Lebensphase Jugend
- 2.1 Jugend als definierter Altersabschnitt
- 2.2 Die historische Entstehung der Lebensphase Jugend und dessen Entstrukturierung
- 2.3 Jugend als Transition oder Moratorium
- 2.3.1 Jugend als Transition in Bezug auf das Konzept der Entwicklungsaufgaben
- 2.3.2 Jugend als Moratorium
- 2.3.3 Jugend zwischen Transition und Moratorium
- 3 Risikoverhalten Jugendlicher
- 3.1 Begriffsklärung und Definition
- 3.2 Kategorisierung der Risikoverhaltensweisen
- 3.3 Einflussfaktoren des Risikoverhaltens
- 3.3.1 Jugendliche Geschlechtsrolle
- 3.3.2 Peer Group
- 3.3.3 Risikowahrnehmung
- 4 Drogenkonsum als Risikoverhalten von Jugendlichen
- 4.1 Begriffsklärung, Definition und gesetzliche Regelung
- 4.2 Gründe des Drogenkonsums (Entwicklungsaufgaben)
- 4.3 Risikofaktoren für den Substanzmissbrauch
- 4.4 Drogenkonsum im biografischen Verlauf
- 4.5 Erklärungsmodelle
- 4.5.1 Sensation Seeking
- 4.5.2 Milieus und Lebensstile
- 5 Forschungsmethodisches Vorgehen
- 5.1 Auswahl und Beschreibung der Zielgruppe
- 5.2 Das Erhebungsinstrument
- 5.3 Datenerhebung und Datenauswertung
- 6 Vorstellung der empirischen Ergebnisse
- 6.1 Hintergrundinformationen der Befragten
- 6.1.1 Ausbildungsniveau und aktuelle Beschäftigungssituation
- 6.1.2 Partnerschaft, Kinder und Pflege sozialer Beziehungen
- 6.1.3 Kontakt und Verhältnis zur Familie
- 6.2 Drogenkonsum-Verläufe
- 6.2.1 Umbrüche und Veränderungen des Drogenkonsums
- 6.2.2 Gründe für den Drogenkonsum
- 6.2.3 Konsumverhalten und -orte
- 6.2.4 Risikowahrnehmung
- 6.2.5 Zusätzliche Risikoverhaltensweisen
- 6.3 Lebensstil und Lebensphase
- 6.4 Auswirkungen des Drogenkonsums
- 6.1 Hintergrundinformationen der Befragten
- 7 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht substanzmittelbezogenes Risikoverhalten junger Erwachsener im Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter. Es wird analysiert, wie sich der individuelle Drogenkonsum verändert und ob der Eintritt ins Erwachsenenalter den Ausstieg aus dem Substanzkonsum bedeutet. Die Beweggründe und Motive für den Konsum in beiden Lebensphasen werden verglichen.
- Die Lebensphase Jugend: Definition, historische Entwicklung und theoretische Perspektiven (Transition und Moratorium).
- Risikoverhalten Jugendlicher: Typen, Kategorisierung und Einflussfaktoren.
- Drogenkonsum als Risikoverhalten: Gründe, Risikofaktoren und Erklärungsmodelle (Sensation Seeking, Milieus und Lebensstile).
- Biografischer Verlauf des Drogenkonsums: Veränderungen im Übergang zum Erwachsenenalter.
- Auswirkungen des Drogenkonsums auf Ausbildung, Beruf und Gesundheit.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht die Veränderung des Drogenkonsums junger Erwachsener am Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter, basierend auf narrativen Interviews. Sie beleuchtet die Problematik suchtmittelbezogener Risikoverhaltensweisen im Jugendalter und deren mögliche Weiterentwicklung im Erwachsenenleben. Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel, beginnend mit der Einleitung und dem theoretischen Hintergrund über die Lebensphase Jugend, Risikoverhalten und Drogenkonsum, gefolgt von der Methodik, den empirischen Ergebnissen und der Diskussion.
2 Die Lebensphase Jugend: Dieses Kapitel untersucht den Begriff „Jugend“ und dessen unterschiedliche Definitionen in Bezug auf Alter, historische Entwicklung und theoretische Ansätze. Es werden verschiedene Altersgrenzen diskutiert und die historische Entstehung der Jugendphase als eigenständiger Lebensabschnitt beschrieben. Abschließend werden zwei gegensätzliche theoretische Positionen beleuchtet: den Transitionsansatz und den Moratoriumsansatz, die Jugend als Übergangsphase bzw. als eigenständige Lebensphase mit eigenem Wert betrachten.
3 Risikoverhalten Jugendlicher: Dieses Kapitel definiert und kategorisiert Risikoverhalten bei Jugendlichen. Es werden verschiedene Risikotypen (gesundheitlich, delinquent, finanziell, ökologisch) und die Qualität des Risikos (latentes vs. evidentes Risikoverhalten) erörtert. Schließlich werden Einflussfaktoren wie die Geschlechtsrolle, die Peergroup und die Risikowahrnehmung untersucht.
4 Drogenkonsum als Risikoverhalten von Jugendlichen: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit dem Drogenkonsum als spezifische Form des Risikoverhaltens. Es definiert den Begriff „Droge“, differenziert zwischen legalem und illegalem Konsum, und beleuchtet die Funktionen des Drogenkonsums im Kontext von Entwicklungsaufgaben. Risikofaktoren für den Substanzmissbrauch werden ebenso wie Erklärungsmodelle (Sensation Seeking, Milieus und Lebensstile) vorgestellt. Der biografische Verlauf des Drogenkonsums vom Jugendalter bis ins junge Erwachsenenalter wird in diesem Kapitel auch behandelt.
5 Forschungsmethodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Auswahl und Beschreibung der Zielgruppe (sechs junge Erwachsene im Alter von 25 bis 31 Jahren), das verwendete Erhebungsinstrument (autobiographisch-narrative Interviews), sowie die Datenerhebung und -auswertung.
6 Vorstellung der empirischen Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der narrativen Interviews. Es werden die Hintergrundinformationen der Befragten (Ausbildung, Beruf, Familie, Beziehungen) sowie deren individuelle Drogenkonsumverläufe, Gründe für den Konsum, Konsumverhalten, Risikowahrnehmung und zusätzliche Risikoverhaltensweisen detailliert dargestellt. Der Lebensstil und die Selbsteinschätzung der aktuellen Lebensphase werden ebenfalls analysiert.
Schlüsselwörter
Drogenkonsum, junge Erwachsene, Jugendalter, Risikoverhalten, Entwicklungsaufgaben, Transition, Moratorium, Sensation Seeking, Lebensstile, Milieus, narrative Interviews, qualitative Forschung, Biografie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Substanzmittelbezogenes Risikoverhalten junger Erwachsener
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht substanzmittelbezogenes Risikoverhalten junger Erwachsener im Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter. Im Fokus steht die Veränderung des individuellen Drogenkonsums und die Frage, ob der Eintritt ins Erwachsenenalter den Ausstieg aus dem Substanzkonsum bedeutet. Die Beweggründe und Motive für den Konsum in beiden Lebensphasen werden verglichen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Lebensphase Jugend (Definition, historische Entwicklung, theoretische Perspektiven – Transition und Moratorium); Risikoverhalten Jugendlicher (Typen, Kategorisierung und Einflussfaktoren); Drogenkonsum als Risikoverhalten (Gründe, Risikofaktoren und Erklärungsmodelle wie Sensation Seeking, Milieus und Lebensstile); Biografischer Verlauf des Drogenkonsums (Veränderungen im Übergang zum Erwachsenenalter); Auswirkungen des Drogenkonsums auf Ausbildung, Beruf und Gesundheit.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf autobiographisch-narrativen Interviews mit sechs jungen Erwachsenen im Alter von 25 bis 31 Jahren. Das Kapitel „Forschungsmethodisches Vorgehen“ beschreibt detailliert die Auswahl der Zielgruppe, das Erhebungsinstrument und die Datenauswertung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Die Lebensphase Jugend, Risikoverhalten Jugendlicher, Drogenkonsum als Risikoverhalten von Jugendlichen, Forschungsmethodisches Vorgehen, Vorstellung der empirischen Ergebnisse, Diskussion und Schlussfolgerung (implizit). Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die empirischen Ergebnisse (Kapitel 6) präsentieren die Hintergrundinformationen der Befragten (Ausbildung, Beruf, Familie, Beziehungen) und deren individuelle Drogenkonsumverläufe, einschließlich der Gründe für den Konsum, des Konsumverhaltens, der Risikowahrnehmung und zusätzlicher Risikoverhaltensweisen. Der Lebensstil und die Selbsteinschätzung der aktuellen Lebensphase werden ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Drogenkonsum, junge Erwachsene, Jugendalter, Risikoverhalten, Entwicklungsaufgaben, Transition, Moratorium, Sensation Seeking, Lebensstile, Milieus, narrative Interviews, qualitative Forschung, Biografie.
Wie wird die Lebensphase "Jugend" definiert?
Das Kapitel "Die Lebensphase Jugend" diskutiert verschiedene Definitionen von Jugend, betrachtet die historische Entwicklung des Begriffs und analysiert gegensätzliche theoretische Ansätze: den Transitionsansatz (Jugend als Übergangsphase) und den Moratoriumsansatz (Jugend als eigenständige Lebensphase).
Welche Faktoren beeinflussen Risikoverhalten bei Jugendlichen?
Das Kapitel "Risikoverhalten Jugendlicher" untersucht Einflussfaktoren wie die Geschlechtsrolle, die Peergroup und die Risikowahrnehmung. Verschiedene Risikotypen (gesundheitlich, delinquent, finanziell, ökologisch) und die Qualität des Risikos (latentes vs. evidentes Risikoverhalten) werden erörtert.
Wie wird der Drogenkonsum im Kontext von Entwicklungsaufgaben betrachtet?
Das Kapitel "Drogenkonsum als Risikoverhalten von Jugendlichen" untersucht die Funktionen des Drogenkonsums im Kontext von Entwicklungsaufgaben. Es definiert den Begriff "Droge", differenziert zwischen legalem und illegalem Konsum und beleuchtet Risikofaktoren und Erklärungsmodelle (Sensation Seeking, Milieus und Lebensstile). Der biografische Verlauf des Drogenkonsums wird ebenfalls behandelt.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Der Drogenkonsum junger Erwachsener aus biografischer Perspektive, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129962