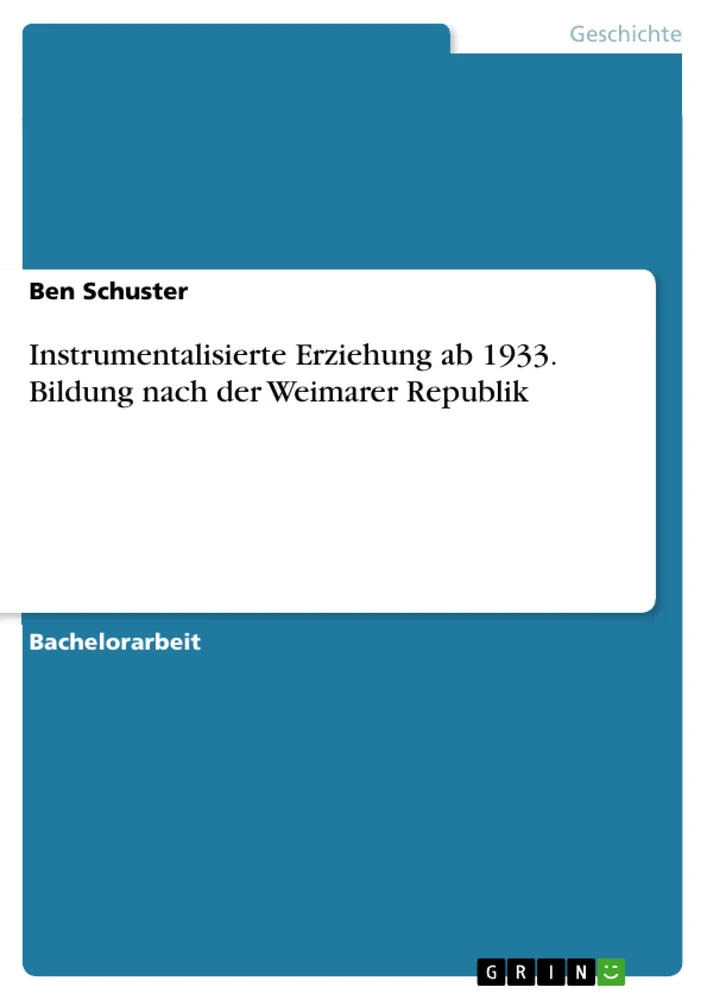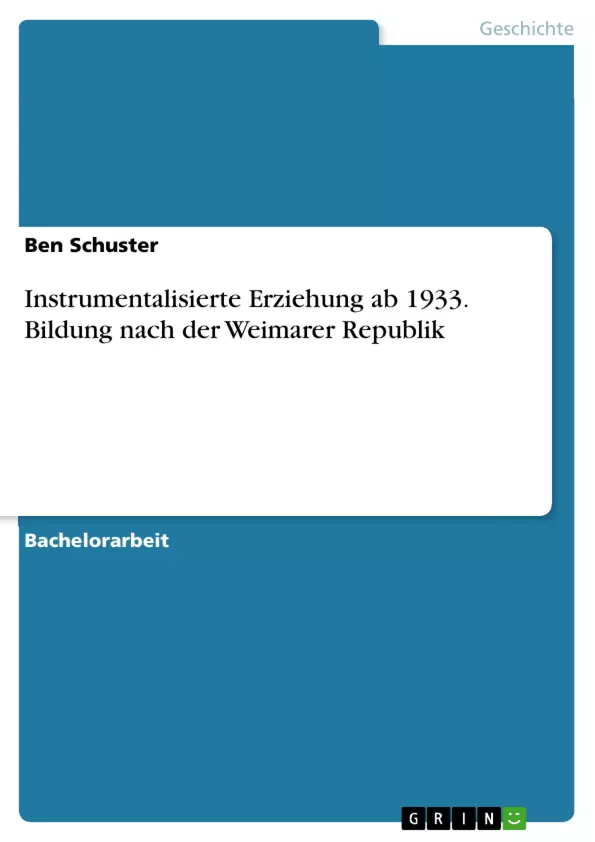Kinder waren immer ein Angriffsziel für Manipulationen und der ideologischen Beeinflussung für politische Zwecke unterworfen. Ab 1933 wurde die Volksschule beispielsweise als Instanz der Ideologievermittlung genutzt. "Die Volksschule hat nicht die Aufgabe, vielerlei Kenntnisse zum Nutzen des Einzelnen zu vermitteln. Sie hat alle Kräfte der Jugend für den Dienst an Volk und Staat zu entwickeln und nutzbar zu machen".
Im Alltag der Schulkinder war die Schule der Bereich, in dem sie am meisten geprägt wurden. In dieser Arbeit steht vor allem das Geflecht aus Kontinuität und Brüchen im Schulalltag im Fokus. In einer Gesellschaft finden ständig Wandlungsprozesse statt, ohne dass sie Brüche mit den vorangegangenen Entwicklungen darstellen. Die Arbeit handelt von dem Leben in der Volksschule. Dabei steht die erste bis vierte Klasse im Mittelpunkt. Der Fokus liegt auf dem Erlass über die Einführung der Richtlinien für die unteren Jahrgänge der Volksschule von 1937, da dort eine entscheidende Schnittstelle im Erziehungssystem im Nationalsozialismus statt-fand. Diese Richtlinien werden mit den preußischen Richtlinien in einem separaten Kapitel verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematischer Ausblick
- DDS Die Deutsche Schule
- Forschungsstand
- Hauptteil
- Weimarer Grundschullehrplan 1926 im Abgleich mit dem Reichserlass von 1937
- Diskussion des Erlasses von 1937 am Exempel der Zeitung Deutsche Schule
- Erziehung
- Judenfrage
- Heimatkunde
- Sprachen
- Rechnen
- Sport
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel des deutschen Erziehungssystems im Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus. Im Fokus steht dabei die Einführung der Richtlinien für die unteren Jahrgänge der Volksschule im Jahr 1937, welche eine entscheidende Schnittstelle im Erziehungssystem des Nationalsozialismus darstellten. Die Arbeit betrachtet, wie die Richtlinien den Lehrplan und die Erziehungspraxis in der Volksschule beeinflussten und wie die Ideologie des Nationalsozialismus in den Schulalltag integriert wurde.
- Kontinuität und Brüche im Schulalltag während der NS-Zeit
- Einfluss der NS-Ideologie auf die Lehrpläne und die Erziehung
- Vergleich der Weimarer Lehrpläne mit den Richtlinien von 1937
- Die Rolle der „Deutschen Schule“ als Medium der Ideologievermittlung
- Die Auswirkungen der NS-Schulpolitik auf das Leben der Schulkinder
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt den historischen Kontext dar, in dem die NS-Schulpolitik entstand. Es wird der Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus und die Bedeutung der Schule als Instrument der Ideologievermittlung beleuchtet. Die Arbeit stellt die zentrale Leitfrage nach dem Wandel des deutschen Erziehungssystems ab 1933 dar.
- Hauptteil: Dieses Kapitel vergleicht die Weimarer Grundschullehrpläne von 1926 mit dem Reichserlass von 1937. Es wird untersucht, wie die NS-Ideologie in die Lehrpläne und die Erziehungspraxis integriert wurde. Der Erlass wird anhand von Artikeln aus der Zeitschrift „Deutsche Schule“ analysiert, um die Umsetzung der NS-Ideologie in der Volksschule zu beleuchten.
- Fazit: Dieses Kapitel wird die Ergebnisse der Arbeit zusammenfassen und Schlussfolgerungen ziehen. Es wird die Bedeutung des Wandels des deutschen Erziehungssystems im Nationalsozialismus und die Folgen für die Schulkinder beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Instrumentalisierte Erziehung, NS-Schulpolitik, Volksschule, Weimarer Republik, Reichserlass von 1937, Deutsche Schule, Ideologievermittlung, Lehrplan, Erziehungspraxis, NS-Ideologie, Kinderalltag und Judenfrage. Die Arbeit verwendet Quellen wie die „Deutsche Schule“, Lehrpläne und Erlasse, um den Wandel des deutschen Erziehungssystems ab 1933 zu beleuchten.
- Citation du texte
- Ben Schuster (Auteur), 2021, Instrumentalisierte Erziehung ab 1933. Bildung nach der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1130557