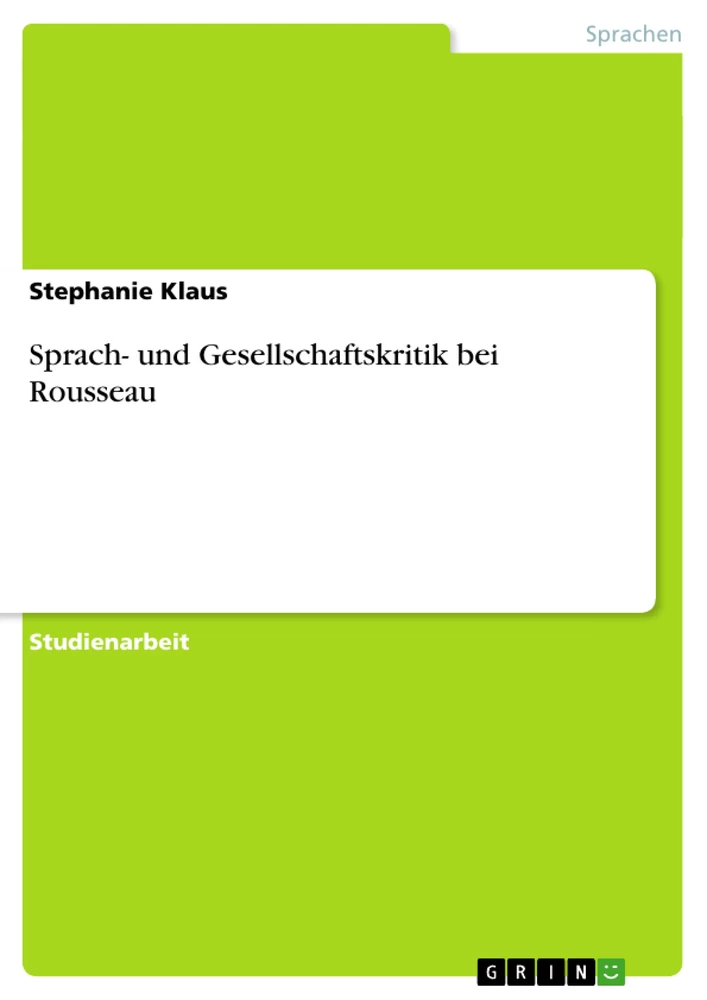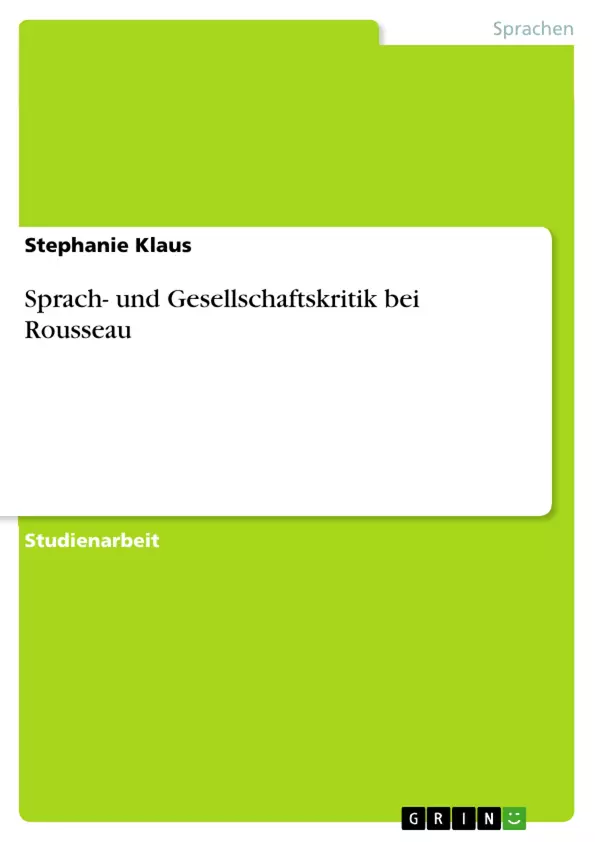Eine philosophische Untersuchung des Phänomens Sprache hat es im
westeuropäischen Raum seit der Antike immer wieder gegeben. Das Element der
Sprachkritk, also der Hinterfragung von Ursprung, Funktion und Objektivität, kommt
aber erst in der Neuzeit auf. Die Sprache mit einer Kritik der Gesellschaft und ihrer
Institutionen zu verbinden, ist schließlich ein Betätigungsfeld der Aufklärung. „Du
Marsais, Voltaire, Condillac, Rousseau, Helvétius, Turgot haben in Stellungnahmen
zu Problemen der Sprache ihre Position als Aufklärer vertreten“1. Aufgabe dieser
Arbeit wird es nun sein, den Begriff „Sprachkritik“ in der Aufklärung zu umreißen,
um anschließend die Anthropologie Jean-Jacques Rousseaus in bezug auf Sprache
und Gesellschaftskritik zu untersuchen und Rousseaus Thesen vom Zusammenhang
von Sprache und Macht herauszuarbeiten. Die Hauptgrundlage wird der „Discours
sur l`origine de l`inégalité parmi les Hommes“ sein, in dem Rousseau auf provokante
Art und Weise die Zusammenhänge von Sprache und Gesellschaft darstellt. Um
seine Position verdeutlichen zu können, müssen zuvor einige Namen bedeutender
Denker der Zeit genannt werden und ihre Thesen in Grundzügen skizziert werden.
1 Ricken: U.u.a., 1990, S.66
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachkritik in der Aufklärung
- Ursprung und sprachkritische Ansatzpunkte
- Willkürlicher Mißbrauch von Sprache als Ansatz zur Gesellschaftskritik
- Sprache und Gesellschaftskritik bei Rousseau im „Discours sur l`inégalité“
- Der „,Discours“ als sprach- und gesellschaftskritischer Essai
- Der Zusammenhang von Sprache und Ungleichheit
- Sprache als Gesellschaftskritik
- Schluẞ
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprachkritik in der Aufklärung und analysiert die Anthropologie Jean-Jacques Rousseaus im Hinblick auf Sprache und Gesellschaftskritik. Der Fokus liegt dabei auf Rousseaus „Discours sur l'origine de l`inégalité parmi les Hommes“, in dem er den Zusammenhang zwischen Sprache und Macht beleuchtet.
- Sprachkritik in der Aufklärung
- Rousseaus Theorie des Zusammenhangs von Sprache und Ungleichheit
- Rousseaus Gesellschaftskritik im „Discours sur l'origine de l`inégalité parmi les Hommes“
- Sprache als Mittel der Machtausübung
- Die Rolle der „raison“ und der „sensation“ in der Sprachkritik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Sprachkritik in der Aufklärung ein und erläutert die Relevanz von Rousseaus „Discours sur l'origine de l`inégalité parmi les Hommes“ für die Untersuchung des Zusammenhangs von Sprache und Macht.
Sprachkritik in der Aufklärung
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Sprachkritik“ und beleuchtet seine Ursprünge in der Philosophie des 17. Jahrhunderts. Es werden die Ansätze von Francis Bacon und John Locke sowie die Auseinandersetzungen um eine mögliche Kodifizierung der Sprache in der Aufklärung diskutiert.
Sprache und Gesellschaftskritik bei Rousseau im „Discours sur l`inégalité“
Dieses Kapitel analysiert Rousseaus „Discours“ und beleuchtet die enge Verbindung zwischen Sprache und Ungleichheit in Rousseaus Theorie. Es werden Rousseaus Argumente für die Rolle der Sprache als Mittel der Gesellschaftskritik und Machtausübung aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Sprachkritik, Aufklärung, Rousseau, „Discours sur l'origine de l`inégalité parmi les Hommes“, Sprache, Gesellschaftskritik, Ungleichheit, Macht, „raison“, „sensation“, Enzyklopädisten, Diderot, d`Alembert, Locke, Bacon, Montesquieu, Helvétius.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Schwerpunkt von Rousseaus Sprachkritik?
Rousseau untersucht den Zusammenhang zwischen Sprache, Gesellschaft und Macht. Er kritisiert, wie Sprache zur Etablierung von Ungleichheit beigetragen hat.
Welches Werk Rousseaus ist für diese Analyse zentral?
Die Hauptgrundlage bildet der „Discours sur l'origine de l’inégalité parmi les Hommes“ (Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen).
Wie definiert sich Sprachkritik in der Epoche der Aufklärung?
Sprachkritik in der Aufklärung bedeutet die Hinterfragung des Ursprungs, der Funktion und der Objektivität von Sprache sowie die Kritik an deren willkürlichem Missbrauch.
Welche anderen Denker beeinflussten die Sprachdiskussion der Zeit?
Bedeutende Einflüsse kamen von Francis Bacon, John Locke, Voltaire, Condillac und den Enzyklopädisten wie Diderot.
Inwiefern dient Sprache laut Rousseau als Mittel der Machtausübung?
Rousseau argumentiert, dass die Entwicklung der Sprache eng mit der gesellschaftlichen Organisation verknüpft ist und zur Festigung von Machtstrukturen und sozialer Ungleichheit genutzt wird.
- Quote paper
- Stephanie Klaus (Author), 1993, Sprach- und Gesellschaftskritik bei Rousseau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11308