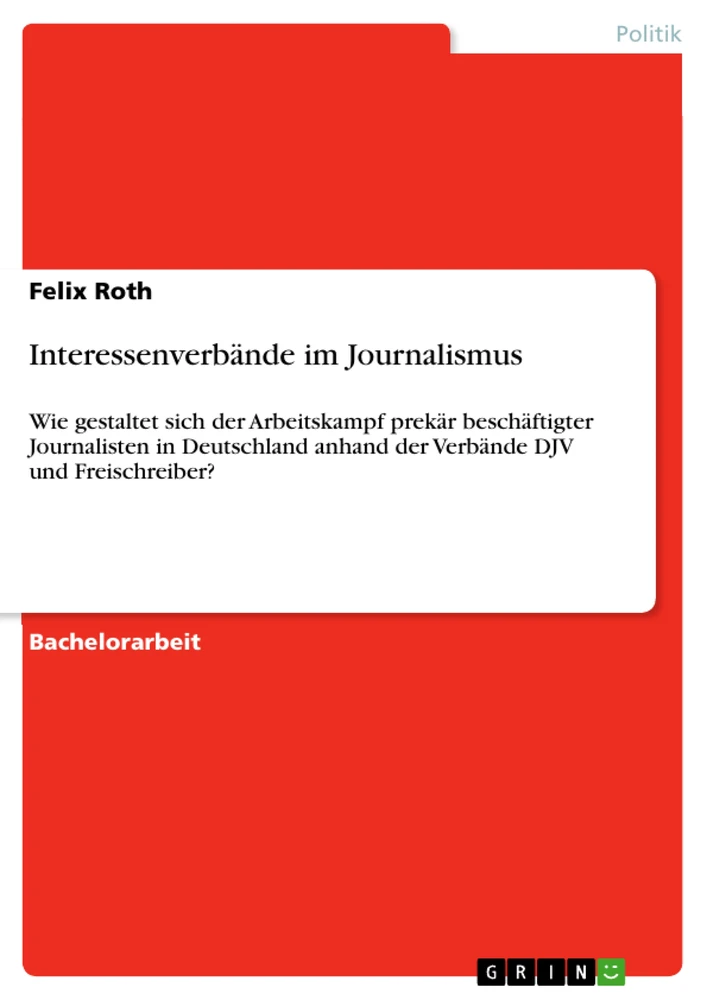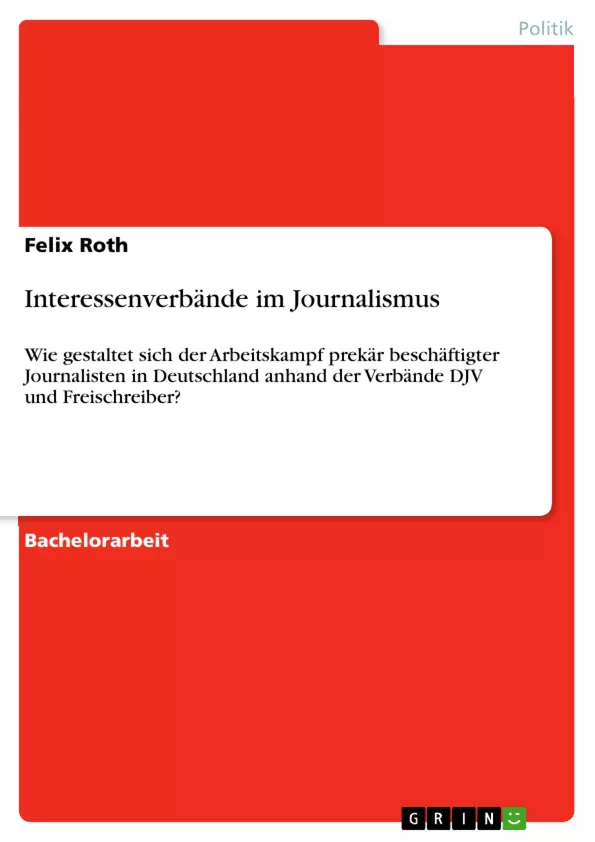Die vorliegende Arbeit soll darstellen, mit welchen Ressourcen Journalisten sich in Interessenverbänden organisieren, um gegen die Problemfelder prekärer Beschäftigung in ihrer Arbeitswelt vorzugehen. Dafür kommt es im Hauptteil der Arbeit zu einem Vergleich der Interessenverbände Freischreiber und DJV, die sich in Alter, Mitgliederanzahl und der Berufsgruppe innerhalb des Journalismus unterscheiden. Der Deutsche Journalisten-Verband, kurz DJV, vertritt die Interessen aller hauptberuflichen Journalisten, während der Verband Freischreiber ausschließlich die Interessen von freiberuflichen Journalisten vertritt. Anhand beider Verbände wird der Forschungsfrage nachgegangen, welche Handlungsstrategien sie hinsichtlich ihrer politischen Einflussnahme zur Veränderung der Arbeitsbedingungen, aber auch innerhalb der Verbände bezüglich der Mitgliederrekrutierung und -mobilisierung verfolgen. Mit der Deskription der Ressourcen beider Verbände im Vergleich wird nach Mancur Olsons Mitgliedschaftslogik den Fragen nachgegangen, welche Mitgliedschaftsanreize die Verbände ihren Mitgliedern bieten, ob ein Verband, der seinen Mitgliedern selektive Anreize bietet, mehr Mitglieder wirbt, oder ob es sich bei den Interessen freier Journalisten um sogenannte schwache Interessen einer randständigen Gruppe handelt. Neben der mitgliedschaftslogischen Ausrichtung der Verbände werden zudem auch Faktoren nach der Einflusslogik untersucht. Dabei wird die Interessenartikulationsfunktion der Verbände beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Forschungsstand und Quellenlage
- Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen
- Aufbau der Arbeit
- Problemfelder und Formen prekärer Arbeit unter Journalisten
- Journalisten in Deutschland
- Einkommen
- Rechtliche Absicherung
- Arbeitsverträge
- Freiberufliche Arbeit
- Verbände und ihre Funktionen im politischen System
- Theoretische Einordnung und Handlungslogiken
- Mitgliedschaftslogik
- Einflusslogik
- Trittbrettfahrerphänomen
- Selektive Anreize
- Schwache Interessen randständiger Gruppen
- Fallauswahl
- Vergleich
- Organisationsstruktur
- Finanzierung
- Organisationsgrad
- Mobilisierung und Mitgliedschaftsanreize
- Immaterielle Anreize
- Materielle Anreize
- Erwartungen der Mitglieder an die Verbände
- Konträre Interessenlagen innerhalb der Verbände
- Partizipation
- Verbandsinterne Kommunikationsmittel
- Verbandsexterne Kommunikationsmittel und Handlungsstrategien
- Ziele und Forderungen der Verbände
- Kampagnen
- Freie Journalisten als randständige Gruppe?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Arbeitskämpfe von prekär beschäftigten Journalisten in Deutschland anhand der Verbände DJV und Freischreiber. Sie zielt darauf ab, die Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten im Kontext der prekären Arbeitsbedingungen zu beleuchten.
- Prekäre Arbeitsbedingungen im Journalismus
- Rolle von Interessenverbänden im Arbeitskampf
- Vergleichende Analyse von DJV und Freischreiber
- Anreize und Strategien zur Mitgliedergewinnung
- Ziele und Forderungen der Verbände im Kampf gegen prekäre Beschäftigung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Problemstellung, den Forschungsstand und das Erkenntnisinteresse. Das zweite Kapitel widmet sich den Problemfeldern und Formen prekärer Arbeit im Journalismus. Das dritte Kapitel behandelt die Verbände und ihre Funktionen im politischen System. Das vierte Kapitel analysiert die Organisationsstruktur, die Finanzierung und die Mobilisierung der Verbände.
Schlüsselwörter
Prekäre Arbeit, Journalismus, Interessenverbände, DJV, Freischreiber, Mitgliedergewinnung, Arbeitskampf, Tarifverträge, Medienproduktion, Hybridisierung, Boulevardization.
- Citation du texte
- Felix Roth (Auteur), 2020, Interessenverbände im Journalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1130861