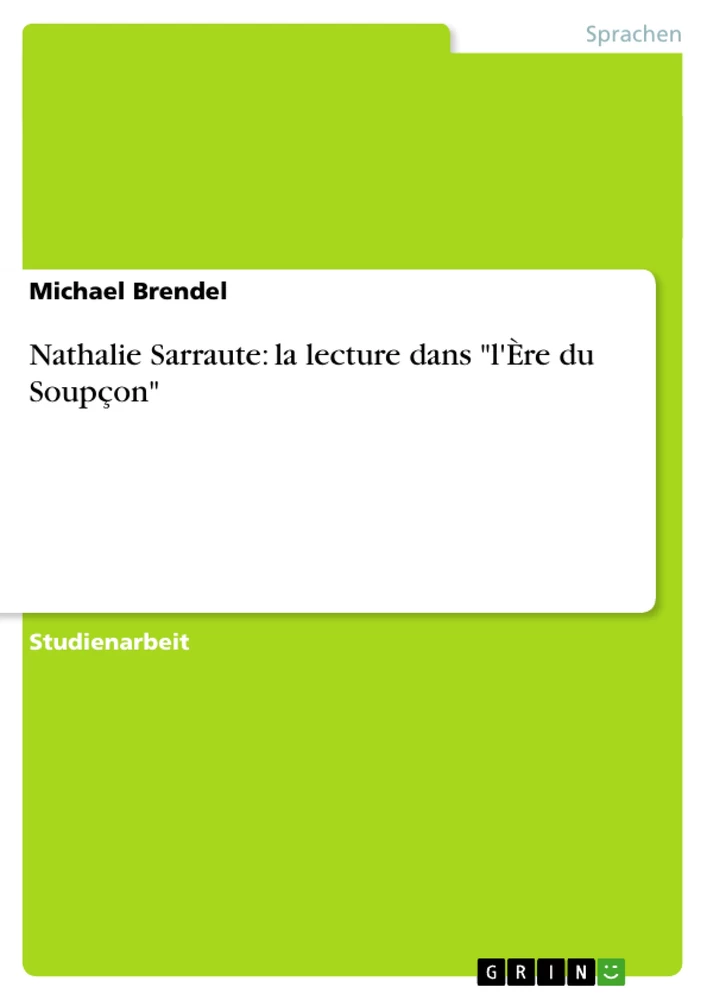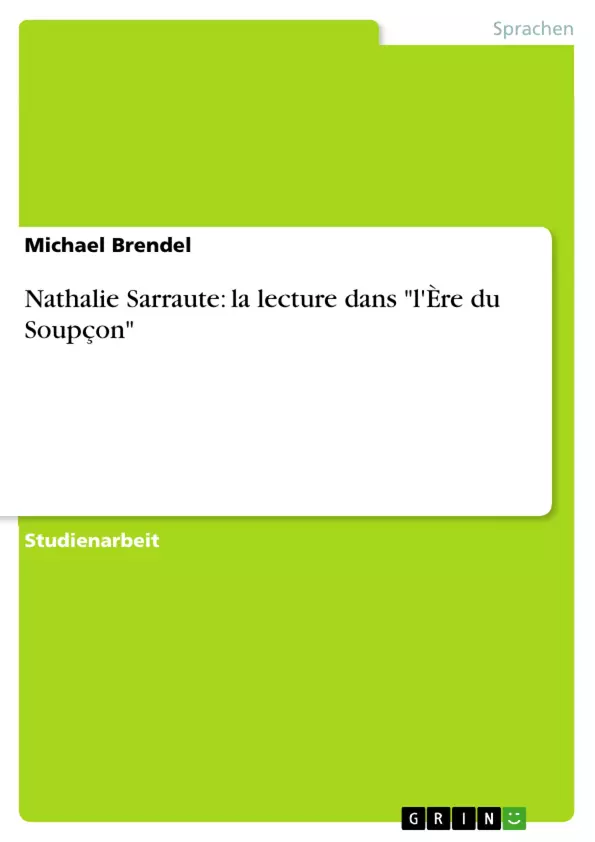Im Rahmen des Proseminars „Pratiques de lecture – entre dangers et compétences réceptives“ haben wir uns mit verschiedenen Lektürepraktiken bzw. Leserhaltungen auseinandergesetzt. Eine Literaturtheoretikerin, die in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle spielt, ist die russischstämmige Französin Nathalie Sarraute (1900-1999), die neben ihren literaturtheoretischen Schriften auch zahlreiche Romane, wie z.B. Les Fruits d’or (1963) oder Entre la vie et la mort (1968), veröffentlichte. Eines ihrer bedeutendsten theoretischen Werke, das 1956 bei Gallimard erschien und Aufschluss über ihre literarische Ästhetik gibt, ist eine Essaysammlung, die den gleichen Titel trägt wie der zweite Aufsatz dieses Sammelbandes, nämlich „l’Ère du soupçon“. Dieser Essay wird im Allgemeinen als erstes Manifest des nouveau roman betrachtet und behandelt den Schlüsselbegriff ihres Werkes, den soupçon. Unter dem soupçon versteht Sarraute ein poetologisches Misstrauen, dessen Anfänge sich bereits in der Literatur des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts manifestieren. Ausgehend von den Formen des traditionellen Romans und dessen Leserschaft soll auf den folgenden Seiten erörtert werden, was genau Sarraute unter dem Terminus soupçon versteht und inwiefern dieses Misstrauen die Haltung des Lesers bzw. seine Lektürepraktiken verändert. Außerdem soll gezeigt werden, wie der Romanautor auf die veränderte Leserhaltung im Zeitalter des Misstrauens bzw. des Argwohns reagiert und dadurch beginnt, eine neue Art des Romans, sprich, einen nouveau roman zu schaffen. Zum Abschluss soll dann noch darauf eingegangen werden, was Sarraute unter dem Begriff der „Tropismen“ – einem weiteren Schlüsselbegriff ihres Werks – versteht und welche Techniken des nouveau roman sie benutzt, um diese dem Leser zugänglich zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Der roman traditionnel
- Die Lektüre im Zeitalter des Argwohns
- Der Schriftsteller im Zeitalter des Argwohns
- Konsequenzen für den Roman und die Figur
- Der Begriff der Tropismen
- Conversation und Sous-Conversation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert die literaturtheoretischen Ansätze der Schriftstellerin Nathalie Sarraute und beleuchtet insbesondere ihren Schlüsselbegriff „Soupçon“ (Argwohn) im Kontext der literarischen Entwicklung des Romans. Der Text verfolgt das Ziel, die veränderte Leserhaltung im Zeitalter des Argwohns und deren Einfluss auf den modernen Roman aufzuzeigen.
- Der „Soupçon“ als Misstrauen des aufgeklärten Lesers gegenüber der Fiction
- Die Veränderung der Leserhaltung im Zeitalter des Argwohns
- Die Reaktion des Romanautors auf die veränderte Leserhaltung
- Die Entstehung des „Nouveau Roman“ als Reaktion auf den „Roman Traditionnel“
- Der Einfluss der literarischen Tradition auf die moderne Romanästhetik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Nathalie Sarraute als bedeutende Literaturtheoretikerin und Romanautorin vor und führt den Begriff „Soupçon“ als zentralen Aspekt ihrer literarischen Ästhetik ein. Die Einleitung beleuchtet die Entstehung des „Soupçon“ in der Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts und stellt die Frage, wie dieses Misstrauen die Haltung des Lesers und seine Lektürepraktiken verändert.
Der roman traditionnel
In diesem Kapitel definiert die Autorin den „Roman Traditionnel“ als ein Genre, in dem Personen leben und handeln, und beleuchtet die Erwartungen des Lesers an die Figuren und Handlungsstrukturen. Es wird deutlich, dass der „Roman Traditionnel“ auf einer klaren Trennung zwischen Fiktion und Realität basiert und den Leser zu einer naiven Annahme der fiktiven Welt verleitet.
Die Lektüre im Zeitalter des Argwohns
Dieses Kapitel beschreibt die veränderte Leserhaltung im Zeitalter des Argwohns. Der Leser, der mit modernen Denkern und Schreibtechniken vertraut ist, entwickelt ein kritisches Bewusstsein und stellt die Glaubwürdigkeit des traditionellen Romans in Frage. Der „Soupçon“ richtet sich dabei sowohl gegen den Autor als auch gegen die Figuren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: „Soupçon“ (Argwohn), „Nouveau Roman“, „Roman Traditionnel“, „Lecteur Compétent“, „Tropismen“, „Conversation“, „Sous-Conversation“, „Nathalie Sarraute“, „Lektürepraktiken“, „Literaturtheorie“, „Moderne Romanästhetik“
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Nathalie Sarraute unter dem Begriff „Soupçon“?
Der „Soupçon“ (Argwohn) beschreibt ein poetologisches Misstrauen des modernen Lesers und Autors gegenüber den traditionellen Elementen des Romans, wie festen Charakteren und Handlung.
Was ist das Hauptmerkmal des „Nouveau Roman“?
Der Nouveau Roman bricht mit den Konventionen des traditionellen Romans (Roman Traditionnel) und konzentriert sich stattdessen auf psychologische Unterströme und sprachliche Experimente.
Was sind „Tropismen“?
Tropismen sind bei Sarraute flüchtige, instinktive psychische Bewegungen unter der Oberfläche der bewussten Rede, die das menschliche Verhalten steuern.
Wie verändert der „Argwohn“ die Haltung des Lesers?
Der Leser ist nicht mehr bereit, fiktive Figuren als reale Personen zu akzeptieren; er wird kritischer und achtet stärker auf die Konstruktion des Textes.
Was bedeutet „Sous-Conversation“?
Es bezeichnet die Ebene unterhalb des eigentlichen Gesprächs, in der sich die wahren Gefühle und Spannungen (Tropismen) abspielen.
Welchen Einfluss hat die literarische Tradition auf Sarrautes Ästhetik?
Sarraute sieht ihre Arbeit als notwendige Weiterentwicklung, da die alten Formen des 19. Jahrhunderts der Komplexität des modernen Bewusstseins nicht mehr gerecht werden.
- Arbeit zitieren
- Michael Brendel (Autor:in), 2007, Nathalie Sarraute: la lecture dans "l'Ère du Soupçon", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113093