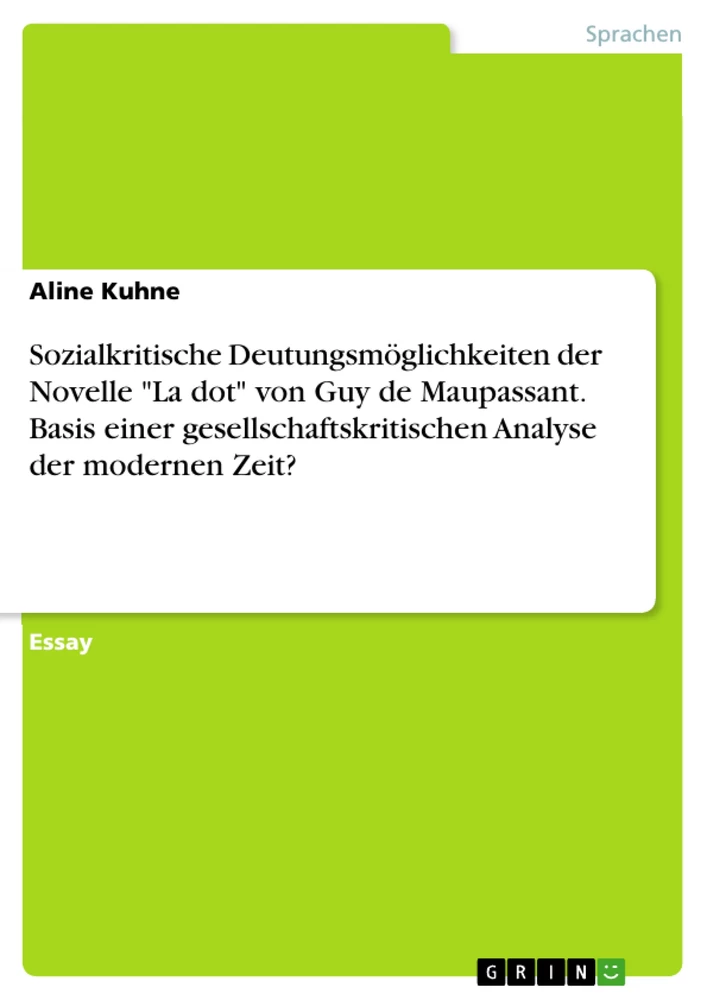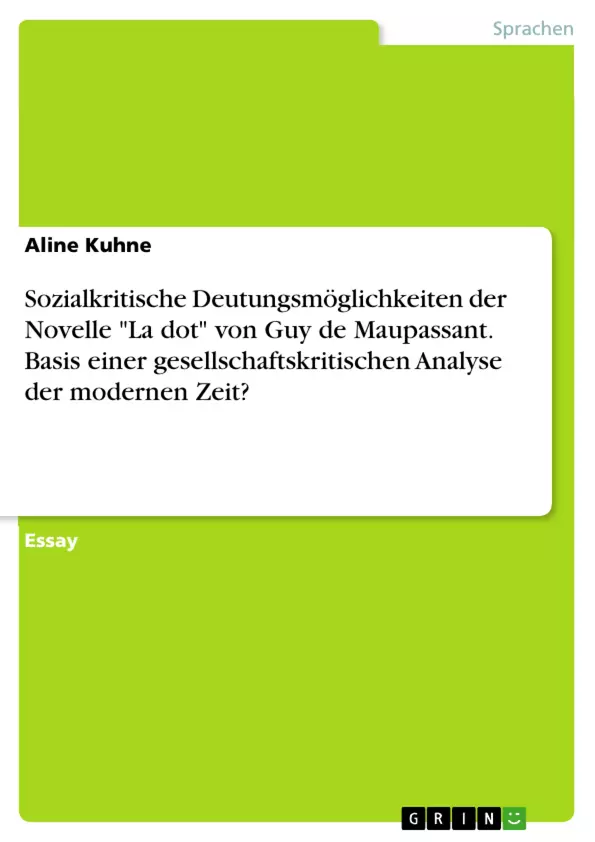In der folgenden narrativen Analyse wird erörtert, inwiefern Guy de Maupassant durch sein Werk Komik entfaltet und im weiteren Sinne auch Kritik an den menschlichen Fehlern und Schwächen der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts übt. Des Weiteren wird analysiert, ob seine Kritik auch auf die heutige Gesellschaft übertragbar ist.
Die Novelle "La dot" von Guy de Maupassant wurde erstmals im September 1884 veröffentlicht und erzählt die Geschichte eines frischverheirateten Paares. Voller Hoffnung auf eine glückliche Ehe wird die junge Frau bereits auf der Hochzeitsreise von ihrem Ehemann verlassen, da er es nur auf ihre Mitgift abgesehen hatte.
Inhaltsverzeichnis
- Analyse der Novelle „La dot“ von Guy de Maupassant
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Hauptzweck dieser Arbeit ist die Analyse der Novelle „La dot“ von Guy de Maupassant. Die Arbeit zielt darauf ab, die Komik in Maupassants Werk zu untersuchen und seine Kritik an menschlichen Fehlern und Schwächen der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu beleuchten. Außerdem wird analysiert, ob diese Kritik auch auf die heutige Gesellschaft übertragbar ist.
- Die Rolle der Mitgift als zentrales Thema
- Kritik an Selbstsucht und Skrupellosigkeit
- Die Darstellung von Geldgier und Habsucht
- Die Analyse der Erzählperspektive und -struktur
- Die Darstellung von Milieu und Atmosphäre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Novelle „La dot“ erzählt die Geschichte eines frischverheirateten Paares. Die junge Frau wird bereits auf der Hochzeitsreise von ihrem Ehemann verlassen, da dieser nur an ihrer Mitgift interessiert ist. Der Ehemann, Simon Lebrument, wird als Beispiel für Geldgier und Habsucht in einer materialistischen Gesellschaft dargestellt.
Die Geschichte spielt in Paris und zeichnet die verschiedenen Bevölkerungsschichten der Stadt nach. Guy de Maupassant nutzt narrative Methoden, um die Atmosphäre und das Milieu der Novelle zu beschreiben. Die Protagonisten, Simon Lebrument und Jeanne, werden als gegensätzliche Charaktere dargestellt, die jeweils durch ihre unterschiedlichen Werte und Beweggründe gekennzeichnet sind.
Schlüsselwörter
Die Novelle „La dot“ thematisiert die Kritik an der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, insbesondere an den Themen Geldgier, Habsucht, Selbstsucht und Skrupellosigkeit. Weitere wichtige Aspekte sind die Analyse der Erzählperspektive und -struktur, die Darstellung von Milieu und Atmosphäre sowie die Rolle der Mitgift in der damaligen Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Aline Kuhne (Autor:in), 2021, Sozialkritische Deutungsmöglichkeiten der Novelle "La dot" von Guy de Maupassant. Basis einer gesellschaftskritischen Analyse der modernen Zeit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1131073