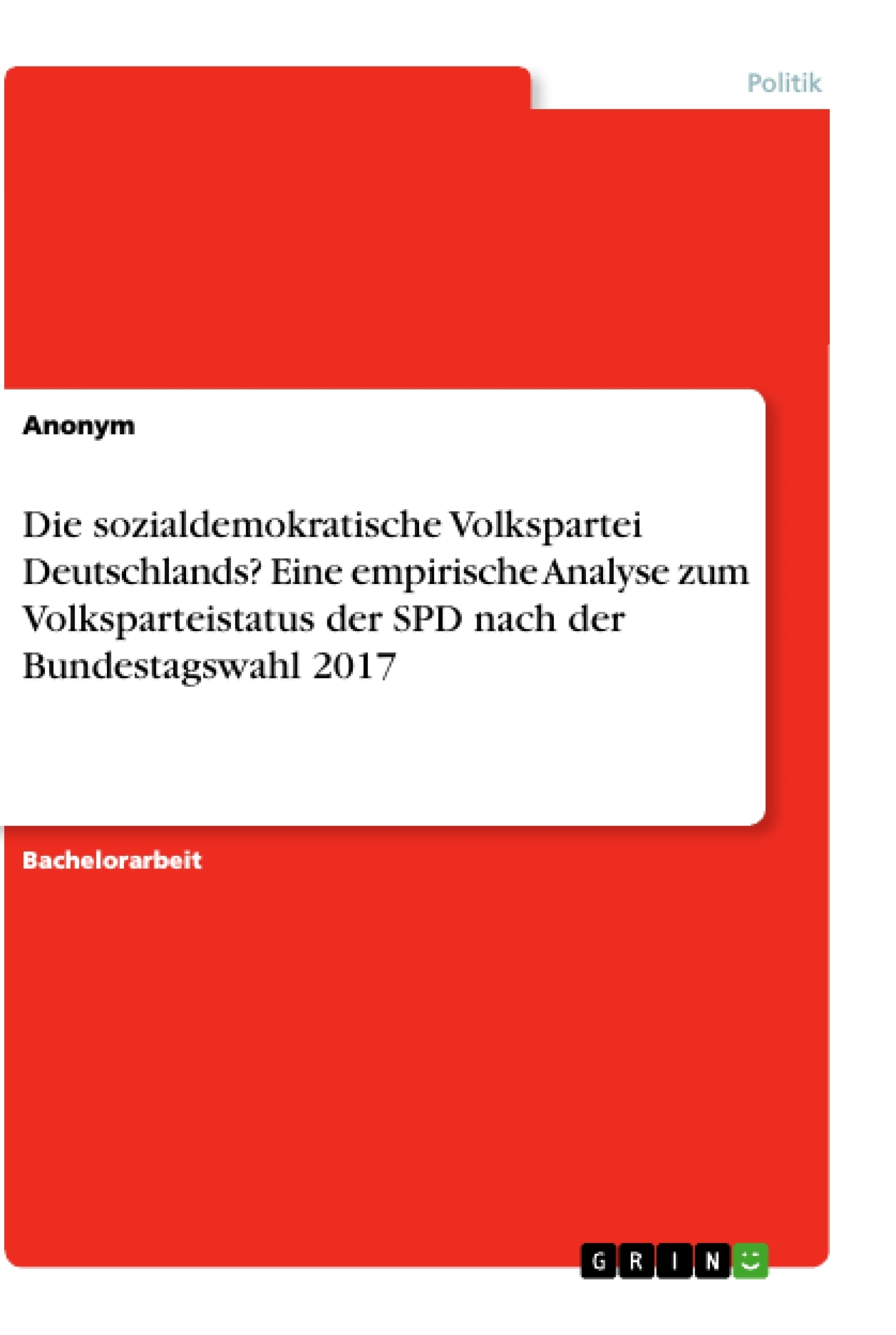Um zunächst aus wissenschaftlicher Sicht definieren zu können, welche Merkmale eine Volkspartei aufweisen muss, wird nach der Vorstellung des Forschungsstandes zur Thematik die Volksparteitypologie nach Otto Kirchheimer erläutert, welche als die grundlegende Arbeit zu Volksparteien gilt und den Begriff in der Mitte der 1960er Jahre in die Politikwissenschaft einführte. Darauf folgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept und eine Darstellung der Typologie nach Peter Lösche, der bestimmte Punkte Kirchheimers diskutierte und eine Erweiterung des Volksparteikonzepts erarbeitete. Aus dieser Diskussion wird dann die für diese Arbeit grundlegende Definition einer Volkspartei erarbeitet.
Darauf folgt die Beantwortung der Frage, ob die SPD als geeigneter Forschungsgegenstand fungieren kann sowie die Aufstellung der nötigen Hypothesen. Kapitel fünf dient der Erläuterung der empirischen Methodik und der genutzten Datengrundlagen. Dabei ist hervorzuheben, dass aufgrund der Verfügbarkeit von Daten der Volksparteistatus der SPD für den Zeitpunkt nach der Bundestagswahl 2017 analysiert wird. Ziel der Arbeit ist es also letztlich, den Volksparteistatus der SPD nach der Bundestagswahl 2017 durch eine empirische Analyse zu klären. Somit lautet die Forschungsfrage dieser Arbeit: „Kann die SPD nach der Bundestagswahl 2017 noch als Volkspartei definiert werden?“.
Volksparteien haben in der heutigen Zeit einen schweren Stand in der deutschen Politik und Bevölkerung. Während CDU/CSU und SPD als in der Politikwissenschaft stets anerkannte Volksparteien bis ins Jahre 2005 fast immer Zustimmungswerte erreicht haben, die über 35 Prozent lagen, zeigte sich ab der Bundestagswahl 2009 gerade bei der SPD ein stetiger Verlust des Elektorats. Zwischenzeitlich wurden Stimmen laut, die die SPD als „Volkspartei außer Dienst“ sehen, obwohl die älteste Partei Deutschlands derzeit in 11 von 16 Landtagen an der Regierung beteiligt ist und auch an den letzten beiden Bundesregierungen partizipierte. Interessant ist das Ergebnis einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahre 2020, in welcher den Befragten u.a. die Frage gestellt wurde, welche Parteien sie als Volksparteien sehen. 51 Prozent sagten dabei aus, dass sie die SPD immer noch als Volkspartei verstehen und das, obwohl die Partei im Elektorat stets Stimmen verliert. Es kommt unweigerlich die Frage auf, wie es um den Volksparteistatus der SPD steht. Genau dieser Frage soll hier nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Volksparteitypologien
- 3.1. Typologie nach Otto Kirchheimer – Die Catch-All-Party
- 3.2. Typologie nach Peter Lösche – lose verkoppelte Anarchie
- 4. Forschungsgegenstand und Hypothesen
- 4.1. Forschungsgegenstand
- 4.2. Hypothesen
- 5. Methodik und Daten
- 5.1. Soziale Heterogenität SPD-Wählende
- 5.2. Soziale Heterogenität der SPD-Mitglieder
- 5.3. Soziale Heterogenität der MdB der SPD-Fraktion
- 5.4. Stimmenmaximierung
- 5.5. Koalitions-und Kompromissfähigkeit
- 6. Analyse: Ist die SPD noch eine Volkspartei?
- 6.1. Soziale Heterogenität der SPD-Wählenden
- 6.2. Soziale Heterogenität der SPD-Mitglieder
- 6.3. Soziale Heterogenität der MdB der SPD-Fraktion
- 6.4. Stimmenmaximierung
- 6.5. Koalitions- und Kompromissfähigkeit
- 7. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Volksparteistatus der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) im Anschluss an die Bundestagswahl 2017. Sie analysiert die soziale Heterogenität der SPD-Wählerschaft, der SPD-Mitglieder und der SPD-Bundestagsabgeordneten. Die Arbeit beleuchtet zudem die Fähigkeit der SPD, Stimmen zu maximieren und Koalitionen einzugehen.
- Soziale Heterogenität der SPD-Wählerschaft, der SPD-Mitglieder und der SPD-Bundestagsabgeordneten
- Stimmenmaximierungsfähigkeit der SPD
- Koalitions- und Kompromissfähigkeit der SPD
- Entwicklung des Volksparteistatus der SPD
- Anwendung verschiedener Volksparteitypologien auf die SPD
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Volksparteistatus der SPD ein und erläutert den Forschungsgegenstand und die Forschungsfrage der Arbeit. Kapitel zwei stellt den Forschungsstand zu Volksparteien vor. Kapitel drei analysiert die Volksparteitypologien nach Otto Kirchheimer und Peter Lösche. In Kapitel vier werden der Forschungsgegenstand präzisiert und die Hypothesen der Arbeit formuliert. Kapitel fünf erklärt die Methodik und die genutzten Daten. Die Analyse in Kapitel sechs untersucht die soziale Heterogenität der SPD-Wählerschaft, der SPD-Mitglieder und der SPD-Bundestagsabgeordneten sowie die Fähigkeit der SPD, Stimmen zu maximieren und Koalitionen einzugehen. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Volkspartei, SPD, Bundestagswahl 2017, Soziale Heterogenität, Stimmenmaximierung, Koalitionsfähigkeit, Catch-All-Party, lose verkoppelte Anarchie, Empirische Analyse.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Die sozialdemokratische Volkspartei Deutschlands? Eine empirische Analyse zum Volksparteistatus der SPD nach der Bundestagswahl 2017, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1131228