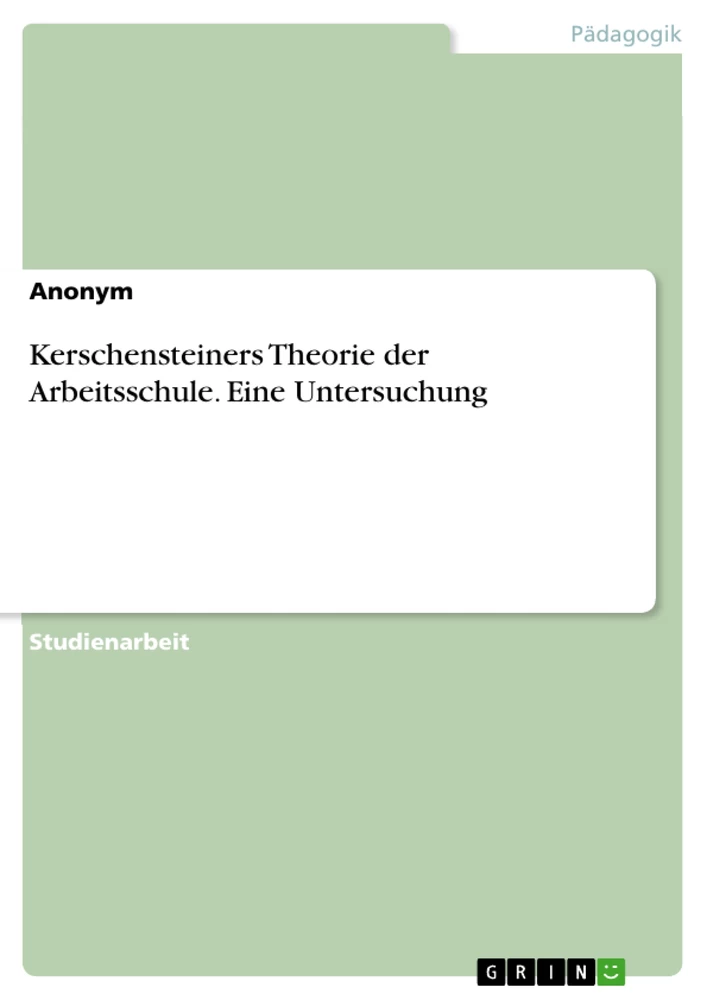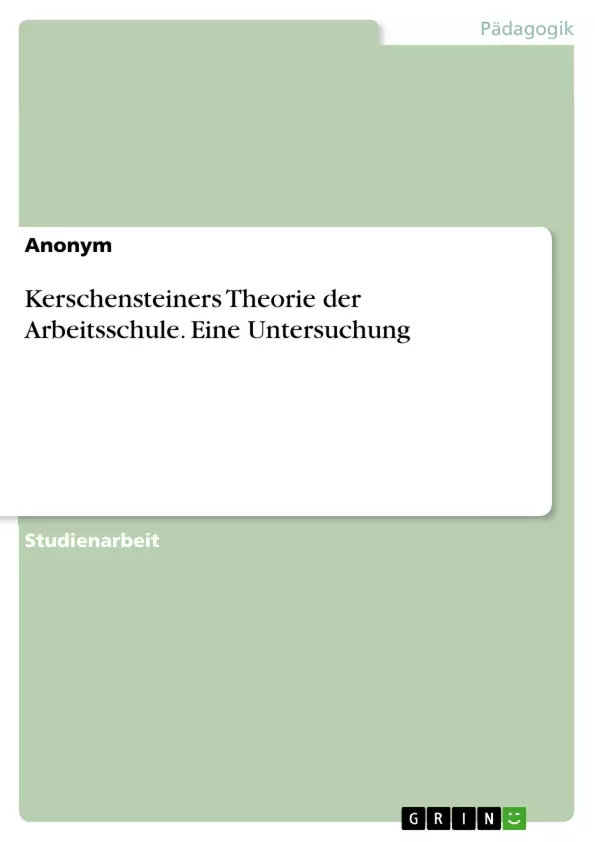Obwohl Georg Kerschensteiners theoretisches und praktisches Werk in der Literatur unterschiedliche Bewertungen erfährt, ist unbestritten, dass er in der Reformpädagogik - und dort in der Arbeitsschulbewegung eine zentrale Rolle einnimmt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Kerschensteiners Theorie der Arbeitsschule. Die Darstellung dieser Theorie wäre ein einfaches Unterfangen, hätte Kerschensteiner eines Tages ein für alle Zeiten feststehendes, vollendetes Gedankengebäude vorgelegt.
Deshalb werden die Merkmale der für Kerschensteiner ‘echten Arbeitsschule’ in der theoretischen Ausformung der Schrift "Begriff der Arbeitsschule" dargestellt. Dabei sollen exemplarisch verschiedene Einflussgrößen auf Kerschensteiners charakteristischen Arbeitsschulbegriff aufgezeigt werden. Im weiteren Verlauf wird zunächst Kerschensteiners Arbeitsschulgedanke im Strom der Reformpädagogik beleuchtet. Daran schließt sich seine Theorie der Arbeitsschule im Sinne des "Begriffs der Arbeitsschule"an, die zur spezifischen Organisation und methodischen Ausgestaltung von Kerschensteiners Arbeitsschule führt. Schließlich möchte die Autorin beispielhaft einige kritische Ansätze aus der Literatur anführen, um problematische Punkte in Kerschensteiners Theorie zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Kerschensteiner im Kontext der Reformpädagogik: Von der „Buchschule“ zur Arbeitsschule
- Kerschensteiners Theorie der Arbeitsschule
- Kerschensteiner und die staatsbürgerliche Erziehung
- Die drei Aufgaben der öffentlichen Schule
- Vorbereitung auf den Beruf
- Versittlichung der Berufsaufgabe
- Versittlichung des Gemeinwesens
- Die Schule als „Werkzeug der Charakterbildung“
- Schule als Werkzeug der Bildung
- Die Merkmale der „,echten\" Arbeitsschule
- Ansätze der Kritik
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Theorie der Arbeitsschule von Georg Kerschensteiner. Sie untersucht die zentralen Elemente seiner Theorie, die im Kontext der Reformpädagogik entstand, und beleuchtet die Entwicklung seiner Gedanken im Laufe der Zeit. Dabei werden exemplarisch Einflüsse auf Kerschensteiners charakteristischen Arbeitsschulbegriff herausgearbeitet.
- Kerschensteiners Theorie der Arbeitsschule im Kontext der Reformpädagogik
- Die wichtigsten Elemente von Kerschensteiners Arbeitsschulkonzept
- Der Einfluss von Kritik und Erfahrungen auf die Entwicklung von Kerschensteiners Theorie
- Die Kritik an Kerschensteiners Theorie der Arbeitsschule
- Der Stellenwert von Kerschensteiners Arbeitsschulkonzept in der Geschichte der Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Problemstellung der Arbeit, indem es auf die unterschiedlichen Bewertungen von Kerschensteiners Werk eingeht und den Fokus auf seine zentrale Rolle in der Reformpädagogik legt. Kerschensteiner selbst sah die Notwendigkeit, den Begriff der Arbeitsschule zu klären, da er im Laufe der Zeit zu Missverständnissen und Verirrungen führte. Der Autor erläutert die Entwicklung der Arbeitsschultheorie und zeigt die Herausforderungen auf, die mit einer umfassenden chronologischen Analyse verbunden sind.
Das zweite Kapitel beleuchtet Kerschensteiners Theorie der Arbeitsschule im Kontext der Reformpädagogik. Es stellt die Ziele der Reformpädagogik vor und beschreibt die Kritik an der „alten Schule“. Kerschensteiners Ansatz, die unterschiedlichen Begabungen von Schülern im Unterricht zu berücksichtigen, wird hier ebenfalls hervorgehoben. Das Kapitel vergleicht Kerschensteiners Arbeitsschulbewegung mit der Kunsterziehungsbewegung und verdeutlicht die Unterschiede zwischen diesen beiden Strömungen.
Schlüsselwörter
Georg Kerschensteiner, Arbeitsschule, Reformpädagogik, Staatsbürgerliche Erziehung, Buchschule, Charakterbildung, Bildung, Kritik, Theorie, Methode, Praxis, Schule, Unterricht, Schüler, Lehrer, Jugendpsychologie, Arbeit, Produktivität, Lebensform, Spiel, Lernen, Entwicklung, Begabung, Differenzierung, Individualisierung, Geschichte, Kontext, Einflüsse, Entwicklung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 1995, Kerschensteiners Theorie der Arbeitsschule. Eine Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1131304