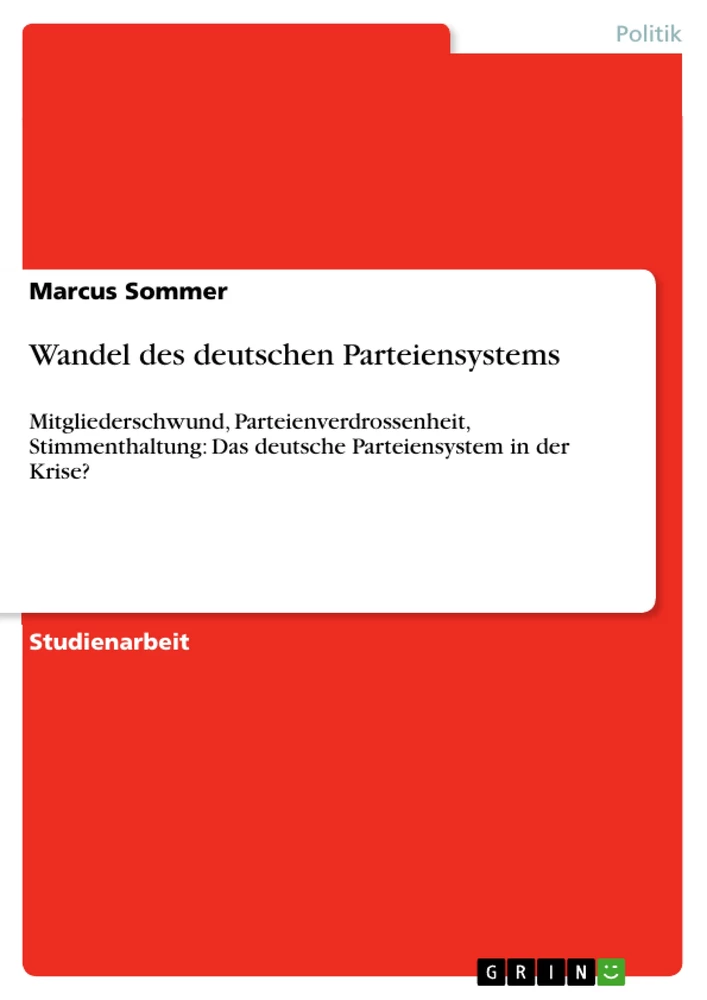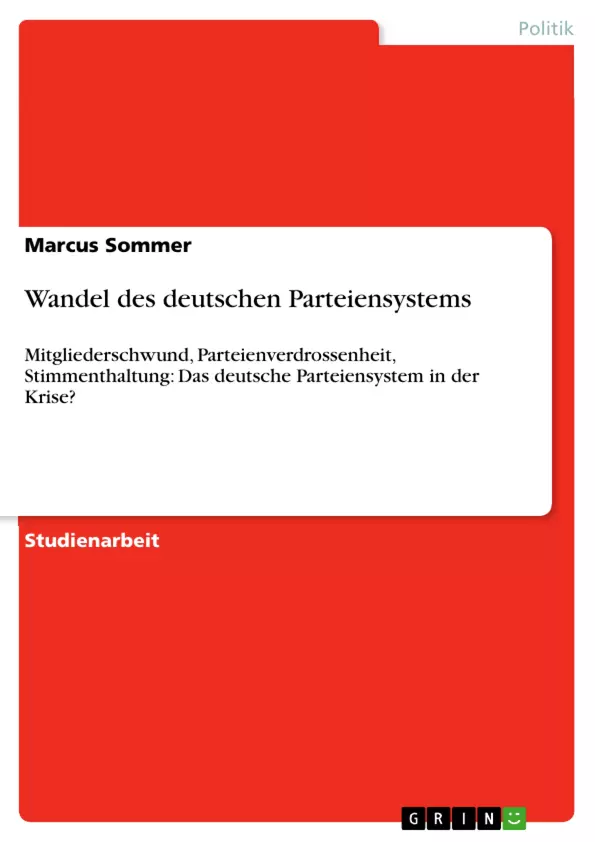Sie gilt als die ehrwürdige “alte Dame” des deutschen Parteiensystems. Doch derzeit nehmen die Altersbeschwerden rapide zu. Muskelschwäche, Vereinsamung, und Durchblutungsstörungen würde man bei einem alten Menschen diagnostizieren. Bei der SPD handelt es sich um Mitgliederschwund, abnehmende Parteibindung, zurückgehende Stimmanteile bei Wahlen.
Die älteste Partei Deutschlands hat ein Problem: Mit rund 540.000 Mitgliedern hat sie innerhalb von 18 Jahren knapp 400.000 Anhänger verloren – und verliert damit in absehbarer Zeit ihren Status als größte deutsche Volkspartei an die CDU. Dies konstatiert zumindest der Parteienforscher Niedermayer: „Wenn man den Mobilisierungsgrad insgesamt berechnet, liegt die CDU heute schon vorne“ (Niedermayer 2007a). Nur: Auch wenn die CDU damit die Rangliste anführen würde, die Krisenerscheinungen betreffen auch sie.
Nicht nur die Mitgliederzahlen schrumpfen kontinuierlich. Bei der Bundestagswahl 2005 ereignete sich eine Premiere. Die beiden Volksparteien konnten erstmalig in der bundesrepublikanischen Geschichte keine 70 Prozent der Wähler auf sich vereinigen – und das bei einer der niedrigsten Wahlbeteiligungen überhaupt (vgl. Jesse 2006a, S. 25).
Betrachtet man die Wahlbeteiligung bei weniger hochrangigen Wahlen, sieht das Bild sogar noch düsterer aus. Bei den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt 2007 beteiligten sich nur noch 36,5 Prozent der Menschen an der Stimmabgabe. Weniger Legitimation erhielten die Parteien noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik (vgl. Spiegel 2007a).
Hinter dem Wahlboykott steckt mehr. Die niedrige Wahlbeteiligung ist kein Zufall. Nach einer Forsa-Umfrage sind 60 Prozent der Deutschen mit der Arbeit der Parteien nicht zufrieden. Eine Mehrheit der Bevölkerung geht sogar noch weiter: 51 Prozent sind mit der Demokratie in der Bundesrepublik weniger oder gar nicht zufrieden (vgl. Spiegel 2007b).
Politikverdrossenheit, Mitgliederschwund, Stimmenthaltung. Es reihen sich die negativen Nachrichten über das deutsche Parteiensystem. Die Zahlen verbreiten Krisenstimmung. Zahlreiche Stimmen aus Politik, Publizistik und Wissenschaft verstärken diese. „Die Menschen wenden sich von der institutionalisierten Politik ab“, konstatiert Linkspartei-Landtagsfraktionschef von Sachsen-Anhalt Wulf Gallert. Der Parteienforscher Eckhard Jesse spricht von den „Volksparteien in der Krise“ (Jesse 2006b).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitorische Grundlagen
- Parteiensystem
- Parteien
- Krisenerscheinungen im Parteiensystem: Die Dramatisierung harmloser Symptome
- Zunehmende Stimmenthaltung bei Wahlen als Indikator für dramatischen Legitimationsverlust
- Sinkende Wahlbeteiligung und ein Anstieg der Nichtwähler
- Normalisierung der Wahlbeteiligung statt Dramatisierung
- Zunehmender Mitgliederschwund bei den Parteien
- Rekrutierungsschwierigkeiten der Parteien
- Mitgliederschwund kritisch betrachtet
- Nachlassende Bindungskraft der beiden Volksparteien
- Abnahme der Stammwähler führt zu einem Ansteigen der Volatilität
- Volatilität als Notwendigkeit für die Sinnhaftigkeit von Wahlen
- Konjunktur der Parteienverdrossenheit
- Vertrauensverlust in die Parteien als Gefahr für die Demokratie
- Gegenuntersuchungen nach Grothe
- Zunehmende Stimmenthaltung bei Wahlen als Indikator für dramatischen Legitimationsverlust
- Ursachen: Gesellschaftlicher Wandel führt in eine veränderte politische Kultur
- Sozioökonomische Veränderungen
- Pluralisierung, Wertewandel und Tendenz zur Erlebnisgesellschaft
- Rückgängige Wahlnorm und partizipatorische Revolutions-Tendenzen
- Von der Diskussion über den Niedergang des Parteiensystems zur These des Parteiensystemwandels
- Wandlungstendenzen
- Wandlungstendenzen auf der Ebene der Parteien
- Wandlungstendenzen auf der Ebene des Parteiensystems
- Bedingungen für Parteiensystemwandel
- Wandlungstendenzen im deutschen Parteiensystem
- Stabilität und Kontinuität als wesentliches Charakteristikum
- Konklusion: Wandel und Stabilität statt Krise und Niedergang
- Literaturnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob das deutsche Parteiensystem in einer Krise steckt oder ob es einen strukturellen Wandel durchlebt. Sie analysiert die viel zitierten Indikatoren für eine Krisenhaftigkeit des Parteiensystems, wie zunehmende Stimmenthaltung, Mitgliederschwund und Parteienverdrossenheit, und stellt ihnen die These nach einem Wandel der Parteien und des Parteiensystems gegenüber. Dabei werden ausgewählte Tendenzen und Ergebnisse aus anderen westeuropäischen Demokratien zur Erweiterung der Perspektive herangezogen.
- Analyse der Krisensymptome im deutschen Parteiensystem
- Begutachtung der These eines Parteiensystemwandels
- Vergleich mit Entwicklungen in anderen westeuropäischen Demokratien
- Bewertung der Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf das Parteiensystem
- Erörterung der Rolle der Parteien in der modernen Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des vermeintlichen Niedergangs des deutschen Parteiensystems dar, indem sie auf sinkende Mitgliederzahlen, Wahlbeteiligung und zunehmende Parteienverdrossenheit hinweist. Anschließend werden in Kapitel 2 die definitorischen Grundlagen von Parteien und Parteiensystemen erörtert. Kapitel 3 befasst sich mit den Krisensymptomen des Parteiensystems, unterteilt in die Themen Stimmenthaltung, Mitgliederschwund, abnehmende Bindungskraft der Volksparteien und zunehmende Parteienverdrossenheit. In Kapitel 4 werden mögliche Ursachen für die Krise diskutiert, darunter sozioökonomische Veränderungen, Pluralisierung und Wertewandel sowie eine Rückgängige Wahlnorm. Kapitel 5 fokussiert auf die These des Parteiensystemwandels und beschreibt entsprechende Wandlungstendenzen auf der Ebene der Parteien und des Parteiensystems. Schließlich wird in Kapitel 6 die Schlussfolgerung gezogen, dass das deutsche Parteiensystem eher einem Wandel als einem Niedergang unterliegt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Parteiensystem, Wandel, Krise, Mitgliederschwund, Stimmenthaltung, Parteienverdrossenheit, Wahlbeteiligung, Volksparteien, politische Kultur, Pluralisierung, Wertewandel, westeuropäischer Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Steckt das deutsche Parteiensystem in einer Krise?
Obwohl Symptome wie Mitgliederschwund existieren, argumentiert die Arbeit eher für einen strukturellen Wandel als für einen endgültigen Niedergang.
Warum sinkt die Wahlbeteiligung in Deutschland?
Ursachen sind unter anderem nachlassende Parteibindung, soziale Desintegration und die Wahrnehmung einer geringeren Wirksamkeit der eigenen Stimme.
Was bedeutet "Volatilität" bei Wahlen?
Volatilität beschreibt die Wechselbereitschaft der Wähler zwischen verschiedenen Parteien von einer Wahl zur nächsten.
Haben Volksparteien ihre Bindungskraft verloren?
Ja, die Zahl der Stammwähler sinkt kontinuierlich, was zu einem fragmentierten Parteiensystem und schwierigeren Regierungsbildungen führt.
Was ist Parteienverdrossenheit?
Es ist das Gefühl der Unzufriedenheit mit der Arbeit politischer Parteien, das oft mit einem allgemeinen Vertrauensverlust in demokratische Institutionen einhergeht.
- Citation du texte
- Marcus Sommer (Auteur), 2008, Wandel des deutschen Parteiensystems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113175