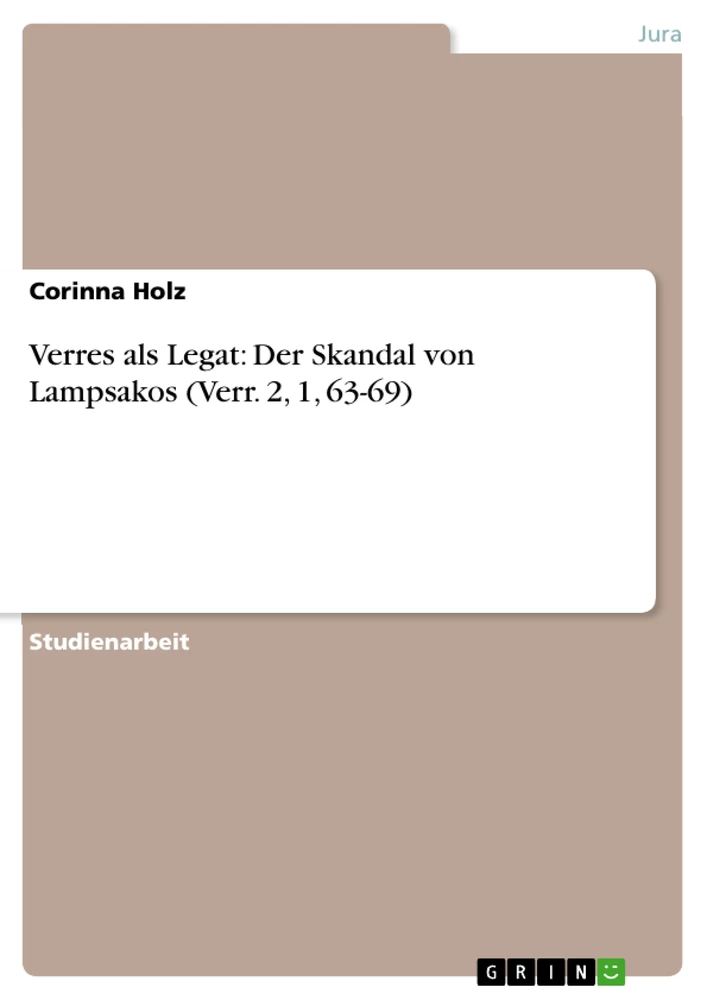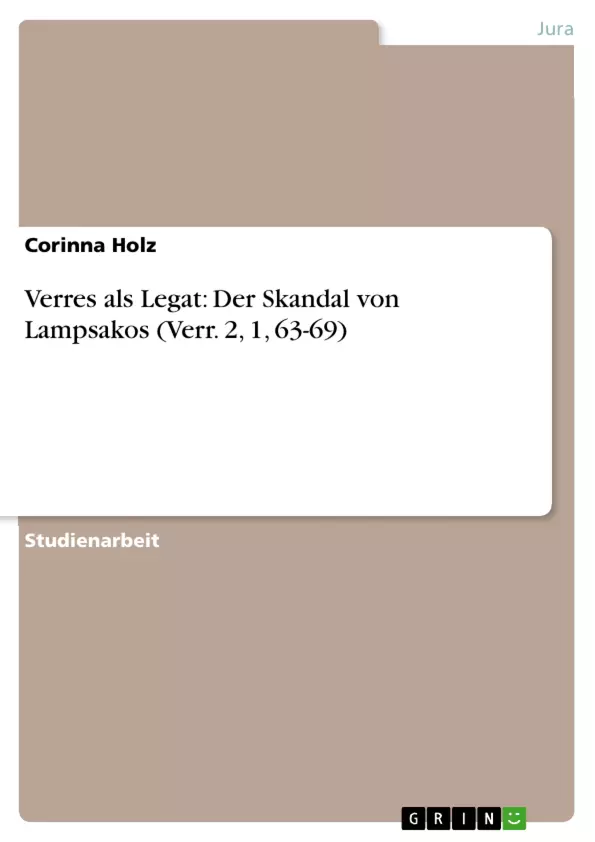Im 1. Buch der 2. Rede gegen Gaius Verres stellt Cicero das Leben desselben bis zu seinem Amt als Statthalter Siziliens anhand verschiedener Sachverhalte dar. Dabei referiert er auch eine Begebenheit, die sich in Lampsakos zugetragen haben soll, während Verres Legat des Dolabella war. Um verstehen zu können, weshalb Cicero einen Sachverhalt vorträgt, der mit der eigentlichen Anklage, nämlich der wegen Erpressung, nichts zu tun hatte und weshalb er gerade den „Skandal von Lampsakos“ auswählte, müssen die Hintergründe, die zeitlichen Umstände und die mögliche Absicht Ciceros näher betrachtet werden. Gleichzeitig sollte dar-an gedacht werden, dass wir die Begebenheit aus Lampsakos lediglich aus Ciceros Darstellung kennen und davon ausgehen müssen, dass er aufgrund seiner Position als Ankläger den Sachverhalt eventuell verzerrte, oder sogar nicht wahrheitsgemäß wiedergab. Zunächst wird unter (B.) der von Cicero vorgetragenen Sachverhalte zusammengefasst wiedergegeben und sodann die Inskription der Quelle vorgenommen (C.). Als geschichtliche Hintergrundinformationen werden innerhalb der Analyse des Textes (D.) die Legation, die Stadt Lampsakos und das damalige System der Gastfreundschaft dargestellt. Darauf basierend dreht es sich unter (E.) um die Frage, weshalb Cicero gerade diesen Sachverhalt in seine Gerichtsrede mit aufnahm, unter (F.) um die Echtheit der Quelle und unter (G.) darum, ob die Geschehnisse von Lampsakos tatsächlich ein Skandal waren. Letztlich schließt wird die Arbeit mit einem resü-mierenden Fazit (H.) abgeschlossen. Im Folgenden wird zunächst eine knappe Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts der Textstelle Verr. 2, 1, 63 – 69 gegeben. Verres erbat sich von Dolabella eine Reise zu König Nikomedes und zu König Sadala. Auf dem Weg dorthin kam er nach Lampsakos, wo er und seine Begleiter bei verschiedenen Gastgebern untergebracht wurden. Verres wies sogleich seine Begleiter an, Ausschau zu halten, ob es ein Mädchen oder eine Frau gäbe, für die es sich lohnen würde, länger in Lampsakos zu bleiben. Sein getreuer Begleiter Rubrius machte die Tochter des Philodamos, dem angesehensten Bürger der Stadt, ausfindig und berichtete Verres von ihrer Schönheit und Reinheit. Daraufhin war Verres Begierde für sie entfacht und er wollte zu Philodamos umziehen, um ihr näher zu kommen. Allerdings bezog sein Wirt Janitor diesen Wunsch auf seine Bewirtung und Verres konnte ihm keinen triftigen Grund für einen Umzug nennen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Zusammenfassung der vorliegenden Textstelle
- C. Inskription der Textstelle
- D. Historischer Hintergrund
- I. Die Legation
- 1) Auswahlverfahren
- 2) Funktion der Legaten
- II. Die Stadt Lampsakos
- III. Gastfreundschaft im antiken Griechenland
- 1) Allgemeine Bedeutung
- 2) Unterkunft und Verpflegung
- 3) Das Gastmahl
- IV. Römisches Gesandtschaftsrecht
- 1) Inhalt
- 2) Verres als Gesandter im völkerrechtlichen Sinne?
- E. Interpretation der Textstelle
- I. Gängige Gerichtspraxis im antiken Rom
- II. Krise in Kleinasien
- III. Herrschendes Misstrauen gegenüber dem Senatorenstand
- F. Literarisches Vorbild
- G. Echtheit der Quelle
- I. Verres Teilnahme am Gastmahl
- II. Rubrius erste Unterkunft
- III. Rubrius Frage nach Philodamos Tochter
- IV. Der Liktor Cornelius
- V. Ciceros Darstellung des Verres
- VI. Ciceros Darstellung der Lampsakener
- H. Die Geschehnisse von Lampsakos, ein Skandal?
- I. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Textstelle Verr. 2, 1, 63-69, in der Cicero den römischen Promagistrat Gaius Verres wegen seines Verhaltens während seiner Legation in Lampsakos anklagt. Die Arbeit untersucht den historischen Kontext der Legation, die Rolle von Verres als Gesandter und die Bedeutung der Gastfreundschaft im antiken Griechenland. Darüber hinaus werden die juristischen Aspekte des römischen Gesandtschaftsrechts und die Frage der Echtheit der Quelle beleuchtet.
- Die Rolle von Verres als Legat in Lampsakos
- Die Bedeutung der Gastfreundschaft im antiken Griechenland
- Das römische Gesandtschaftsrecht und seine Anwendung auf Verres
- Die Echtheit der Quelle und Ciceros Darstellung der Ereignisse
- Die Frage, ob die Geschehnisse von Lampsakos einen Skandal darstellen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die Textstelle Verr. 2, 1, 63-69 sowie die Person des Gaius Verres vor. Die Zusammenfassung der Textstelle fasst den Inhalt der Rede Ciceros gegen Verres in Bezug auf die Ereignisse in Lampsakos zusammen. Die Inskription der Textstelle beleuchtet den historischen Kontext der Rede und die Rolle von Cicero als Ankläger. Der Abschnitt "Historischer Hintergrund" behandelt die Legation im antiken Rom, die Stadt Lampsakos und die Bedeutung der Gastfreundschaft im antiken Griechenland. Das römische Gesandtschaftsrecht wird im Hinblick auf die Legation und die Rolle von Verres als Gesandter analysiert. Die Interpretation der Textstelle untersucht die gängige Gerichtspraxis im antiken Rom, die Krise in Kleinasien und das Misstrauen gegenüber dem Senatorenstand. Der Abschnitt "Literarisches Vorbild" beleuchtet die Frage, ob Cicero sich bei seiner Darstellung der Ereignisse in Lampsakos an literarischen Vorbildern orientiert hat. Die Echtheit der Quelle wird anhand der Darstellung der Ereignisse durch Cicero und der historischen Quellenlage untersucht. Der Abschnitt "Die Geschehnisse von Lampsakos, ein Skandal?" diskutiert die Frage, ob die Ereignisse in Lampsakos einen Skandal darstellen und welche Folgen sie für Verres hatten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Legation, Lampsakos, Gastfreundschaft, römisches Gesandtschaftsrecht, Verres, Cicero, Echtheit der Quelle, Skandal und Gerichtspraxis im antiken Rom.
- Quote paper
- Corinna Holz (Author), 2008, Verres als Legat: Der Skandal von Lampsakos (Verr. 2, 1, 63-69), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113220