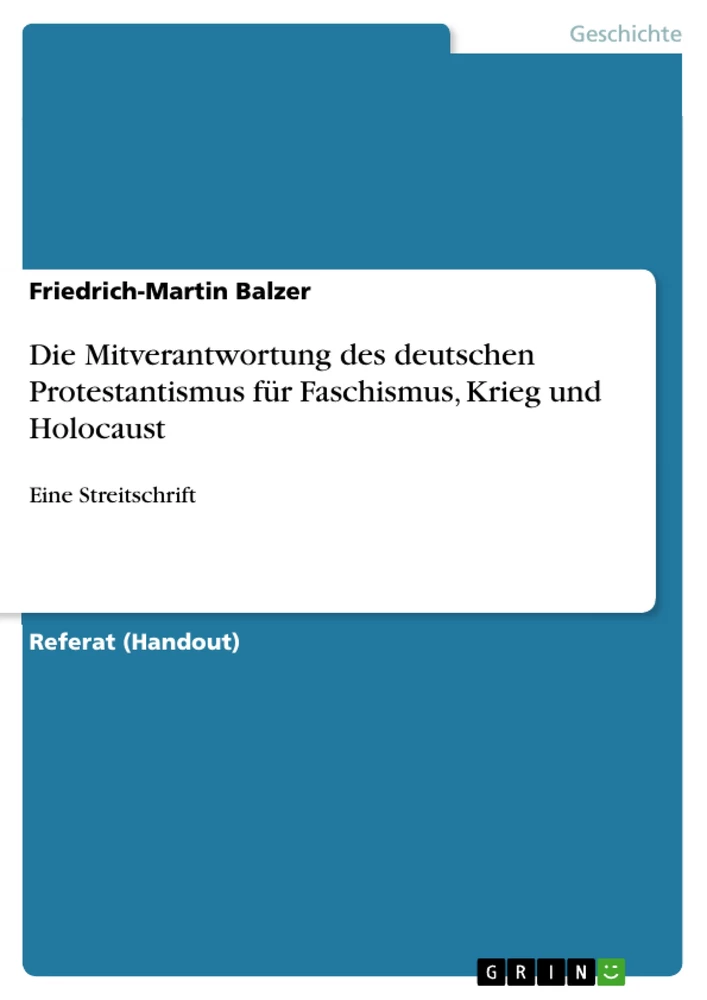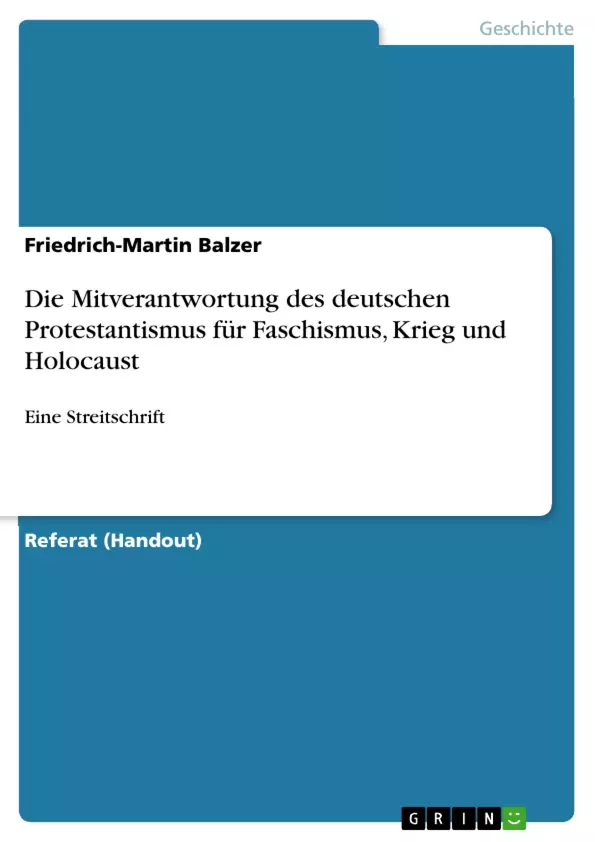Jahrzehntelang beruhte die Nachkriegskirchengeschichtsschreibung weitgehend auf der Annahme, aktive Unterstützung für das faschistische Regime und antisemitische Hasspredigten und Maßnahmen habe es im offiziellen deutschen Protestantismus nicht gegeben. Tatsächlich war das Gegenteil der Fall: Der deutsche Protestantismus war kein Beifahrer und Trittbrettfahrer, sondern aktiv an der Zerstörung der Weimarer Republik und der Errichtung und Stabilisierung der faschistischen Diktatur beteiligt. Die grundsätzliche Gegnerschaft der evangelischen Kirche zum NS-Staat und seiner antijüdischen Politik ist ein Mythos, eine erfundene Tradition.
Angesichts der Begeisterung des deutschen Protestantismus für den ersten imperialistischen Krieg 1914-1918 war dies kein „Betriebsunfall“, sondern das Ergebnis eines langen Irrweges. Ohne die fortgesetzte und steigende Akzeptanz, die Duldung, die Unterstützung, die Gefolgschaft von Massen der Bevölkerung, zu der der deutsche Protestantismus auf breiter Front auf dem ideologischen Feld nachhaltig beitrug, wäre der Faschismus eine Episode geblieben und unfähig gewesen, in Europa und über dessen Grenzen hinaus das anzurichten und zu verbrechen, was er tat.
Auch nach 1945 setzte sich die babylonische Gefangenschaft der deutschen evangelischen Kirche durch Anpassung an herrschende Verhältnisse weitgehend fort. Einschlägige Antisemiten und regimetreue Pfarrer und Kirchenführer blieben im Amt. Von einer Entnazifizierung im Raum der Kirche oder gar einem Bruch in der Geschichte des Protestantismus kann keine Rede sein.
Um sich zu rehabilitieren, müßte die Kirche ihren tapferen Einzelkämpfern unzweideutig Gerechtigkeit widerfahren lassen, die Dienstentlassungsverfahren gegen christliche Antifaschisten auch juristisch im Lichte der Barmer Theologischen Erklärung im Sinne der Betroffenen und der geschichtlichen Wahrheit aufheben und aus ihrem eigenen Versagen nachhaltig lernen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Mitverantwortung des deutschen Protestantismus für Faschismus, Krieg und Holocaust. Eine Streitschrift
- I. Christliche Antifaschisten der ersten Stunde: Erwin Eckert, Emil Fuchs, Heinz Kappes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Streitschrift befasst sich mit der Rolle des deutschen Protestantismus in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie widerlegt die gängige Annahme, dass die evangelische Kirche lediglich ein passiver Beobachter des Geschehens war, und zeigt auf, wie aktiv der deutsche Protestantismus an der Zerstörung der Weimarer Republik und der Errichtung und Stabilisierung der faschistischen Diktatur beteiligt war. Die Autorin analysiert das Versagen des Protestantismus in der Bekämpfung des Antisemitismus und untersucht die Gründe für diese Fehlentwicklung.
- Die aktive Rolle des deutschen Protestantismus bei der Etablierung des Nationalsozialismus
- Die Bedeutung des Antisemitismus im deutschen Protestantismus
- Die Verharmlosung des Widerstands durch die Nachkriegskirchengeschichtsschreibung
- Die Bedeutung der religiösen Sozialisten im antifaschistischen Widerstand
- Die Rolle des deutschen Protestantismus in der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung der Streitschrift beleuchtet die lange Zeit verbreitete Tendenz in der Nachkriegskirchengeschichtsschreibung, die Rolle des deutschen Protestantismus im Nationalsozialismus zu verharmlosen und die „wahre", rechtgläubige Bekennende Kirche als Opfer des NS-Regimes darzustellen. Die Autorin stellt die Behauptung auf, dass die evangelische Kirche aktiv am Aufstieg des Faschismus beteiligt war und sich nicht hinreichend gegen den Antisemitismus und die Verfolgung der Juden stellte.
- Das erste Kapitel stellt drei christliche Antifaschisten vor: Erwin Eckert, Emil Fuchs und Heinz Kappes. Diese Persönlichkeiten, die sich frühzeitig und vehement gegen den Nationalsozialismus und den Antisemitismus stellten, wurden vom deutschen Protestantismus größtenteils ignoriert oder gar verfolgt. Eckert, Fuchs und Kappes waren für ihren Widerstand gegen das NS-Regime inhaftiert und wurden von der Kirche nicht unterstützt.
Schlüsselwörter
Die Streitschrift konzentriert sich auf die Themen des deutschen Protestantismus, des Faschismus, des Antisemitismus und des Widerstands gegen das NS-Regime. Dabei stehen die religiösen Sozialisten im Vordergrund, die als Teil der Geschichte der Arbeiterbewegung und als mutige Gegner des Nationalsozialismus gezeigt werden. Die Autorin verwendet Begriffe wie „Mitverantwortung“, „antichristlicher NS-Staat“, „christliche Antifaschisten“, „geistige und politische Verführung“, „Judenhetze“ und „sozialreaktionärer Faschismus“ um die Komplexität der Thematik zu verdeutlichen.
Häufig gestellte Fragen
War der Protestantismus am Aufstieg des Faschismus beteiligt?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass Teile der evangelischen Kirche aktiv an der Zerstörung der Weimarer Republik und der Stabilisierung der NS-Diktatur mitwirkten.
Ist der Widerstand der Kirche gegen Hitler ein Mythos?
Die Autorin argumentiert, dass eine grundsätzliche Gegnerschaft zur antijüdischen Politik oft eine "erfundene Tradition" der Nachkriegszeit war.
Wer waren die christlichen Antifaschisten?
Die Arbeit stellt mutige Einzelkämpfer wie Erwin Eckert, Emil Fuchs und Heinz Kappes vor, die von der Amtskirche oft im Stich gelassen wurden.
Gab es nach 1945 eine Entnazifizierung in der Kirche?
Laut der Streitschrift blieben viele regimetreue Pfarrer und Antisemiten auch nach dem Krieg im Amt, ohne dass ein echter Bruch stattfand.
Was fordert die Autorin zur Rehabilitation?
Sie fordert die juristische Aufhebung alter Dienstentlassungsverfahren gegen Antifaschisten und ein ehrliches Bekenntnis zum eigenen Versagen.
- Citar trabajo
- Dr. Friedrich-Martin Balzer (Autor), 2010, Die Mitverantwortung des deutschen Protestantismus für Faschismus, Krieg und Holocaust, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1132541