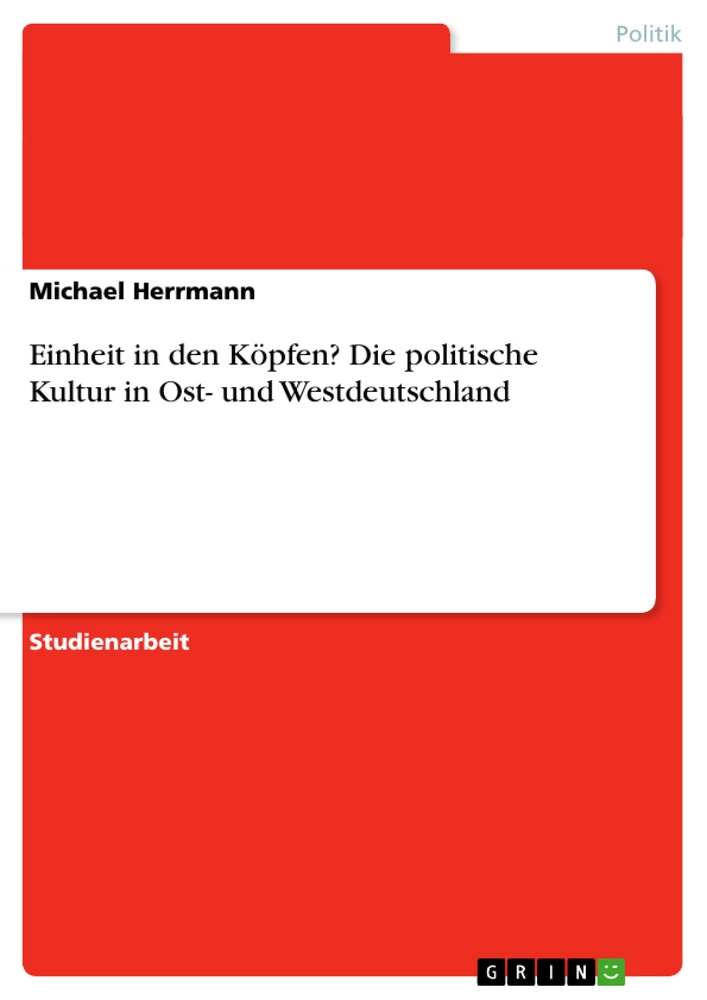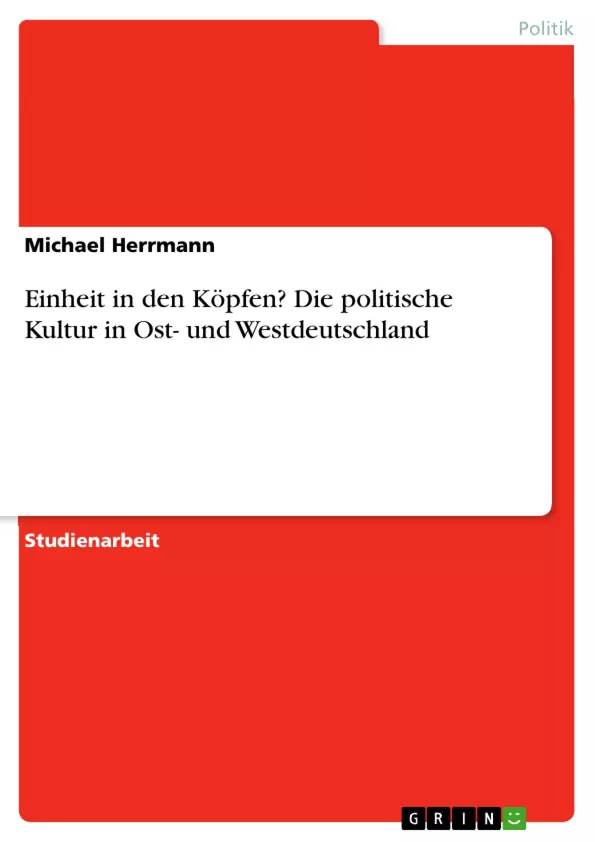Der Fall der Mauer im November 1989 war der Startschuss einer rasanten Entwicklung die am 3. Oktober 1990 in der offiziellen Wiedervereinigung Deutschlands endete.
Enden ist hierbei jedoch nicht der richtige Begriff, denn noch 18 Jahre nach diesen Ereignissen ist die Frage nach der „Einheit in den Köpfen“ allgegenwärtig. Gibt es in Deutschland heute (noch immer) zwei unterschiedliche politische Kulturen? Diese Frage beschäftigt selbst 18 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung zahlreiche Menschen. Um sie zu beantworten, muss man sich zunächst klar machen, was unter dem Begriff überhaupt zu verstehen ist, denn politische Kultur kann durchaus grundverschiedene Bedeutungen haben. In dieser Arbeit steht hierbei vor allem das bürgerliche Engagement als Grundpfeiler eines demokratischen Gesellschaftssystem im Blickpunkt. Politisches Interesse, Politikwissen, Beurteilung von real praktizierter Politik und des Systems im Allgemeinen, sowie die Handlungsbereitschaft und das aktive Handeln werden auf ihr unterschiedliches Vorkommen in Ost- Westdeutschland analysiert, wobei neben der bloßen Darstellung von Differenzen, Ähnlichkeiten und Entwicklungen, vor allem deren Ursachen erklärt werden, um ein besseres Verständnis für die Unterschiede in der politischen Kultur zwischen West- und Ostdeutschland zu bekommen und den gängigen Vorurteilen der "Besserwessis" und "Jammerossis" entgegen zu wirken, denn Differenzen erklären sich selten aus sich selbst heraus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Nach 18 Jahren Einheit in den Köpfen?
- Theoretischer Grundlage
- Definition Politische Kultur
- Sozialisationshypothese
- Situationshypothese
- Verbindung von Sozialisations- und Situationshypothese
- Die Aktivität der deutschen Bürger im Vergleich
- Politisches Interesses
- Politikwissen
- Objektives Politikwissen
- Subjektives Politikwissen
- Politikbeurteilung
- Bewertung der Systemperformanz
- Bewertung des Systems im Allgemeinen
- Beteiligungsbereitschaft
- Aktives Handeln
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Unterschiede in der politischen Kultur zwischen Ost- und Westdeutschland 18 Jahre nach der Wiedervereinigung. Sie analysiert das bürgerliche Engagement als Grundpfeiler eines demokratischen Gesellschaftssystems, indem sie politisches Interesse, Politikwissen, Politikbeurteilung, Beteiligungsbereitschaft und aktives Handeln in den Blick nimmt. Ziel ist es, neben der Darstellung von Differenzen, Ähnlichkeiten und Entwicklungen, vor allem deren Ursachen aufzuzeigen, um ein besseres Verständnis für die Unterschiede in der politischen Kultur zwischen West- und Ostdeutschland zu bekommen.
- Unterschiede in der politischen Kultur zwischen Ost- und Westdeutschland
- Bürgerliches Engagement als Grundpfeiler eines demokratischen Gesellschaftssystems
- Politisches Interesse, Politikwissen, Politikbeurteilung, Beteiligungsbereitschaft und aktives Handeln
- Ursachen für die Unterschiede in der politischen Kultur
- Entwicklungen in der politischen Kultur nach der Wiedervereinigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Frage nach der „Einheit in den Köpfen“ 18 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und erläutert die Bedeutung des Begriffs „politische Kultur“. Sie definiert den Gegenstand der Untersuchung als das bürgerliche Engagement und benennt die Ziele der Arbeit.
Der theoretische Teil der Arbeit beleuchtet verschiedene Definitionen des Begriffs „politische Kultur“ und stellt die Sozialisations- und Situationshypothese vor. Er diskutiert die Bedeutung der Politischen-Kultur-Forschung für die Politikwissenschaft und die Notwendigkeit eines diachronen Vergleichs, um Entwicklungen in der politischen Kultur aufzuzeigen.
Der Hauptteil der Arbeit analysiert die Aktivität der deutschen Bürger im Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland. Er untersucht das politische Interesse, das Politikwissen (objektiv und subjektiv), die Politikbeurteilung (Bewertung der Systemperformanz und des Systems im Allgemeinen), die Beteiligungsbereitschaft und das aktive Handeln. Die Analyse basiert auf empirischen Daten und beleuchtet die Unterschiede, Ähnlichkeiten und Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen des bürgerlichen Engagements.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die politische Kultur in Ost- und Westdeutschland, die deutsche Wiedervereinigung, bürgerliches Engagement, politisches Interesse, Politikwissen, Politikbeurteilung, Beteiligungsbereitschaft, aktives Handeln, Sozialisationshypothese, Situationshypothese, Systemperformanz, Systemstabilität, diachroner Vergleich, empirische Datenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es heute noch Unterschiede in der politischen Kultur zwischen Ost und West?
Ja, auch Jahre nach der Wiedervereinigung zeigen sich Differenzen im politischen Interesse, dem Politikwissen und der Bewertung des politischen Systems zwischen Ost- und Westdeutschen.
Was ist die Sozialisationshypothese?
Diese Hypothese besagt, dass die politischen Einstellungen durch die jahrzehntelange Prägung in unterschiedlichen politischen Systemen (DDR vs. BRD) tief in den Köpfen verankert sind.
Was besagt die Situationshypothese?
Die Situationshypothese erklärt Unterschiede in der politischen Kultur durch die aktuelle wirtschaftliche und soziale Lage der Menschen, wie z.B. Arbeitslosigkeit oder Einkommensunterschiede.
Wie unterscheidet sich das bürgerliche Engagement?
Die Arbeit analysiert die Beteiligungsbereitschaft und das aktive Handeln der Bürger und zeigt auf, in welchen Bereichen (z.B. Wahlen, Ehrenamt) Ähnlichkeiten oder Entwicklungen bestehen.
Was bedeutet "Einheit in den Köpfen"?
Der Begriff hinterfragt, ob über die formale staatliche Einheit hinaus auch eine gemeinsame politische Identität und ein ähnliches Verständnis von Demokratie in ganz Deutschland zusammengewachsen sind.
- Citation du texte
- Michael Herrmann (Auteur), 2008, Einheit in den Köpfen? Die politische Kultur in Ost- und Westdeutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113301