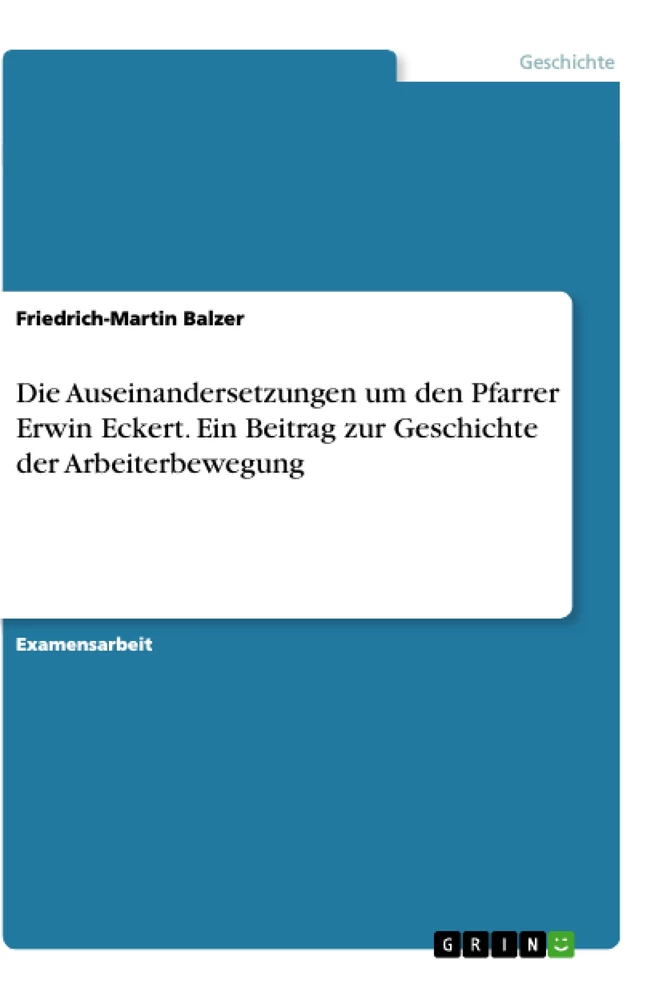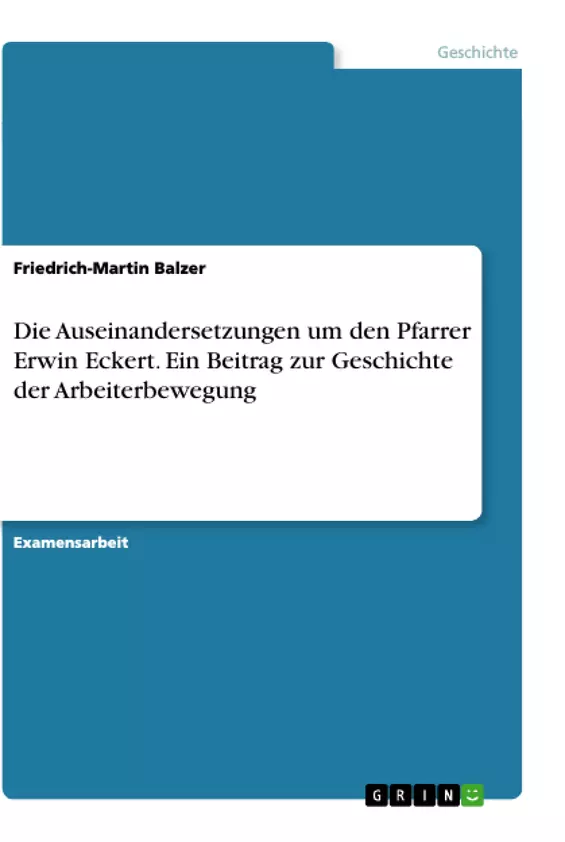Am 30. Januar siegt mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler der Regierung der „nationalen Revolution“ der Faschismus in Deutschland. Nach der schrittweisen Aushöhlung der bürgerlichen Demokratie in der Periode der Notverordnungsdiktatur der Präsidialkabinette ist der Faschismus das schließliche Ergebnis der Klassenkämpfe der Weimarer Republik.
War die bürgerliche Republik das Werk der Arbeiterbewegung gewesen, so siegt mit der „Machtergreifung“ des Faschismus die Gegenrevolution. Ihre Funktion ist es, die durch die kapitalistische Weltwirtschaftskrise bedrohte soziale Herrschaft über die gesamte bürgerliche Gesellschaft auszuüben. Im Sinne dieser Funktion ist die Zerschlagung der legalen Organisation der Arbeiterbewegung, zunächst der KPD und ihrer Massenorganisationen, dann auch der reformistischen SPD und der Gewerkschaften, erster und wesentlicher Ausdruck der politischen Herrschaft des Faschismus.
Der Sieg des Faschismus ist zugleich die Niederlage der Arbeiterbewegung, die in der bürgerlich-faschistischen Einheitsfront hervorgerufene Bürgerkriegssituation die Spaltung in zwei sich befehdende Parteien nicht durch die Bildung einer antifaschistischen Einheitsfront der Arbeiterklasse überwinden konnte. Die soziale Basis der faschistischen Massenbewegung sind durch die soziale Krise materiell und sozialpsychologisch bedrohte Mittelschichten, die der sozialen und nationalen Demagogie der 'Nationalsozialisten' erliegen, weil die gespaltene Arbeiterbewegung den Angestellten und Beamten, jenem Teil der Mittelschichten, die ebenso wie die Arbeiter vom Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft leben, keine wirksame Verteidigung ihrer sozialen Interessen anbot und keine reale Macht darzustellen schien.
Inhaltsverzeichnis
- Problemgeschichtliche Einleitung
- Methodische Überlegungen zur Geschichte der religiösen Sozialisten in der Weimarer Republik
- Die soziale Zusammensetzung der Kirchenkampfparteien in der Weimarer Republik
- Das politische Verhältnis des Bundes der religiösen Sozialisten zur SPD und der Konflikt um Pfarrer Erwin Eckert
- Kampf gegen den Faschismus (Dezember 1931 bis Februar 1933) und Widerstand gegen das „Dritte Reich“ (1933-1945)
- Kampf um antifaschistische Aktionseinheit und sozialistische Einheitspartei in Südbaden (1945/46)
- Mandats- und Funktionsträger der KPD (1946-1956)
- Kampf gegen Wiederaufrüstung und Atombewaffnung (1950-1960)
- Zusammenfassung und Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auseinandersetzungen um den Pfarrer Erwin Eckert im Kontext der deutschen Arbeiterbewegung und beleuchtet die Rolle der religiösen Sozialisten in der Weimarer Republik und im „Dritten Reich“.
- Die Geschichte der religiösen Sozialisten in Deutschland
- Der Konflikt zwischen religiösen Sozialisten und der SPD
- Der Widerstand gegen den Faschismus
- Die Rolle der Kirchen im Nationalsozialismus
- Die Bedeutung Erwin Eckerts für die Arbeiterbewegung
Zusammenfassung der Kapitel
- Problemgeschichtliche Einleitung: Dieses Kapitel stellt den historischen Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die Rolle der Arbeiterbewegung im Aufstieg des Faschismus in Deutschland.
- Methodische Überlegungen zur Geschichte der religiösen Sozialisten in der Weimarer Republik: Das Kapitel untersucht die Entstehung der Bewegung der religiösen Sozialisten in Deutschland und ihre spezifischen Herausforderungen im Kontext der Weimarer Republik.
- Die soziale Zusammensetzung der Kirchenkampfparteien in der Weimarer Republik: Das Kapitel betrachtet die unterschiedlichen sozialen und politischen Strömungen innerhalb der Kirchen im Kontext der Weimarer Republik und des Kirchenkampfs.
- Das politische Verhältnis des Bundes der religiösen Sozialisten zur SPD und der Konflikt um Pfarrer Erwin Eckert: Dieses Kapitel analysiert die komplexen Beziehungen zwischen den religiösen Sozialisten und der SPD sowie den Konflikt um Erwin Eckert, der zu seinem Ausschluss aus der SPD und seinem Übertritt in die KPD führte.
- Kampf gegen den Faschismus (Dezember 1931 bis Februar 1933) und Widerstand gegen das „Dritte Reich“ (1933-1945): Das Kapitel beleuchtet den Kampf der religiösen Sozialisten gegen den Faschismus und ihre Rolle im Widerstand gegen das „Dritte Reich“.
Schlüsselwörter
Religiöse Sozialisten, Arbeiterbewegung, Weimarer Republik, „Dritte Reich“, Kirchenkampf, Erwin Eckert, SPD, KPD, Faschismus, Widerstand, Klassenkampf, Theologie, Kirche, Politik
Häufig gestellte Fragen
Wer war Erwin Eckert?
Erwin Eckert war ein Pfarrer und führendes Mitglied der religiösen Sozialisten, der aufgrund seines politischen Engagements aus der SPD ausgeschlossen wurde und später zur KPD übertrat.
Welche Rolle spielten religiöse Sozialisten in der Weimarer Republik?
Sie versuchten, christliche Werte mit sozialistischen Zielen zu verbinden und engagierten sich aktiv im Kampf gegen den aufkommenden Faschismus.
Warum scheiterte die antifaschistische Einheitsfront?
Die Spaltung der Arbeiterbewegung in SPD und KPD verhinderte eine gemeinsame Verteidigung gegen die Nationalsozialisten, was letztlich den Sieg des Faschismus begünstigte.
Was war die Funktion des Faschismus laut der Arbeit?
Er diente dazu, die durch die Weltwirtschaftskrise bedrohte soziale Herrschaft der bürgerlichen Gesellschaft durch die Zerschlagung der Arbeiterbewegung zu sichern.
Wie engagierte sich Eckert nach 1945?
Nach dem Krieg setzte er sich in Südbaden für eine sozialistische Einheitspartei ein und kämpfte später gegen Wiederaufrüstung und Atombewaffnung.
- Citation du texte
- Dr. Friedrich-Martin Balzer (Auteur), 1967, Die Auseinandersetzungen um den Pfarrer Erwin Eckert. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1133270