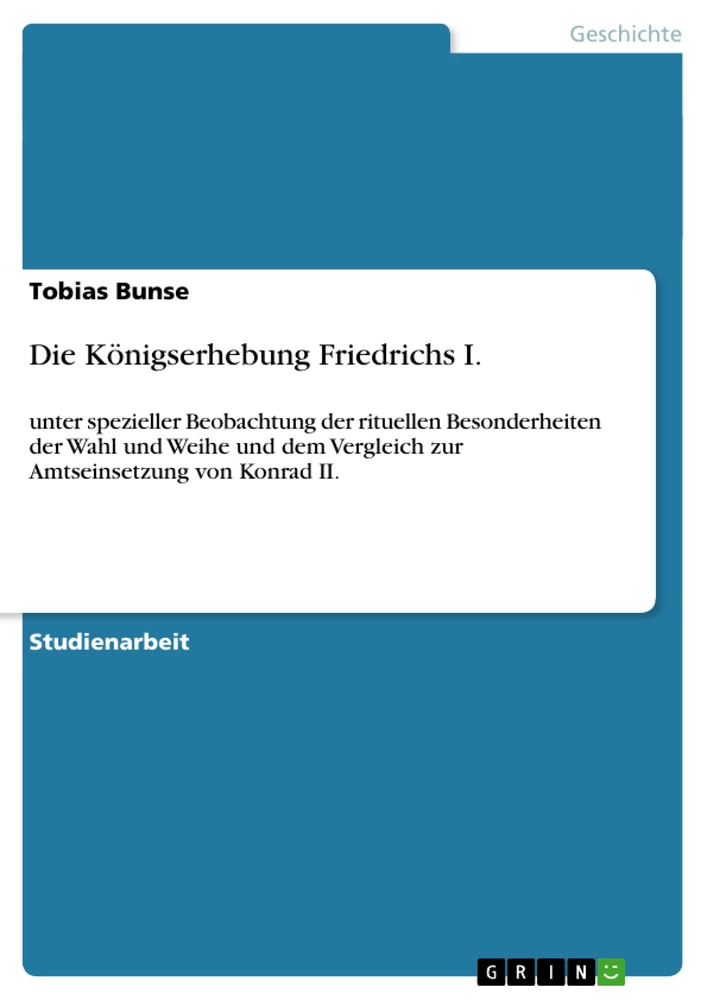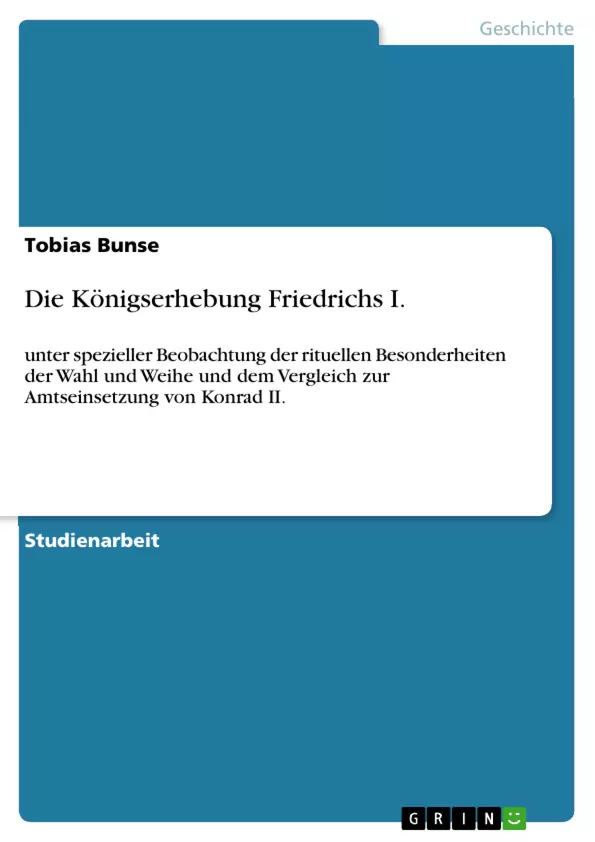Friedrich I. wurde am 4. März 1152 zum römisch-deutschen König gewählt. Diese Tatsache bedingt zugleich die Frage, aus welchem Grund ausgerechnet der Neffe des noch amtierenden Königs Konrad III. dessen Nachfolger in diesem Amt geworden ist. Da Konrad III. zudem einen Nachfolger in direkter Erbfolge auf den Thron, in Person seines eigenen Sohnes, designieren hätte können, wird das Interesse an den Hintergründen bezüglich der Königswahl Friedrichs I. verstärkt. Um zu prüfen, inwieweit und ob diese Thronfolge ungewöhnlich zu betrachten ist, sollte in einem ersten Schritt herausgefunden werden, welche Rolle das Erbrecht bei der Königswahl im hohen Mittelalter eingenommen hat. Lässt sich von dem Denken ausgehen, dass der am nächsten Verwandte des Königs die Thronfolge antritt, wie es beispielsweise in den heutigen, noch existierenden, Königshäusern der Fall ist, so hätte demnach Konrads Sohn neuer König werden „müssen“. Doch bekanntermaßen war dem nicht so. Mit Blick auf diese „Besonderheit“ sind im Folgenden die Rituale dieser Königswahl zu beachten, dessen Untersuchung den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden wird. Inwieweit lassen sich Unterschiede in den Ritualen der Königserhebung Friedrich Barbarossas zu anderen Amtseinsetzungen feststellen, das heißt auch, wie könnte sich die Tatsache, dass Barbarossa unter anderen Umständen auf den Thron gehoben wurde, auf den Akt der Wahl und der Weihe, beziehungsweise auf einzelne rituelle Elemente, ausgewirkt haben? Waren diese Umstände überhaupt so besonders oder gar einzigartig? Mögliche Besonderheiten der Königserhebung möchte ich im Folgenden erläutern, wobei mir als Grundlage vor allem die Quelle von Otto von Freising dienen wird...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Situation vor der Königswahl Friedrich Barbarossas
- Konrads Wahl fällt auf Friedrich Barbarossa
- Die Wahl eines Königs
- Die Königserhebung Friedrichs I.
- Otto von Freising: „Gesta Frederici“
- Die Königserhebung Barbarossas und die Rolle der rituellen Elemente
- Die Amtseinsetzung Konrads II.
- Wipo berichtet von der Wahl und Erhebung Konrads II.
- Die Königwahl Konrads mit Blick auf die rituellen Elemente
- Von der Weihe des Königs mit Blick auf die rituellen Elemente
- Zusammenfassende Gegenüberstellung der Königserhebungen
- signifikante Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Königserhebungen
- Schluss
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Königserhebung Friedrichs I. Barbarossas im Jahr 1152. Sie untersucht die Hintergründe seiner Wahl, insbesondere die Rolle des Erbrechts und die rituellen Besonderheiten der Wahl und Weihe. Die Arbeit vergleicht diese mit der Amtseinsetzung Konrads II. und analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ritualen. Ziel ist es, die Besonderheiten der Königserhebung Friedrichs I. zu beleuchten und die Bedeutung der rituellen Elemente für die Legitimation der Königsmacht zu untersuchen.
- Die Rolle des Erbrechts bei der Königswahl im hohen Mittelalter
- Die rituellen Elemente der Königserhebung Friedrichs I. und Konrads II.
- Der Vergleich der Königserhebungen Friedrichs I. und Konrads II.
- Die Bedeutung der rituellen Elemente für die Legitimation der Königsmacht
- Die Besonderheiten der Königserhebung Friedrichs I. im Kontext der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Forschungsgegenstand. Sie beleuchtet die Besonderheiten der Königserhebung Friedrichs I. und die Bedeutung der rituellen Elemente. Kapitel 2 analysiert die Situation vor der Königswahl Friedrichs I. und beleuchtet die Hintergründe seiner Wahl. Es werden die Charaktermerkmale Friedrichs I. und die Rolle des Erbrechts bei der Königswahl im hohen Mittelalter diskutiert. Kapitel 3 befasst sich mit der Königserhebung Friedrichs I. und analysiert die Rolle der rituellen Elemente. Es wird auf die Quelle von Otto von Freising eingegangen und die Bedeutung der rituellen Elemente für die Legitimation der Königsmacht untersucht. Kapitel 4 analysiert die Amtseinsetzung Konrads II. und vergleicht die rituellen Elemente mit denen der Königserhebung Friedrichs I. Es wird auf die Quelle von Wipo eingegangen und die Bedeutung der rituellen Elemente für die Legitimation der Königsmacht untersucht. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die signifikanten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Königserhebungen gegenüber. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und die Bedeutung der rituellen Elemente für die Legitimation der Königsmacht im hohen Mittelalter hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Königserhebung, Friedrich I. Barbarossa, Konrad II., Rituale, Wahl, Weihe, Erbrecht, Legitimation, Königsmacht, Mittelalter, Otto von Freising, Wipo, „Gesta Frederici“, „Chronik des Wipo“. Die Arbeit beleuchtet die Besonderheiten der Königserhebung Friedrichs I. und vergleicht diese mit der Amtseinsetzung Konrads II. Sie analysiert die Rolle des Erbrechts und die Bedeutung der rituellen Elemente für die Legitimation der Königsmacht im hohen Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde Friedrich I. Barbarossa 1152 zum König gewählt?
Trotz des Vorhandenseins eines direkten Erben (Konrads Sohn) wurde Barbarossa aufgrund seiner persönlichen Eignung und politischer Absprachen von den Fürsten gewählt.
Welche Rolle spielte das Erbrecht bei der mittelalterlichen Königswahl?
Das Erbrecht war wichtig, aber nicht allein entscheidend; die Wahl durch die Großen des Reiches und die persönliche Qualifikation spielten eine ebenso große Rolle.
Was sind die rituellen Elemente einer Königserhebung?
Zu den Ritualen gehören die Wahl durch die Fürsten, die Thronsetzung, die Übergabe der Reichsinsignien und die feierliche Salbung und Krönung (Weihe).
Wer sind die wichtigsten zeitgenössischen Quellen für diese Arbeit?
Die Arbeit stützt sich primär auf die "Gesta Frederici" von Otto von Freising und die Berichte von Wipo über Konrad II.
Wie unterschied sich Barbarossas Erhebung von der Konrads II.?
Die Arbeit analysiert signifikante Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den rituellen Abläufen und der Legitimation beider Herrscher.
- Citation du texte
- Tobias Bunse (Auteur), 2008, Die Königserhebung Friedrichs I., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113331