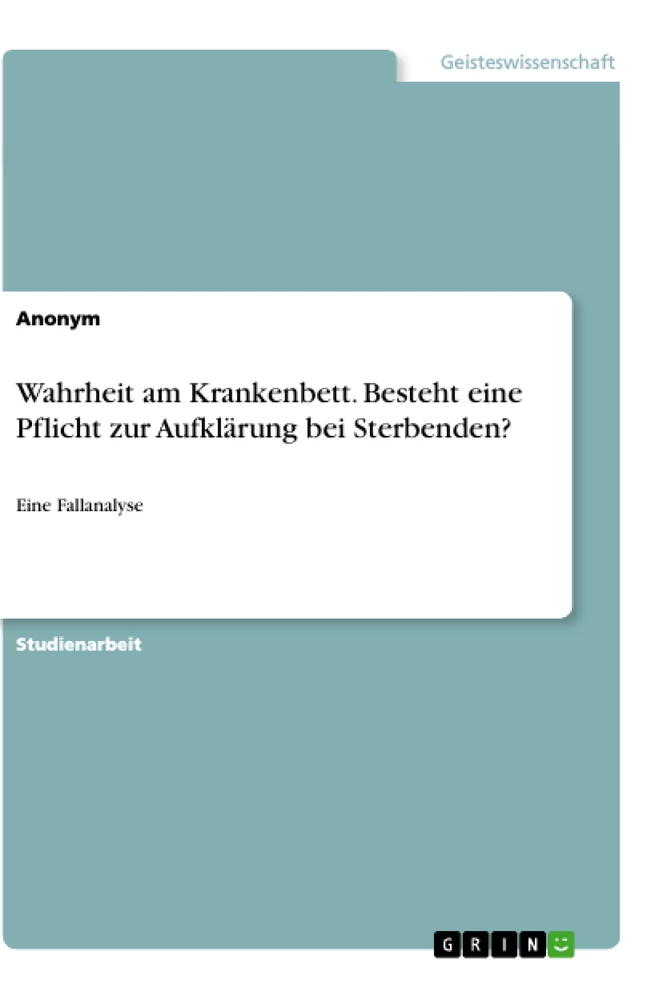Diese Arbeit befasst sich im Rahmen einer ethischen Auseinandersetzung um die Frage, wie einem Sterbenden seine Diagnose überbracht werden kann, mit der Sterbehilfe. Besteht aus ethischer Pflicht eine Pflicht zur Aufklärung?
Das Überbringen schlechter Nachrichten ist eine der unangenehmen und gefürchteten Aufgaben im Leben. Das liegt insbesondere daran, dass die Offenlegung schlechter Nachrichten fatale Folgen haben kann. Eine schlechte Diagnose kann beispielsweise dazu führen, dass ein Patient seine bisherige Lebensplanung dramatisch infrage stellt, seinen Lebenswillen verliert und resigniert. Daher stellt sich vor allem bei schlechten Nachrichten ohne weitere Entscheidungsalternativen die Frage, ob eine Pflicht zur Aufklärung besteht.
Die Ärzte wissen oft nicht genau, wie sie mit schlechten Nachrichten umgehen sollen, da sie in diesem Punkt nicht genug ausgebildet sind. Als Helfer sind sie bemüht, den Patienten zu schützen, dies kann aber zu verharmlosenden Formulierungen oder Verheimlichen von entscheidenden Fakten führen. Zudem kommt es vor, dass Ärzten das nötige Einfühlungsvermögen fehlt, sodass sie die schlimme Nachricht zu direkt mitteilen, ohne sich richtig Zeit für den Patienten zu nehmen. Einem Freund meines Vaters wurde bspw. am Telefon gesagt, dass er sterben muss. Aber auch die Beteiligten sind häufig mit der Situation überfordert. Sie stehen aufgrund der plötzlichen Nachricht über den bevorstehenden Tod eines nahestehenden Menschen unter großem Schock. Zudem sind sie unsicher und hilflos, da sie keine Erfahrung mit dem Sterben haben. Dies kann dazu führen, dass der Patient gemieden wird, weil sie den Anblick nicht ertragen können, Skrupel haben und die unangenehme Situation meiden wollen. Ärzte und Beteiligte begründen das Verschweigen einer schlechten oder gar aussichtslosen Diagnose dann oft mit dem Aufrechterhalten des Optimismus, als das letzte Quäntchen Lebensqualität, das dem Patienten noch bleibt. Aber rechtfertigt der Optimismus des Patienten ihre Unaufrichtigkeit?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Der Fall
- 1.2. Problemstellung
- 2. Fallanalyse
- 2.1. Spontanurteil
- 2.2. Sachanalyse
- 2.3. Ethische Analyse
- 2.4. Abschließendes Urteil
- 3. Schlussbetrachtung
- 3.1. Reflektion
- 3.2. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der ethischen Frage, ob und inwieweit Ärzte und Angehörige einem schwer kranken Patienten die Wahrheit über seinen Zustand offenlegen sollten. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse eines konkreten Falls, in dem die Ärzte die Diagnose aus Angst vor den emotionalen Folgen für den Patienten verschwiegen haben. Die Arbeit untersucht die Argumente für und gegen die Aufklärung in diesem Zusammenhang, die ethischen und rechtlichen Aspekte der ärztlichen Aufklärungspflicht und die Auswirkungen der Wahrheit und des Nichtwissens auf den Patienten.
- Ärztliche Aufklärungspflicht und Recht auf Nichtwissen
- Ethische Dilemmata bei der Übermittlung schlechter Nachrichten
- Psychologische Folgen der Wahrheit und des Nichtwissens für den Patienten
- Patientenselbstbestimmung und Autonomie
- Medizinische und ethische Entwicklungen im Umgang mit schwer kranken Patienten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Fall eines Patienten vor, dem seine lebensbedrohliche Erkrankung verschwiegen wurde. Die Problemstellung beleuchtet die Herausforderungen der Kommunikation von schlechten Nachrichten und die unterschiedlichen Perspektiven von Ärzten und Angehörigen. Die Fallanalyse untersucht das Spontanurteil, die Sachanalyse und die ethischen Aspekte der Situation.
Schlüsselwörter
Ärztliche Aufklärungspflicht, Recht auf Nichtwissen, Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Patientenselbstbestimmung, Paternalismus, Hospizbewegung, Palliativmedizin, ethische Dilemmata, schlechte Nachrichten, Lebensbedrohliche Krankheit.
Häufig gestellte Fragen
Besteht eine ethische Pflicht zur Aufklärung bei sterbenden Patienten?
Die Arbeit untersucht dieses ethische Dilemma und wägt die Aufklärungspflicht gegen das Recht auf Nichtwissen und den Schutz des Patienten ab.
Warum fällt es Ärzten oft schwer, schlechte Nachrichten zu überbringen?
Ärzte sind oft nicht ausreichend für diese Aufgabe ausgebildet, fürchten fatale emotionale Folgen beim Patienten oder versuchen, dessen Optimismus durch Verheimlichung zu schützen.
Was versteht man unter dem „Recht auf Nichtwissen“?
Es bezeichnet den Anspruch eines Patienten, über eine aussichtslose Diagnose nicht informiert zu werden, um die verbleibende Lebensqualität nicht durch Resignation zu gefährden.
Welche psychologischen Folgen kann das Verschweigen einer Diagnose haben?
Das Nichtwissen kann zu Unsicherheit führen, während die Wahrheit zwar schmerzhaft ist, aber Autonomie und eine bewusste Lebensgestaltung bis zum Ende ermöglichen kann.
Wie geht die Fallanalyse in dieser Seminararbeit vor?
Die Analyse gliedert sich in ein Spontanurteil, eine Sachanalyse, eine detaillierte ethische Analyse und schließt mit einem begründeten abschließenden Urteil ab.
Welche Rolle spielen Angehörige beim Überbringen schlechter Diagnosen?
Angehörige sind oft selbst traumatisiert und überfordert, was dazu führen kann, dass sie den Patienten meiden oder die Wahrheit aus Schutzbedürfnis verheimlichen wollen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Wahrheit am Krankenbett. Besteht eine Pflicht zur Aufklärung bei Sterbenden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1133499