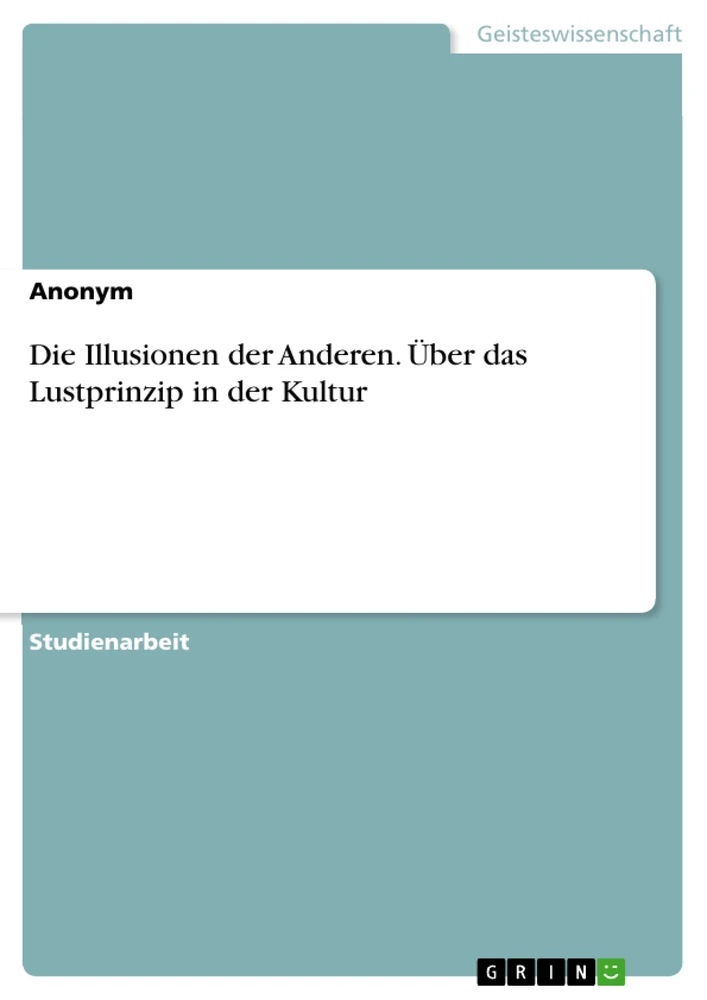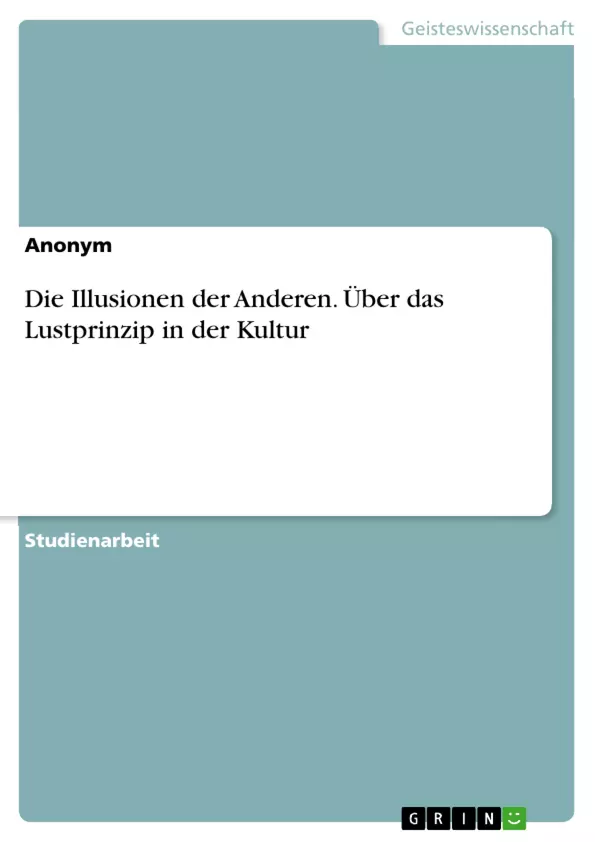Dieses Projekt soll die Interpassivität der Gesellschaft untersuchen. Interpassivität beschreibt dabei die Praxis, eigene Gefühle an fremden Menschen oder Gütern festzumachen. Hauptbezugspunkt dieser Arbeit in dieser Hinsicht ist deshalb der Konsum.
Konsum war schon immer Objekt des Argwohns und Anlass zur Sorge um das geistige Wohl des Menschen und die Verfassung der Gesellschaft: von der alttestamentarischen Verteuflung der Gier bis zu den frühneuzeitlichen Luxussteuern und Luxusgesetzen. Vom bürgerlichen Ressentiment gegen die Dekadenz der Aristokratie und der Sorge um die Disziplin der Arbeiter bis zur Revitalisierung des Gebrauchswerts und des Sparsamkeitsideals in den technokratischen Planungsvisionen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Von der Kritik an der Standardisierung der Kultur und des Menschen durch den Massenkonsum bis zur jener an den psychischen und ökologischen Folgen der Überflussgesellschaft und der Wachstumsideologie. Trotz dieser anscheinend tief sitzenden Skepsis gegenüber den angeblichen moralischen und sozialen Implikationen des Konsums, entwickelte sich dieser im 20. Jahrhundert zur Triebkraft der kapitalistischen Entwicklung und Quelle der ökonomischen Prosperität.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Ziele
- Konsumismus
- Konsumismus im Fordismus
- Fordistischen Konsumnorm
- Interpassivität als Kritik
- Forschung
- Interview
- Ausstellung
- Wunderkammer
- Schlussbetrachtung
- Reflektion
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Interpassivität der Gesellschaft und dem Einfluss des Konsumkapitalismus auf die Wahrnehmung und das Streben nach Lust. Das Projekt zielt darauf ab, die Problematik der konsumkapitalistischen Güter erfahrbar zu machen und ein Objekt für die diesjährige "Wunderkammer" der Werkschau zu entwickeln.
- Interpassivität und Konsum im Kontext der Kultur
- Der Einfluss des Konsumkapitalismus auf die Gestaltung von Bedürfnissen und Wünschen
- Die Rolle von Werbung und Marketing im fordistischen Konsummodell
- Die Entstehung von Gegenkulturen und kritischem Konsum
- Die Problematik der Standardisierung und Uniformierung in der Massenkultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung beleuchtet die Problemstellung und Ziele der Seminararbeit. Sie stellt die Interpassivität als ein zentrales Konzept dar und erklärt, wie diese durch die ästhetische Wahrnehmbarkeit des persönlichen Stils zur sozialen Tatsache wird.
Das Kapitel "Konsumismus" analysiert den Konsum als Triebkraft der kapitalistischen Entwicklung und stellt den Fordismus als ein Modell vor, in dem die Verbindung zwischen Produktionszuwachs und Kaufkraftförderung hergestellt wird. Dabei wird die Bedeutung der fordistischen Konsumnorm sowie die Entstehung eines konsumistischen Subjekts hervorgehoben.
Das Kapitel "Forschung" skizziert die Methoden, die zur Untersuchung des Konsumismus und der Interpassivität verwendet werden. Die Forschungsmethoden beinhalten Interviews, Ausstellungen und die Entwicklung eines Objekts für die "Wunderkammer".
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Interpassivität" im Kontext der Gesellschaft?
Interpassivität beschreibt die Praxis, eigene Gefühle oder Genuss an andere Menschen oder Objekte zu delegieren. Im Konsum zeigt sich dies oft dadurch, dass Güter stellvertretend für den Besitzer "genießen".
Wie beeinflusst der Konsumkapitalismus unsere Bedürfnisse?
Der Konsumkapitalismus, insbesondere im Fordismus, koppelt Produktionszuwachs an Kaufkraftförderung und formt so ein konsumistisches Subjekt, dessen Wünsche durch Marketing und Werbung gestaltet werden.
Was ist das Lustprinzip in der Kultur?
Die Arbeit untersucht, wie das Streben nach Lust in einer Überflussgesellschaft standardisiert und uniformiert wird, was oft zu einer Skepsis gegenüber den moralischen Implikationen des Konsums führt.
Welche Rolle spielt der Fordismus für den Konsumismus?
Im Fordismus wurde Massenkonsum zur Triebkraft der Wirtschaft. Standardisierte Produkte und die Steigerung der Kaufkraft der Arbeiter schufen die Basis für die heutige Konsumgesellschaft.
Was ist das Ziel des Projekts "Wunderkammer"?
Das Projekt zielt darauf ab, die theoretischen Konzepte der Interpassivität und des Konsumismus durch ein physisches Objekt in einer Ausstellung erfahrbar und greifbar zu machen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die Illusionen der Anderen. Über das Lustprinzip in der Kultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1133501