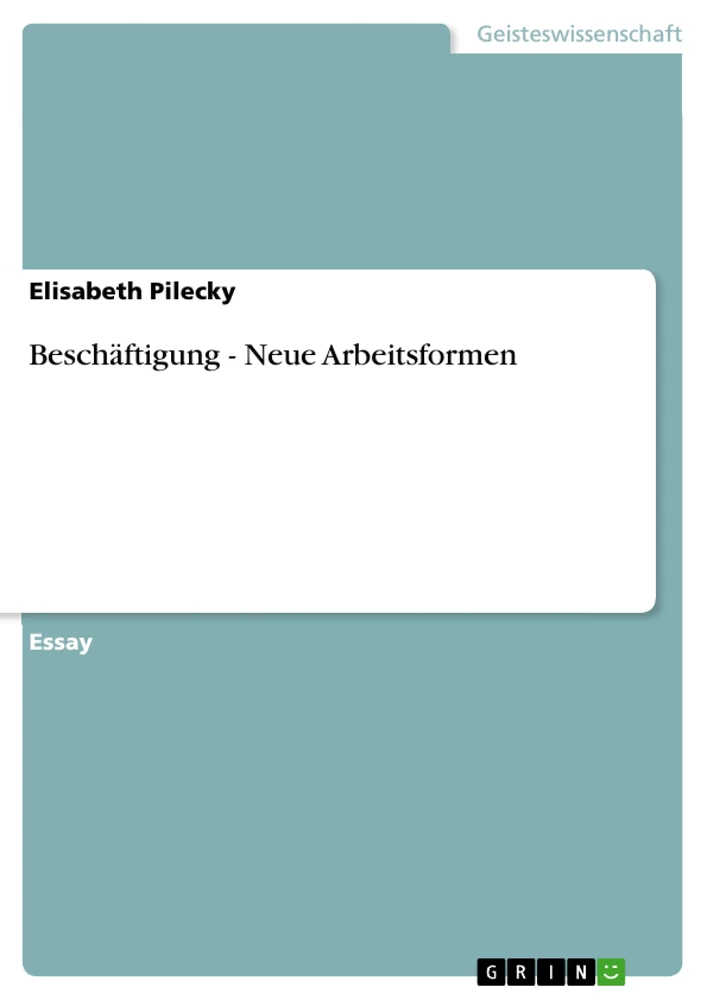Arbeit wird in der Physik als das Produkt von einwirkender Kraft und zurückgelegtem Weg definiert. Sie ist der Begriff für bewusstes und zielgerechtes Handeln von Menschen zum Zweck der Existenzsicherung sowie der Befriedigung von Bedürfnissen. Im Mittelhochdeutschen war „arebeit“ das Wort für Mühsal. (Schmid
1999)
Im Zentrum unseres Denkens steht die Arbeit. Sie ist die Grundlage unserer Existenzsicherung und schafft jene materiellen Werte, auf die unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Erwerbsarbeit ist aber nicht nur ein Mittel, um Einkommen und Einfluss
zu erlangen, sondern sie ermöglicht vor allem die gesellschaftliche Teilhabe. Sie ist eine wesentliche Quelle von Anerkennung und Selbstverwirklichung. (Sallmutter
1999)
Wo Erwerbsarbeit in einer Gesellschaft, deren Werte darauf aufgebaut sind, schwindet, verschwindet auch die Teilhabe und zerbricht dadurch der gesellschaftliche Zusammenhalt. Jahoda und Lazarsfeld haben diesen Prozess in ihrer Sozialstudie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ eindrucksvoll dargelegt.
Vollbeschäftigung hat in unserer Gesellschaft nach wie vor einen hohen Stellenwert. In den letzten Jahren hat es jedoch zunehmende Veränderungen auf dem Arbeitsmarktes gegeben. Der grundlegende Baustein unserer Erwerbsgesellschaft ist nach wie vor der Normalarbeitstag. Er bestimmt das Einkommen und den Wohlstand
der Erwerbstätigen und auch die Leistungen des Sozialstaates orientieren sich an dieser „männlichen Normalerwerbsbiographie“. (Schmid 1999)
Ein Normalarbeitsverhältnis definiert sich wie folgt:
• Vollzeitarbeitsverhältnis mit einer Wochenarbeitszeit zwischen 36 und 40 Stunden
• Normalarbeitstag von 8 Stunden, 5-Tagewoche, Arbeitsbeginn zwischen 6.00 und 9.00 Uhr, Arbeitsende zwischen 14.00 und 18.00
• Arbeitsvergütung in monatlichen Beträgen bezahlt
• Höhe der Vergütung und viele betriebliche Sozialleistungen hängen von der Qualifikation und der Dauer der Betriebszugehörigkeit ab
• gewisser Schutz: z.B. Kündigungsfristen, Abfertigungen, pragmatisiertes Beschäftigungsverhältnis z.B. Öffentlicher Dienst, Sozialpläne bei Massenentlassungen, usw.
• Gehälter, Löhne und Arbeitsbedingungen sind kollektivvertraglich geregelt
Inhaltsverzeichnis
- Welche Bedeutung hat Arbeit in unserer Gesellschaft?
- Ist die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse ein Mittel gegen die hohe Arbeitslosigkeit?
- Beispiel Niederlande
- Beispiel USA
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung von Arbeit in unserer Gesellschaft und analysiert die Auswirkungen neuer Arbeitsformen auf die Beschäftigungssituation. Im Fokus stehen dabei die Entwicklungen in Richtung Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse sowie die Frage, ob diese Entwicklungen tatsächlich zu einer Reduzierung der Arbeitslosigkeit führen.
- Bedeutung von Arbeit für die Gesellschaft
- Entwicklung neuer Arbeitsformen
- Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse
- Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation
- Kritik an neoliberalen Arbeitsmarktmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Welche Bedeutung hat Arbeit in unserer Gesellschaft?
Die Arbeit wird als Grundlage für die Existenzsicherung und die Schaffung materieller Werte betrachtet. Sie ermöglicht die gesellschaftliche Teilhabe und ist eine wesentliche Quelle von Anerkennung und Selbstverwirklichung. Die Arbeit ist eng mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt verbunden, und ein Schwinden der Erwerbsarbeit führt zu einem Zerbrechen dieses Zusammenhalts.
- Ist die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse ein Mittel gegen die hohe Arbeitslosigkeit?
Die EU kämpft seit über 20 Jahren mit anhaltender Massenarbeitslosigkeit. Neoliberale Ansätze sehen die Lösung in einer Umgestaltung des Arbeitsmarktes durch Lohnverzicht, Teilzeitarbeit und flexiblere Arbeitsverhältnisse. Die These, dass niedrigere Löhne zu mehr Beschäftigung führen, wird anhand der USA und der Niederlande als Beispiel angeführt. Allerdings wird dabei die hohe Arbeitslosenrate in Spanien, trotz niedriger Löhne, nicht berücksichtigt.
- Beispiel Niederlande
Das niederländische „Poldermodell" wird als Vorzeigemodell für den Abbau der Arbeitslosigkeit gehandelt. Es zeichnet sich durch die Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung, die Flexibilisierung der Arbeit, ein hohes Ausmaß an Zeitarbeitsunternehmen und eine mäßige Lohnpolitik aus. Die Niederlande konnten die Arbeitslosigkeit deutlich reduzieren, jedoch ist die Teilzeitarbeit zum Kennzeichen von Frauenarbeit geworden. Die negativen Folgen der atypischen Beschäftigungsformen, wie geringeres Einkommen, kaum Aufstiegsmöglichkeiten und unsichere Arbeitszeiten, werden kaum wahrgenommen. Die Langzeitarbeitslosenrate und die Anzahl der Personen, die von der Invalidenrente leben, sind in den Niederlanden europaweit am höchsten.
- Beispiel USA
Die USA weisen in den 90er Jahren deutlich sinkende Arbeitslosenquoten auf. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit dem lang anhaltenden wirtschaftlichen Boom in den USA. Die Arbeitslosenquote ist jedoch nicht nur durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze gesunken, sondern auch durch eine Zunahme der Teilzeitarbeit und der prekären Beschäftigungsverhältnisse.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Bedeutung von Arbeit in der Gesellschaft, die Entwicklung neuer Arbeitsformen, die Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, die Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation, die Kritik an neoliberalen Arbeitsmarktmodellen, die Arbeitslosigkeit, das Poldermodell, die Teilzeitarbeit, die Arbeitsbedingungen und die gesellschaftliche Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem Normalarbeitsverhältnis?
Ein Normalarbeitsverhältnis definiert sich durch eine Vollzeitbeschäftigung (36–40 Stunden), einen geregelten 8-Stunden-Tag in einer 5-Tage-Woche, kollektivvertraglich geregelte Entlohnung sowie Kündigungsschutz.
Welche Bedeutung hat Erwerbsarbeit für die gesellschaftliche Teilhabe?
Erwerbsarbeit dient nicht nur der Existenzsicherung, sondern ist eine wesentliche Quelle für Anerkennung, Selbstverwirklichung und ermöglicht die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Was ist das niederländische „Poldermodell“?
Das Poldermodell ist ein Vorzeigemodell zum Abbau von Arbeitslosigkeit durch massive Ausweitung von Teilzeitarbeit, Flexibilisierung und eine mäßige Lohnpolitik.
Welche Kritikpunkte gibt es an atypischen Beschäftigungsformen?
Kritisiert werden oft geringere Einkommen, fehlende Aufstiegsmöglichkeiten, unsichere Arbeitszeiten und eine mangelhafte soziale Absicherung.
Wie hat sich die Arbeitslosigkeit in den USA in den 90er Jahren entwickelt?
In den 90er Jahren sanken die Arbeitslosenquoten in den USA aufgrund eines wirtschaftlichen Booms, aber auch durch eine Zunahme prekärer und Teilzeit-Beschäftigungsverhältnisse.
- Citar trabajo
- Mag. (FH) Elisabeth Pilecky (Autor), 2005, Beschäftigung - Neue Arbeitsformen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113357