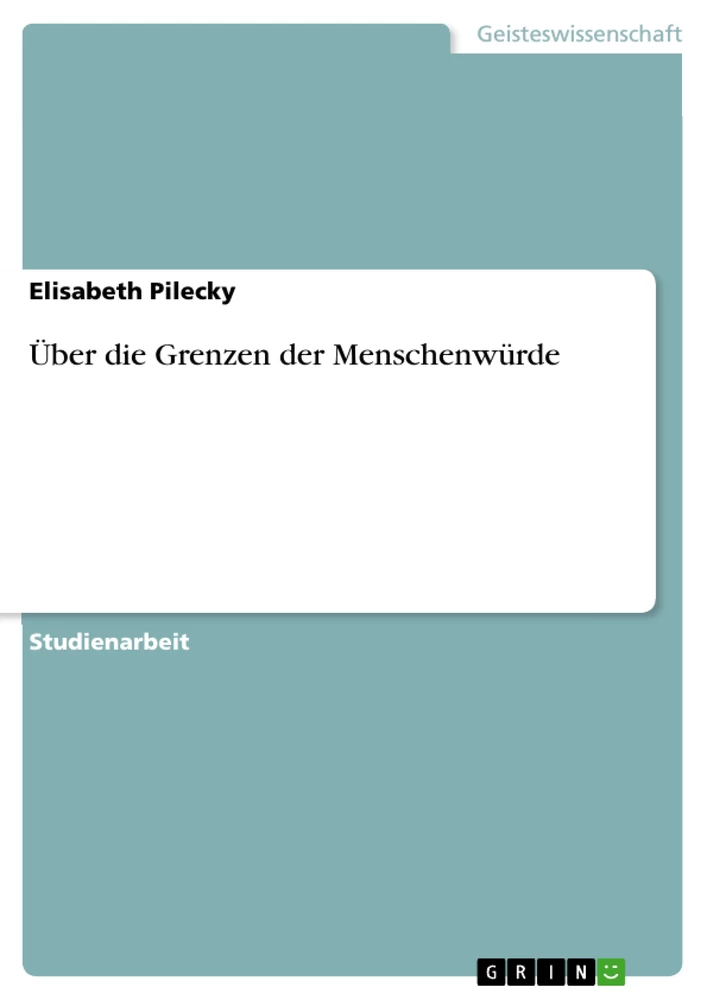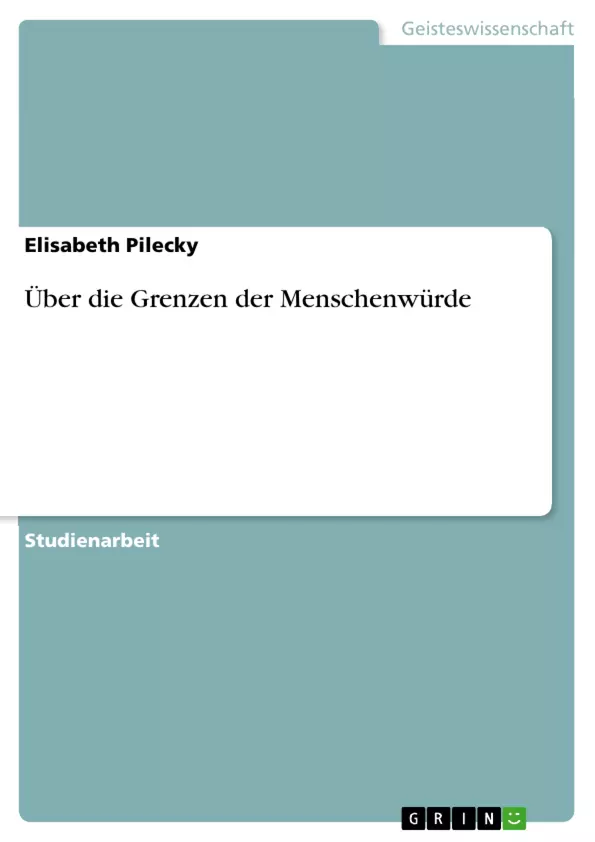In der Projektarbeit „Social work goes public“, an der ich teilgenommen habe, bestand ein Teil unserer Arbeit aus der Erhebung des Selbstbildes der Sozialarbeit in Theorie und Praxis. Wir stellten fest, dass sich Sozialarbeit gerne als „Menschenrechtsprofession“ bezeichnet, als „Anwalt für Randgruppen“, die von dem Umstand bedroht sind, die Teilhabe an unserer Gesellschaft zu verlieren. Die Position der Sozialarbeit im Spannungsfeld zwischen KlientIn und Institution führt sehr häufig zu Interessenskonflikten. Sozialarbeit unterliegt fast immer dem „Doppelten Mandat“: Die Interessen und die Menschenwürde des Klienten / der Klientin müssen gewahrt werden, gleichzeitig muss aber auch der Auftrag der Institution, der Gesellschaft erfüllt werden. Ein Umstand, der oft deutlich in Abgrenzung zu anderen Berufen, die ebenfalls im Bereich Sozialer Arbeit tätig sind steht. Weiters behindert der herrschende Trend des Neoliberalismus in der Sozialpolitik sehr nachhaltig die Tätigkeit der Sozialarbeit. (Projekt „Social work goes public“ 2005/06: 9)
Durch die Lektüre des Textes von Matthias Kettner „Über die Grenzen der Menschenwürde“ ist mir bewusst geworden, dass der Aspekt der Wahrung der Menschenrechte nur ein Teil, die in der Praxis und in den Medien sichtbare „Spitze eines Eisberges“ ist. Grundsätzlich geht es hier eigentlich um den Begriff und die Rolle der Menschenwürde, und „dass jeder Mensch Träger dieser Würde ist, unabhängig von seinen möglichen spezifischen Eigenschaften oder Defiziten, dass sich niemand über einen anderen erheben darf, ... dass Menschen immer Träger gleicher Rechte sind.“ (Kettner 2004: 292).
Der Autor untersucht in den ersten beiden Kapiteln, ob die Rolle des Menschenwürdebegriffes anhand der Rechts- bzw. der Sozialphilosophie erklärt werden kann. Die historische Erfahrung systematischer Menschenrechtsverletzungen besonders während des Nationalsozialismus führte dazu, dass die Verpflichtung zur Achtung der Menschenwürde als ein tragender Grund der Menschenrechte zur obersten Rechtsnorm des deutschen Grundgesetzes wurde: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt.“ (Art. 1 Abs. 1 GG) Auch in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen ist die Menschenwürde Bezugspunkt der Menschrechtsbegründung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Menschenwürde im Rechtsdiskurs
- Menschenwürde im sozialphilosophischen Diskurs
- Menschenwürde im Diskurs der Ethik
- Moralreflektive Erklärung der Menschwürde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Rolle des Menschenwürdebegriffes und seine Relevanz in verschiedenen Diskursen, insbesondere in der Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie und Ethik. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs sowie aktuelle Debatten und Herausforderungen, die sich im Kontext des biowissenschaftlichen Fortschritts ergeben.
- Der Begriff der Menschenwürde als Rechtfertigungsgrund für Menschenrechte
- Die Frage nach der sozialen Konstruktion von Menschenwürde
- Der moralische Status der Menschenwürde als Grundlage für eine moralische Rücksichtnahme
- Die Anwendung des Menschenwürdebegriffs in der biomedizinischen Ethik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit untersucht die Rolle des Menschenwürdebegriffes in der Sozialarbeit und setzt diesen in Beziehung zu den Herausforderungen der Menschenrechtsprofession im Spannungsfeld zwischen Klient und Institution.
- Menschenwürde im Rechtsdiskurs: Das Kapitel analysiert die historische Entwicklung des Menschenwürdebegriffes im Kontext der Menschenrechtsverletzungen des Nationalsozialismus und betrachtet den Einfluss des Grundgesetzes auf die Rechtskultur. Die Arbeit hinterfragt jedoch, ob der Begriff der Menschenwürde allein aus der Rechtsnorm ableitbar ist.
- Menschenwürde im sozialphilosophischen Diskurs: Das Kapitel beleuchtet die Frage nach der sozialen Konstruktion von Menschenwürde und setzt sich kritisch mit der Theorie von Reiner Anselm auseinander, der Menschenwürde als ein soziales Konstrukt begreift. Der Autor betont die Notwendigkeit einer universellen und willkürfreien Zuschreibung von Menschenwürde.
- Menschenwürde im Diskurs der Ethik: Das Kapitel beschreibt die moralische Idee der Menschenwürde mit negativen Begriffsbestimmungen wie Nichtwillkürlichkeit und Nichtpartikularisierbarkeit. Der Autor argumentiert, dass Menschenwürde als moralischer Status und nicht als Pflicht, Norm oder Prinzip verstanden werden sollte.
Schlüsselwörter
Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtssystem, Sozialphilosophie, Ethik, Moral, biowissenschaftlicher Fortschritt, biomedizinische Ethik, Präimplantationsdiagnostik, Moralobjekt, Moralsubjekt, Statusverleihen.
- Quote paper
- Mag. (FH) Elisabeth Pilecky (Author), 2007, Über die Grenzen der Menschenwürde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113361