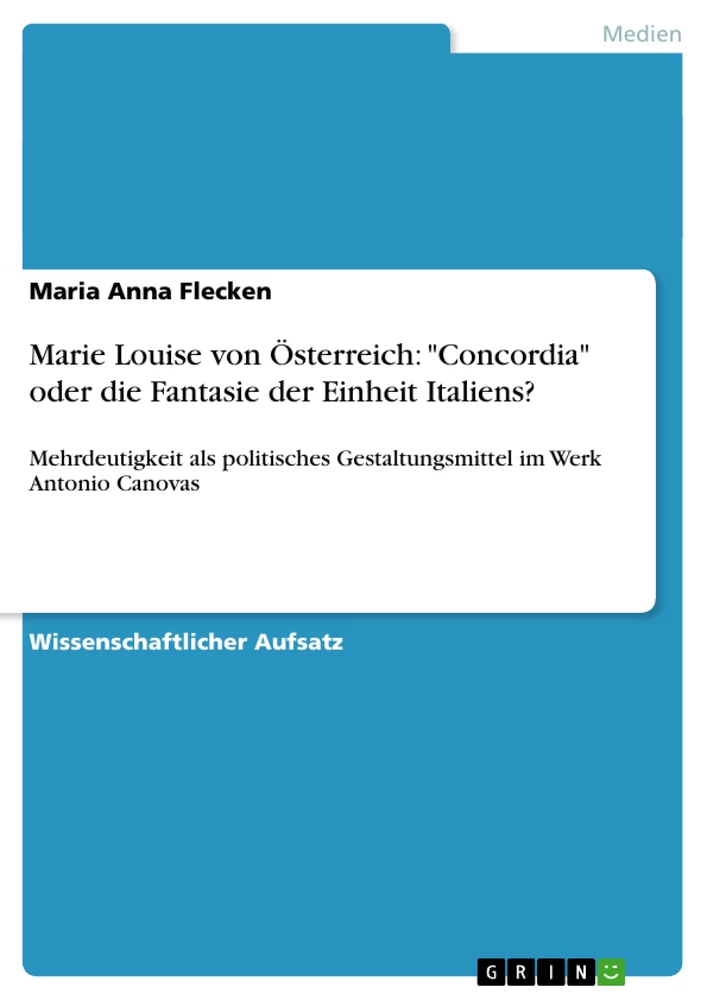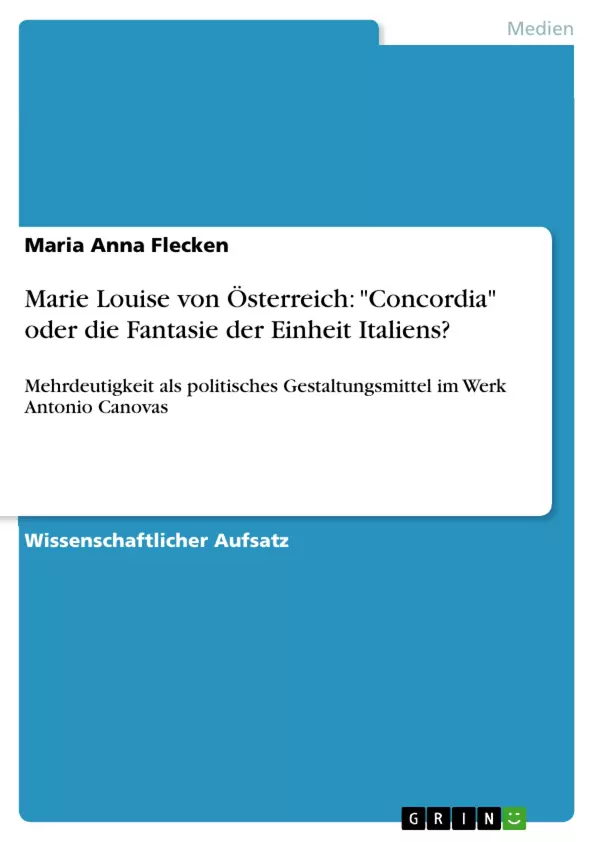Der italienische Bildhauer Antonio Canova (1757-1822) ist lange als eine unpolitische Figur betrachtet worden. Diese traditionelle Sichtweise musste längst revidiert werden, denn die A-nalyse einer Vielzahl von Quellen enthüllt, dass der Künstler sehr wohl ein politisches Be-wusstsein besaß, wie vor allem auch seine 1810 von Napoleon Bonaparte in Auftrag gegebene Statue der Marie Louise von Österreich (Abb. 1) beweist. Das Werk ist eng mit den Ideen und Ansichten Canovas und der turbulenten Zeit, in der er das Kunstwerk ausführte, zu sehen. Nur wenige Monate vor der Auftragsvergabe der Statue an den italienischen Bildhauer hatte die Prokuratrauung zwischen Napoleon und der österreichischen Kaisertochter Marie Louise am 11. März 1810 in der Augustinerkirche in Wien stattgefunden. Erzherzog Karl vertrat in Abwesenheit Napoleons den einstigen Gegner. Der Kaiser selbst traf erst am 27. März bei Compiègne mit seiner neuen Gemahlin zusammen. Am 1. April wurde in St. Cloud die Zivil-ehe geschlossen, am Tag darauf in der Kapelle des Louvre die kirchliche Trauung vollzogen. Die Erzherzogin von Österreich wurde die Frau des Mannes, den sie wenige Wochen zuvor noch gehasst und verachtet hatte. Noch zu Beginn des Jahres 1810 schrieb sie an die Gräfin Colloredo: "... ich werde gewiß nicht das Opfer der Politik sein!" Und doch sollte gerade sie das Opfer sein, das ihr Vater, Franz I., Kaiser von Österreich, der Politik schuldig zu sein glaubte. Denn er und sein Minister Metternich sahen in einer Familienverbindung mit dem Kaiser der Franzosen eine Stütze zur Erhaltung des Reiches. Marie Louise sollte die Frau des "Bonaparte", des "Korsen", des "Antichrists", des Schreckgespenstes ihrer eigenen Kindheit werden. Metternich hatte bereits seit 1807 eine Heirat des Hauses Habsburg mit Napoleon ins Au-ge gefasst. Er verfolgte den Plan, ein gutes Verhältnis zwischen Österreich und Frankreich zu schaffen, um für den tief erschütterten Staat eine Ruhepause für den Wiederaufbau zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Marie Louise von Österreich (Biografie)
- II. Die Genese der Statue der „Concordia“
- III. Die „Concordia“ als Spiegelbild der Charaktereigenschaften Marie Louises und als Spiegelbild geschichtlicher Zusammenhänge
- IV. Überlegungen zu möglichen Vorbildern zur Statue der „Concordia“
- 1.1. Marie Louise - eine Annäherung an Juno
- 1.2. Die Marmorstatuette der „Tellus“ („Terra Mater“) als mögliches Vorbild für die „Concordia“
- 2.1. Canovas „Italia-Begriff“, dargelegt am Beispiel des „Alfieri“-Monuments von 1806-10
- 2.2. Marie Louise von Österreich als Symbol für ein vereintes und unabhängiges Italien
- V. Abbildungsnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Statue der „Concordia“, geschaffen von Antonio Canova für Marie Louise von Österreich. Ziel ist es, die politische Dimension des Werkes aufzuzeigen und Canovas künstlerische Gestaltung im Kontext der historischen Ereignisse zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die vielschichtigen Bedeutungen der Statue und deren Funktion als politisches Gestaltungsmittel.
- Die Biografie Marie Louises von Österreich und ihre Rolle im napoleonischen Kontext.
- Die Entstehung der „Concordia“-Statue und Canovas künstlerische Intentionen.
- Die „Concordia“ als Symbol für Einheit und politische Stabilität.
- Mögliche Vorbilder und ikonografische Bezüge der Statue.
- Die politische Symbolik der Statue im Kontext der italienischen Einheitsidee.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Marie Louise von Österreich (Biografie): Dieses Kapitel zeichnet die Biografie von Marie Louise von Österreich nach, mit Fokus auf ihren politischen Kontext und ihrer Hochzeit mit Napoleon Bonaparte. Es wird die schwierige Situation Marie Louises dargestellt – gezwungen in eine politische Heirat mit einem Mann, den sie zunächst verachtete – und wie diese Ehe in den geopolitischen Strategien Österreichs und Frankreichs wurzelte. Die Kapitel analysiert die Motive beider Seiten, die strategischen Erwägungen hinter der Verbindung und die Konsequenzen für Marie Louise, die sowohl Opfer als auch Werkzeug der politischen Machtspiele wurde. Die Beschreibung ihres Lebens bis zur Trennung von Napoleon zeigt sie als Frau zwischen verschiedenen politischen Mächten und ihren damit verbundenen Zwängen und Herausforderungen.
II. Die Genese der Statue der „Concordia“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung der "Concordia"-Statue. Es untersucht den Auftrag Napoleons an Canova, die politischen und künstlerischen Hintergründe und den Entstehungsprozess des Kunstwerks. Die Analyse beleuchtet den historischen Kontext, die zeitgenössische politische Landschaft und die künstlerische Entwicklung der Statue. Die Arbeit diskutiert die Auswahl des Marmors, die künstlerischen Entscheidungen des Bildhauers, und die Bedeutung des Werks in Bezug auf den politischen Kontext der Zeit. Dabei wird die enge Verbindung zwischen der Entstehung der Statue und den politischen Ereignissen dieser Epoche hervorgehoben.
III. Die „Concordia“ als Spiegelbild der Charaktereigenschaften Marie Louises und als Spiegelbild geschichtlicher Zusammenhänge: Dieses Kapitel analysiert die „Concordia“-Statue im Hinblick auf ihre doppelte Bedeutung als Spiegelbild der Persönlichkeit Marie Louises und als Repräsentation historischer Zusammenhänge. Es untersucht, wie die Statue sowohl die Eigenschaften der Kaiserin, wie z.B. ihre Rolle als Vermittlerin zwischen gegnerischen Mächten, wiederspiegelt, als auch die politische Situation ihrer Zeit interpretiert. Die Analyse beleuchtet, wie künstlerische Mittel und ikonografische Elemente verwendet werden, um die komplexe politische und soziale Wirklichkeit darzustellen. Das Kapitel verknüpft die individuellen Eigenschaften Marie Louises mit größeren geschichtlichen Prozessen und ihren Einfluss auf die Interpretation des Kunstwerks.
IV. Überlegungen zu möglichen Vorbildern zur Statue der „Concordia“: Das Kapitel erforscht potentielle Vorbilder und Einflüsse auf Canovas Gestaltung der „Concordia“-Statue. Es untersucht mögliche Verbindungen zu anderen Kunstwerken, insbesondere zur Figur der Juno und der „Tellus“-Statuette. Die Analyse fokussiert auf ikonografische Parallelen und die Rolle von klassischen Motiven in Canovas Werk. Des Weiteren wird Canovas "Italia-Begriff" beleuchtet und anhand des "Alfieri"-Monuments näher betrachtet, um mögliche Beziehungen zur Darstellung Marie Louises als Symbol für ein geeintes Italien aufzuzeigen. Das Kapitel verwebt kunstgeschichtliche Forschung mit der Analyse der politischen und kulturellen Kontexte, um den Ursprung und die Bedeutung der ikonografischen Entscheidungen Canovas zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Marie Louise von Österreich, Antonio Canova, Concordia, Napoleon Bonaparte, politische Symbolik, Italienische Einheit, Klassizismus, Ikonografie, Heiratspolitik, politische Propaganda, Marmorstatue.
Häufig gestellte Fragen zur Studie: "Die Concordia-Statue von Antonio Canova und Marie Louise von Österreich"
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studie analysiert die von Antonio Canova für Marie Louise von Österreich geschaffene Statue der „Concordia“. Im Mittelpunkt stehen die politische Dimension des Kunstwerks, Canovas künstlerische Gestaltung im historischen Kontext und die vielschichtigen Bedeutungen der Statue als politisches Gestaltungsmittel.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie umfasst die Biografie Marie Louises von Österreich und ihre Rolle im napoleonischen Kontext, die Entstehung der „Concordia“-Statue und Canovas Intentionen, die „Concordia“ als Symbol für Einheit und politische Stabilität, mögliche Vorbilder und ikonografische Bezüge der Statue sowie die politische Symbolik der Statue im Kontext der italienischen Einheitsidee.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Marie Louise von Österreich (Biografie); 2. Die Genese der Statue der „Concordia“; 3. Die „Concordia“ als Spiegelbild der Charaktereigenschaften Marie Louises und als Spiegelbild geschichtlicher Zusammenhänge; 4. Überlegungen zu möglichen Vorbildern zur Statue der „Concordia“; und 5. Abbildungsnachweis.
Was wird im Kapitel über die Biografie Marie Louises behandelt?
Dieses Kapitel zeichnet die Biografie Marie Louises nach, konzentriert sich auf ihren politischen Kontext und ihre Ehe mit Napoleon. Es analysiert die strategischen Erwägungen hinter der Ehe und die Konsequenzen für Marie Louise als Opfer und Werkzeug politischer Machtspiele.
Was wird im Kapitel über die Genese der Concordia-Statue behandelt?
Dieses Kapitel untersucht den Auftrag Napoleons an Canova, die politischen und künstlerischen Hintergründe und den Entstehungsprozess der Statue. Es beleuchtet den historischen Kontext, die künstlerische Entwicklung und die Bedeutung des Werks im Bezug auf die politische Situation der Zeit.
Was wird im Kapitel über die Concordia als Spiegelbild von Marie Louise und der Geschichte behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die doppelte Bedeutung der Statue: als Spiegelbild von Marie Louises Persönlichkeit und als Repräsentation historischer Zusammenhänge. Es untersucht, wie die Statue Eigenschaften der Kaiserin und die politische Situation ihrer Zeit interpretiert.
Was wird im Kapitel über mögliche Vorbilder der Concordia-Statue behandelt?
Dieses Kapitel erforscht potentielle Vorbilder und Einflüsse auf Canovas Gestaltung, insbesondere Verbindungen zur Figur der Juno und der „Tellus“-Statuette. Es analysiert ikonografische Parallelen und die Rolle klassischer Motive. Weiterhin wird Canovas "Italia-Begriff" und das "Alfieri"-Monument im Hinblick auf mögliche Beziehungen zur Darstellung Marie Louises als Symbol für ein geeintes Italien untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind mit der Studie verbunden?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Marie Louise von Österreich, Antonio Canova, Concordia, Napoleon Bonaparte, politische Symbolik, Italienische Einheit, Klassizismus, Ikonografie, Heiratspolitik, politische Propaganda, Marmorstatue.
- Arbeit zitieren
- Dr. Maria Anna Flecken (Autor:in), 2008, Marie Louise von Österreich: "Concordia" oder die Fantasie der Einheit Italiens?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113432