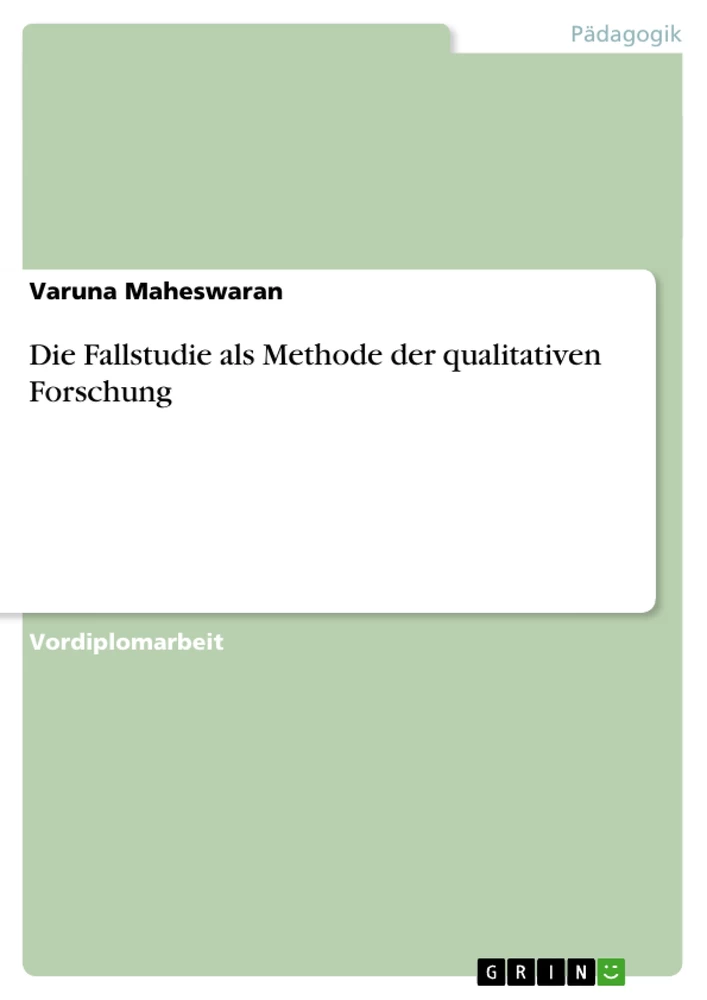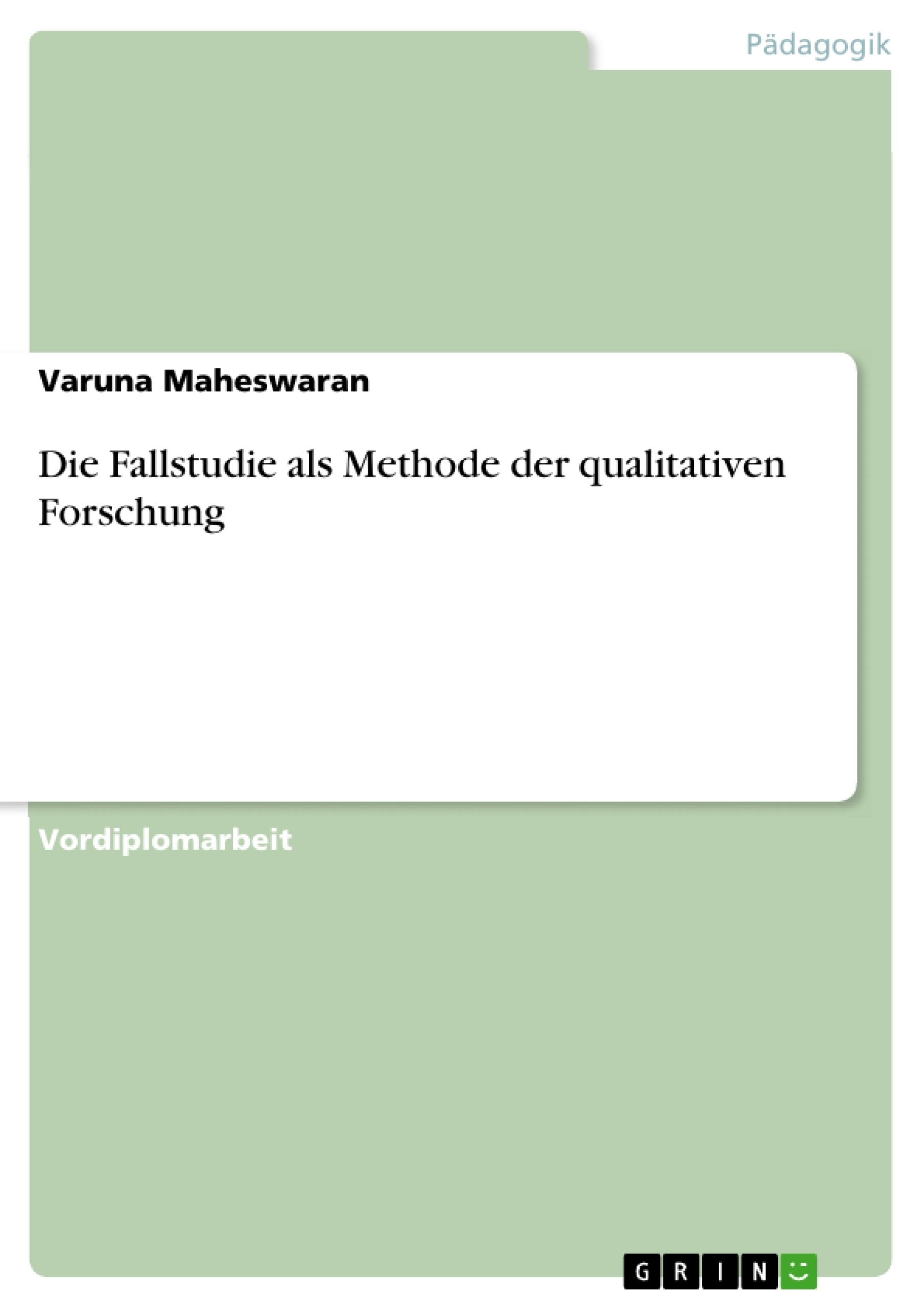Fallstudien zählen in der Erziehungswissenschaft zu den beliebtesten Methoden der qualitativen Forschung. Besonders ihr offener Zugang zur Alltagswelt bzw. die Möglichkeit zur unverfälschten Erfassung der sozialen Realität macht ihren besonderen Charakter aus. Dennoch ist die Fallstudie eine relativ „junge“ Erhebungstechnik. Wie sie ihren Einzug in die Methodik der qualitativen Forschung fand wird zunächst in einem kurzen historischen Rückblick erläutert. Ferner wird erklärt, wie es überhaupt zur Hinwendung zu Fallstudien kam. „Fälle“ im eigentlichen Sinne existieren ja schon seit geraumer Zeit. Es gab aber bestimmte Faktoren bzw. Kritikpunkte in der gängigen qualitativen Forschung, welche die Hinwendung und schließlich die Etablierung der Fallstudie in die Erziehungswissenschaft auslösten. Diese Punkte werden kurz beschrieben.
Laut Siegfried Lamnek ist die Fallstudie keine isolierte Erhebungsmethode, sondern ein Forschungsansatz, ein „approach“, der sich verschiedener Methoden der qualitativen Forschung bedient. Diese „Methoden“ der Fallstudie werden anhand der „Marienthalstudie“ erläutert. Diese bietet nämlich durch ihre breit gefächerte Methodenvielfalt einen guten Überblick über die Vielzahl der Möglichkeiten und vor allem einen detaillierten Einblick in deren Zusammenwirken.
Im Hauptteil liegt das Augenmerk auf der genauen Vorgehensweise bei der Bearbeitung eines konkreten Falles. Dabei habe ich einen Fall aus dem sozialpädagogischen Bereich gewählt, der als Beispiel für die Ausführungen und zur näheren Erläuterung dienen soll. Dem Hauptteil liegt vor allem das Buch „Sozialpädagogisches Können“ von Burkhard Müller zugrunde, der in seinem Werk ein Rahmenangebot für Fallbearbeitungen bietet.
Zum Schluss habe ich einen Fall in Bezug auf die im Hauptteil beschriebenen Punkte bearbeitet. Dabei wird noch mal verdeutlicht, dass die Erläuterungen und angebotenen Vorgehensweisen bei der Analyse eines Falles nur als eine Art Hilfestellung aufzufassen sind. Die Vielseitigkeit von Fällen macht allgemeingültige Vorgehensvorschriften in Form eines Buches unmöglich. Demnach ist meine Bearbeitung des Falles „die Nikolaus- Geschenkaktion“ nur angelehnt an die Ausführungen im Hauptteil.
Im Schlusswort habe ich noch einige Kritikpunkte der Fallstudie aufgegriffen und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Rückblick
- Warum Fallstudien?
- Was ist „die Fallstudie“?
- Methoden der Datenerhebung in der Fallstudie
- Fallanalyse
- Fall von, Fall für, Fall mit
- Anamnese, Diagnose, Intervention
- Analyse einer Fallgeschichte
- Der Fall: Die Nikolaus-Geschenkaktion
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, die Methode der Fallstudie in der Erziehungswissenschaft zu erläutern und anhand eines Beispiels zu veranschaulichen. Es wird der historische Kontext der Fallstudie beleuchtet, ihre Vorteile gegenüber anderen Forschungsmethoden aufgezeigt und die praktische Anwendung anhand eines konkreten Fallbeispiels demonstriert.
- Historische Entwicklung der Fallstudie in der Erziehungswissenschaft
- Methoden der Datenerhebung in der Fallstudie
- Anwendung der Fallstudie in der Sozialpädagogik
- Analyse eines konkreten Fallbeispiels
- Kritikpunkte und Limitationen der Fallstudie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Fallstudie in der Erziehungswissenschaft ein. Sie hebt die Bedeutung der Fallstudie als qualitative Forschungsmethode hervor, die einen offenen Zugang zur Alltagswelt ermöglicht und die soziale Realität unverfälscht erfasst. Es wird auf den historischen Einzug der Fallstudie in die Methodik der qualitativen Forschung eingegangen und die Gründe für ihre zunehmende Popularität erläutert. Die Einleitung dient als Überblick über den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den methodischen Ansatz, der im Hauptteil detailliert dargestellt wird.
Historischer Rückblick: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs „Fall“ und dessen Anwendung in verschiedenen Kontexten, von biblischen Geschichten bis hin zur praktischen Theologie. Der Fokus liegt auf dem späteren Einzug der Fallstudie in die Erziehungswissenschaft, insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren, beeinflusst durch die „case studies“ der Harvard Business School. Es wird die Kritik an herkömmlichen Forschungsmethoden hervorgehoben, die die Entwicklung und Akzeptanz der Fallstudie in der Pädagogik begünstigte. Das Kapitel beschreibt die anfängliche Zurückhaltung und spätere breite Akzeptanz dieser Methode in der Erziehungswissenschaft.
Warum Fallstudien?: Dieses Kapitel argumentiert für den Wert von Fallstudien in der Erziehungswissenschaft. Es betont den wichtigen Balanceakt zwischen Theorie und Praxis und die Rolle der Fallstudie als Methode zur Überprüfung und Forschung an der Praxis. Die Vorteile der Fallstudie liegen in ihrer Praxisnähe und Vielseitigkeit, die es ermöglicht, möglichst viele Dimensionen des Untersuchungsgegenstandes zu berücksichtigen. Der Abschnitt zitiert Abels/Lamnek, um die Bedeutung intensiver Fallstudien für Aussagen über konkrete Wirklichkeiten hervorzuheben.
Was ist „die Fallstudie“?: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Fallstudie als Konzentration der Untersuchung auf einen oder mehrere Fälle, um ein realistisches Bild der sozialen Wirklichkeit zu erzeugen. Es erläutert, dass der Fokus je nach Forschungsinteresse auf einer Person, Institution, Programm oder Ereignis liegen kann. Ein Beispiel wird gegeben: die Untersuchung eines Schülers mit Lernschwierigkeiten unter Berücksichtigung sozialer, institutioneller und individueller Faktoren.
Schlüsselwörter
Fallstudie, Qualitative Forschung, Erziehungswissenschaft, Sozialpädagogik, Methoden der Datenerhebung, Fallanalyse, Anamnese, Diagnose, Intervention, Praxisnähe, Theorie, Fallbeispiel, Nikolaus-Geschenkaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Fallstudie in der Erziehungswissenschaft
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über die Fallstudie als Forschungsmethode in der Erziehungswissenschaft. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Text erläutert die Methode der Fallstudie, ihren historischen Kontext, ihre Vorteile und Anwendung anhand eines konkreten Beispiels (Nikolaus-Geschenkaktion).
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Historischer Rückblick, Warum Fallstudien?, Was ist „die Fallstudie“?, Methoden der Datenerhebung in der Fallstudie, Fallanalyse (mit Unterkapiteln zu "Fall von, Fall für, Fall mit" und "Anamnese, Diagnose, Intervention"), Analyse einer Fallgeschichte, Der Fall: Die Nikolaus-Geschenkaktion und Schlusswort.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Der Text zielt darauf ab, die Methode der Fallstudie in der Erziehungswissenschaft zu erläutern und anhand eines Beispiels zu veranschaulichen. Es werden der historische Kontext beleuchtet, die Vorteile gegenüber anderen Forschungsmethoden aufgezeigt und die praktische Anwendung demonstriert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf der historischen Entwicklung der Fallstudie in der Erziehungswissenschaft, den Methoden der Datenerhebung, der Anwendung in der Sozialpädagogik, der Analyse eines konkreten Fallbeispiels und der kritischen Auseinandersetzung mit Limitationen der Methode.
Welche Vorteile bietet die Fallstudie laut dem Text?
Der Text betont die Praxisnähe und Vielseitigkeit der Fallstudie. Sie ermöglicht die Berücksichtigung vieler Dimensionen des Untersuchungsgegenstandes und erlaubt einen offenen Zugang zur Alltagswelt und eine unverfälschte Erfassung der sozialen Realität. Sie bietet einen wichtigen Balanceakt zwischen Theorie und Praxis.
Was wird unter „Fallstudie“ verstanden?
Eine Fallstudie konzentriert die Untersuchung auf einen oder mehrere Fälle, um ein realistisches Bild der sozialen Wirklichkeit zu erzeugen. Der Fokus kann auf einer Person, Institution, Programm oder Ereignis liegen.
Welche Methoden der Datenerhebung werden erwähnt?
Der Text erwähnt die Methoden der Datenerhebung in der Fallstudie, geht aber nicht im Detail darauf ein. Weitere Informationen hierzu müssten in den einzelnen Kapiteln des vollständigen Textes nachgelesen werden.
Welches Beispiel wird im Text verwendet?
Als Beispiel wird die „Nikolaus-Geschenkaktion“ verwendet, um die Anwendung der Fallstudie zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Fallstudie, Qualitative Forschung, Erziehungswissenschaft, Sozialpädagogik, Methoden der Datenerhebung, Fallanalyse, Anamnese, Diagnose, Intervention, Praxisnähe, Theorie, Fallbeispiel, Nikolaus-Geschenkaktion.
- Citation du texte
- Varuna Maheswaran (Auteur), 2005, Die Fallstudie als Methode der qualitativen Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113435