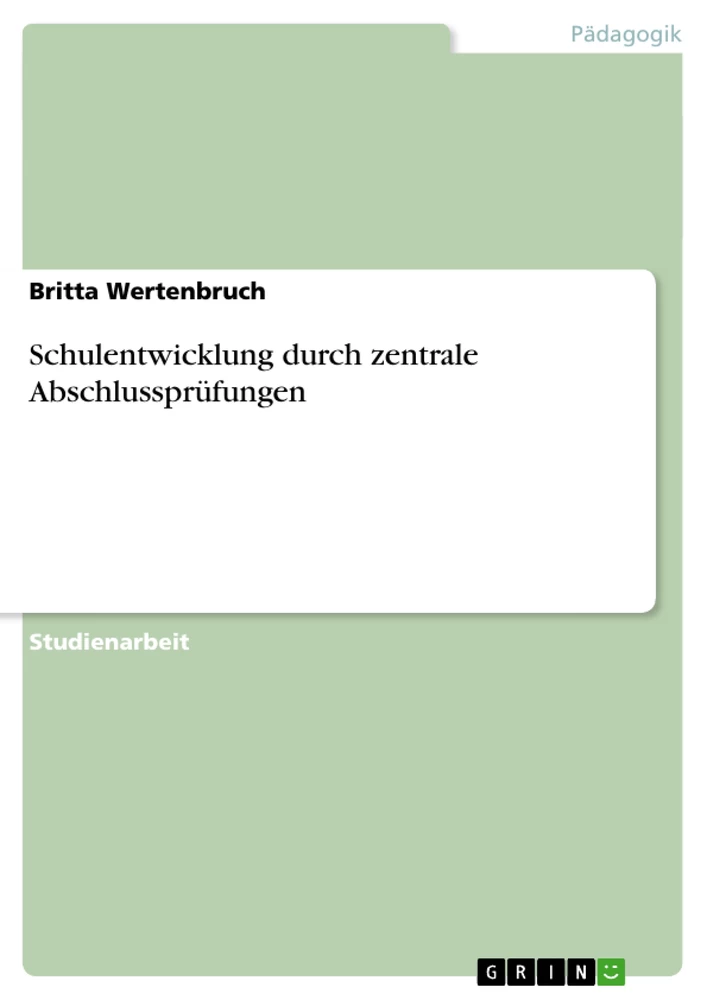Nachdem deutliche Unterschiede in einzelnen Schulen und zwischen den Schulen bei der Leistungsbeurteilung auftraten, Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien dem deutschen Bildungssystem mangelnde Qualität sowie fehlende Vergleichbarkeit schulischer Leistungsergebnisse aufzeigten, wurde der Ruf nach regelmäßiger zentraler Leistungsüberprüfung immer lauter. Bildungspolitische Maßnahmen sollen nun helfen, die aufgefallenen Missstände zu beheben. Gearbeitet wird dabei mit großflächigen Leistungsmessungen, die nicht mehr nur stichprobenartig angelegt sind, sondern einen mehr und mehr flächendeckenden Charakter bekommen und für alle Schülerinnen und Schüler (weiterhin: SuS) verbindlich sind. Zur Diskussion stehen vor allem folgende Formate: bundesdeutsche Schulen müssen sich in naher Zukunft nicht mehr nur mit schulintern praktizierten Parallelarbeiten auseinandersetzen, sondern ebenso mit sogenannten Vergleichsarbeiten bzw. Lernstandserhebungen sowie mit zentralen Abschlussprüfungen nach der Sekundarstufe I und II.
Gegenstand dieser Arbeit sind die als bildungspolitische Maßnahme auf die festgestellten Missstände in Deutschland eingeführten schullaufbahnabschließenden Evaluationsverfahren. Das erste Kapitel befasst sich zunächst mit den historischen und aktuellen Schubkräften für die Einführung von zentralen Abschlussprüfungen. Zunächst werden die chronologische Entwicklung bzw. deren Schubkräfte für die Einführung von zentralen Prüfungen erläutert, im Weiteren geklärt, wie es zur aktuellen Diskussion zur Einführung von zentralen Abschlussprüfungen gekommen ist und welche Faktoren dabei eine Rolle gespielt haben. Darüber hinaus wird zunächst allgemein und bundeslandübergreifend definiert, wie zentrale Abschlussprüfungen durchgeführt werden.
Das folgende Kapitel thematisiert exemplarisch an den vier Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Brandenburg und Schleswig-Holstein die Umsetzung des Zentralabiturs im jeweiligen Bundesland. Bei der Betrachtung der Praxis des Zentralabiturs in den einzelnen Bundesländern werden folgende Faktoren betrachtet: Welche Ziele setzen sich die einzelnen Bundesländer bei der Implementierung des Zentralabiturs?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische und aktuelle Schubkräfte für die Einführung von zentralen Abschlussprüfungen
- Das Zentralabiturs im Bundesländervergleich
- Nordrhein-Westfalen
- Hessen
- Brandenburg
- Schleswig-Holstein
- Resümee
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Einführung von zentralen Abschlussprüfungen als bildungspolitische Maßnahme zur Verbesserung der Schulqualität in Deutschland. Sie analysiert die historischen und aktuellen Schubkräfte, die zur Einführung dieser Prüfungen geführt haben, und beleuchtet die Umsetzung des Zentralabiturs in verschiedenen Bundesländern.
- Historische Entwicklung und aktuelle Diskussion um zentrale Abschlussprüfungen
- Ziele und Umsetzung des Zentralabiturs in verschiedenen Bundesländern
- Bewertung und Analyse der Prüfungen
- Transparenz und Informationsbereitstellung der Bundesländer
- Einfluss von zentralen Abschlussprüfungen auf die Schulentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Schulqualität und die Notwendigkeit von zentralen Abschlussprüfungen dar. Sie führt in die historische Entwicklung der Prüfungsorganisation in Deutschland ein und erläutert die aktuellen Debatten um die Einführung von zentralen Abschlussprüfungen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die historischen und aktuellen Schubkräfte für die Einführung von zentralen Abschlussprüfungen. Es zeichnet die Entwicklung der Prüfungsorganisation im 19. Jahrhundert nach, analysiert die Einführung des Zentralabiturs in verschiedenen Bundesländern nach dem Zweiten Weltkrieg und untersucht die Rolle internationaler Vergleichsstudien in der aktuellen Debatte.
Das dritte Kapitel widmet sich der Umsetzung des Zentralabiturs in vier Bundesländern: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Es analysiert die Ziele, die Prüfungsvorbereitung und -durchführung, die Aufgabenkonstruktion, die Bewertung der Leistungen und die Transparenz der Prüfungen in den jeweiligen Bundesländern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen zentrale Abschlussprüfungen, Schulqualität, Bildungspolitik, Zentralabitur, Bundesländervergleich, Prüfungsorganisation, Vergleichbarkeit, Transparenz, Schulentwicklung, Leistungsmessung, Lernstandserhebung, Vergleichsarbeiten, PISA-Studie, Kontext- und Prozessqualität.
- Quote paper
- Britta Wertenbruch (Author), 2008, Schulentwicklung durch zentrale Abschlussprüfungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113489