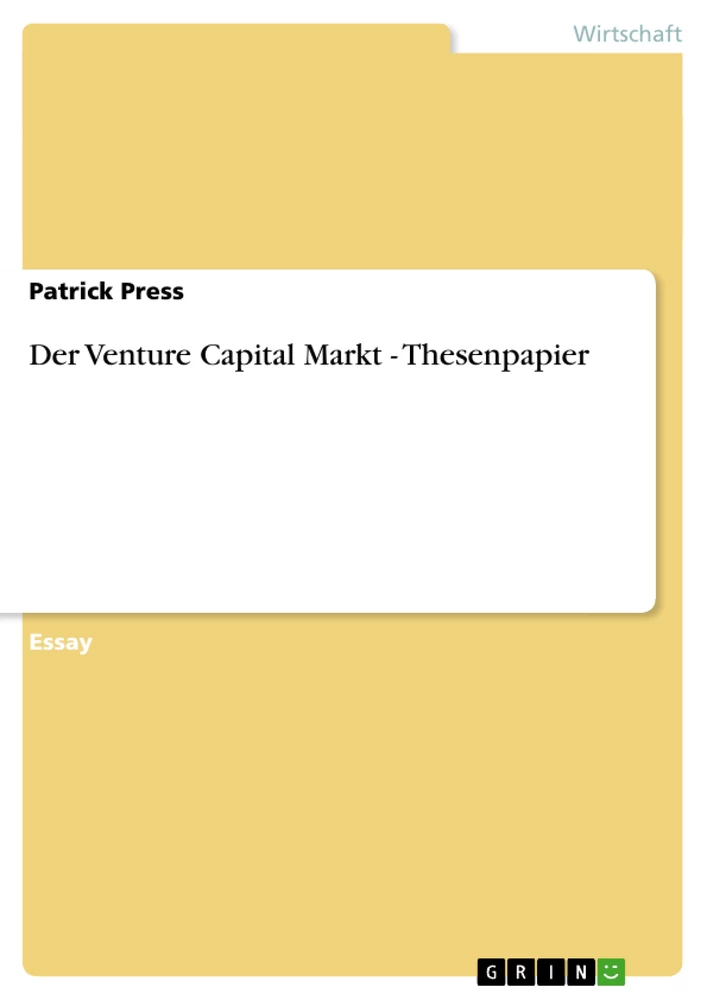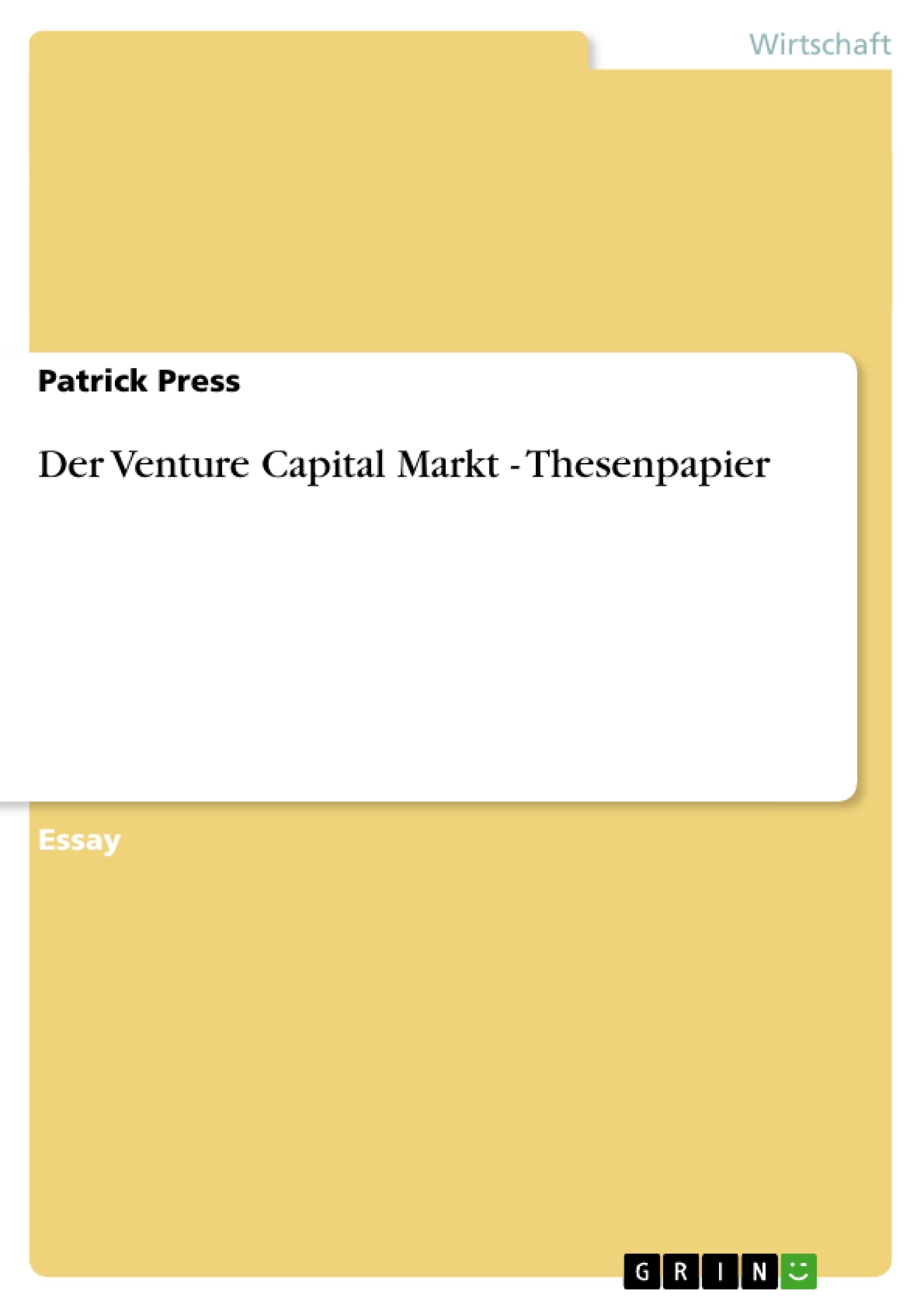Venture Capital (VC) wurde im Deutschen häufig mit „Risikokapital“ übersetzt. Zunehmend
setzt sich jedoch die Bezeichnung „Wagnis- oder Chancenkapital“ durch, um diese Finanzierungsform
nicht mit Spekulationsgeschäften oder sonstigen „Risiko“-geschäften in Verbindung zu
bringen. Der Begriff "Venture Capital" wird häufig auch - den internationalen Gepflogenheiten
folgend - ganz allgemein für Beteiligungskapital verwendet. Der Grundgedanke des Venture
Capital besteht darin, daß Unternehmen in bestimmten Situationen klassischerweise einen hohen
Bedarf an Kapital haben, diesen jedoch mit den herkömmlichen Finanzierungsformen nicht decken
können. Insbesondere fehlen häufig gerade jungen Unternehmen die für eine Finanzierung
mit Fremdkapital erforderlichen Sicherheiten. Gleichzeitig sind die Unternehmensgründer in der
Anfangsphase noch nicht in der Lage, ausreichendes Eigenkapital bereitzustellen. Diese Finanzierungsschwierigkeiten
haben in der Vergangenheit nicht selten dazu geführt, daß aussichtsreiche
Produkte oder Geschäftsideen nicht bis zur Marktreife und zum wirtschaftlichen Erfolg geführt
werden konnten, da eine ausreichende Finanzierung nicht zustande kam.
Hier setzt die Venture Capital-Finanzierung an: ein Investor/Anleger („Venture Capitalist“) beteiligt
sich an einem derartigen Unternehmen in der Regel nur auf Zeit, er führt dem Unternehmen
also Eigenkapital zu und stellt so die für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens/ des
Produktes erforderlichen Finanzmittel bereit. Klassisches Beispiel hierfür ist etwa ein kle ines
Unternehmen auf dem Software- oder Biotechnologiebereich, das eine aussichtsreiche Geschäftsidee
oder ein erfolgversprechendes Produkt (etwa ein Computerprogramm) entwickelt
hat, das jedoch für die internationale Vermarktung des Produktes zunächst einmal Investitionen
in zweistelliger Millionenhöhe tätigen muß. Wird einem solchen Unternehmen im Wege des Venture
Capital die erforderliche Investitionssumme zur Verfügung gestellt, so kann das betreffende
Produkt in kurzer Zeit zur Marktreife gebracht und international zum Erfolg geführt werden.
Damit verbunden ist im Erfolgsfall ein erhebliches Umsatzwachstum des Unternehmens und eine
entsprechende Gewinnentwicklung, so daß sowohl die ursprünglichen Unternehmensgründer als
auch der Venture Capitalist als Geldgeber vom Erfolg des gemeinsamen Produktes / Unternehmens
profitieren.
Inhaltsverzeichnis
- Venture Capital: Begriff und Funktionsweise
- Worin besteht der Unterschied zu einem Bankkredit?
- Kriterien und Ablauf einer VC-Beteiligung
- Interessenkonflikte und Exit-Strategien
- Die Situation in Deutschland
- Auswahl der VC-Gesellschaft und Fördermittel
- Beteiligte Personen und Institutionen
- Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Thesenpapier analysiert den Venture Capital Markt in Deutschland. Es beleuchtet die Funktionsweise von Venture Capital, die Unterschiede zu Bankkrediten, die Kriterien und den Ablauf einer VC-Beteiligung sowie die Herausforderungen im deutschen Kontext.
- Definition und Funktionsweise von Venture Capital
- Unterschied zu Bankkrediten
- Kriterien für eine VC-Beteiligung und Ablauf
- Interessenkonflikte und Exit-Strategien
- Die Situation des Venture Capital Marktes in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Venture Capital: Begriff und Funktionsweise: Dieses Kapitel definiert Venture Capital und beschreibt seine Funktion als alternative Finanzierungsquelle für Unternehmen, insbesondere junge Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, traditionelle Finanzierungsformen zu nutzen. Der Text betont, dass Venture Capital eine zeitlich begrenzte Investition darstellt, bei der der Venture Capitalist Eigenkapital bereitstellt, um das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens zu fördern.
- Kapitel 2: Worin besteht der Unterschied zu einem Bankkredit?: Dieses Kapitel vergleicht Venture Capital mit Bankkrediten. Es hebt hervor, dass Bankkredite Fremdkapital darstellen, das mit Zinsen und Tilgung zurückbezahlt werden muss, während Venture Capital Eigenkapital darstellt und keine Rückzahlungsverpflichtung beinhaltet. Als Gegenleistung für die Investition erhält der Venture Capitalist Anteile am Unternehmen und partizipiert am Gewinn und an der Wertsteigerung.
- Kapitel 3: Kriterien und Ablauf einer VC-Beteiligung: Dieses Kapitel erläutert die Kriterien, die ein Unternehmen erfüllen muss, um eine VC-Beteiligung zu erhalten. Es unterstreicht die Bedeutung eines hochwertigen Unternehmens, eines qualifizierten Managements und eines wettbewerbsfähigen Produkts. Der Text beschreibt den Prozess der Bewerbung, den Business Plan und die Due Diligence, die einer VC-Beteiligung vorausgehen.
- Kapitel 4: Interessenkonflikte und Exit-Strategien: Dieses Kapitel beleuchtet die potenziellen Interessenskonflikte zwischen Unternehmen und Venture Capitalist. Es zeigt auf, dass Venture Capitalisten in erster Linie an der Erzielung einer hohen Rendite interessiert sind, während Unternehmer auch andere Ziele wie Selbstverwirklichung verfolgen können. Das Kapitel beleuchtet verschiedene Exit-Strategien, die die Beendigung der VC-Beteiligung regeln können.
- Kapitel 5: Die Situation in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Venture Capital Marktes in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere den USA und Großbritannien. Es stellt fest, dass die Venture Capital-Finanzierung in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist wie in anderen Ländern.
Schlüsselwörter
Venture Capital, Wagniskapital, Finanzierung, Beteiligungskapital, Bankkredit, Unternehmen, Jungunternehmen, Start-up, Business Plan, Due Diligence, Interessenkonflikt, Exit-Strategie, Rendite, Deutschland, Marktsituation, Frühphasenfinanzierung, High-Tech-Branche, Fördermittel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Venture Capital (VC)?
Venture Capital, oft auch Wagniskapital genannt, ist Beteiligungskapital, das Investoren jungen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zeitlich begrenzt zur Verfügung stellen.
Was ist der Unterschied zwischen VC und einem Bankkredit?
Ein Bankkredit ist Fremdkapital mit Rückzahlungs- und Zinspflicht. VC ist Eigenkapital; der Investor erhält Anteile am Unternehmen und trägt das volle Risiko des Scheiterns mit.
Warum brauchen Start-ups Venture Capital?
Junge Unternehmen fehlen oft Sicherheiten für Kredite. VC ermöglicht es ihnen, innovative Produkte bis zur Marktreife zu entwickeln und international zu vermarkten.
Was versteht man unter einer "Due Diligence"?
Es ist die sorgfältige Prüfung des Unternehmens (Finanzen, Management, Markt) durch den VC-Investor vor der eigentlichen Beteiligung.
Was ist eine Exit-Strategie?
Ein Plan, wie der Investor seine Anteile nach einigen Jahren wieder verkauft (z.B. durch Börsengang oder Verkauf an ein anderes Unternehmen), um seine Rendite zu realisieren.
Wie sieht der VC-Markt in Deutschland aus?
Der deutsche VC-Markt ist im Vergleich zu den USA oder Großbritannien noch weniger entwickelt, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung für die High-Tech-Branche.
- Citar trabajo
- Diplomkaufmann (MBA) Patrick Press (Autor), 2002, Der Venture Capital Markt - Thesenpapier, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11349