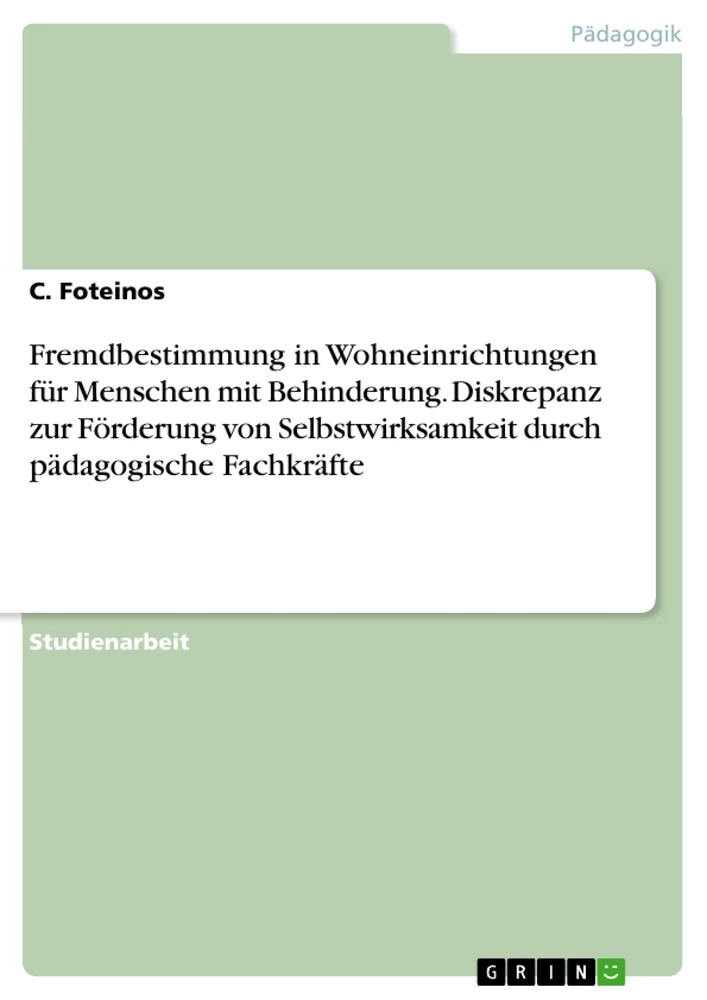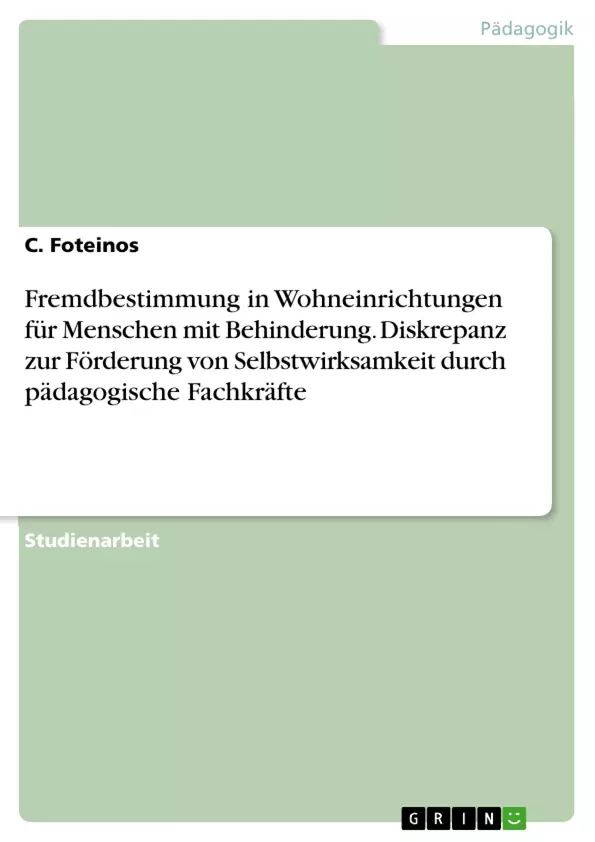Diese Arbeit thematisiert die Grenzen, auf die pädagogischen Fachkräfte teilweise täglich stoßen, bei der Umsetzung eines selbstwirksamen Lebens der Klienten. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welche Möglichkeiten und Grenzen in der Realisierung von Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung in Wohneinrichtungen vorhanden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formulierung der Fragestellung
- Themenfindung
- Motivation und Ziele
- Aufbau der Hausarbeit
- Theoretische Grundlage
- Definitionen
- Definition Behinderung
- Definition Selbstbestimmung
- Definition Fremdbestimmung
- Rechtliche Grundlagen
- Gesetzliche Verankerung von Selbstbestimmung im SGB IX
- UN-Behindertenrechtskonvention über Selbstbestimmung
- Weitere gesetzliche Verankerungen
- Konzepte
- Empowerment
- Normalisierungsprinzip
- Planung und Darstellung der Forschung
- Beschreibung des Klientel
- Alltagsbeobachtungen
- Beispiel 1
- Beispiel 2
- Beispiel 3
- Fragebogen zur Selbstbestimmung innerhalb der Einrichtung
- Beschreibung des geplanten Vorgehens mit einem Fragebogen an die Klienten und Betreuer
- Beschreibung des methodischen Vorgehens mit einem Fragebogen an die Klienten und Betreuer
- Auswertung
- Fragebogen der Betreuer
- Zusammenfassung
- Verknüpfung von Theorie und Praxis
- Analyse aus unterschiedlichen Perspektiven
- Untersuchung anhand des neunten Sozialgesetzbuch
- Untersuchung anhand der UN-Behindertenkonvention
- Untersuchung anhand von Empowerment
- Untersuchung anhand des Normalisierungsprinzips
- Zusammenfassung
- Realisierung im praktischen Alltag mit Fokus auf Selbstbestimmung
- Reflexion des Vorgehens
- Zusammenfassung und Ausblick
- Reflexion der eigenen Rolle
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Möglichkeiten und Grenzen der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung in Wohneinrichtungen zu untersuchen.
- Das Spannungsfeld zwischen notwendiger Fremdbestimmung zum Schutz der Bewohner und der Förderung von Selbstwirksamkeit durch pädagogische Fachkräfte.
- Die Bedeutung rechtlicher Rahmenbedingungen wie dem SGB IX und der UN-Behindertenrechtskonvention.
- Die Anwendung von pädagogischen Konzepten wie Empowerment und Normalisierungsprinzip.
- Die Analyse von konkreten Beispielen aus der Praxis, um die Herausforderungen der Selbstbestimmung in Wohneinrichtungen zu verdeutlichen.
- Die Reflexion der eigenen Rolle als pädagogische Fachkraft im Kontext der Selbstbestimmung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor, beschreibt den Hintergrund der Themenfindung und die Ziele der Arbeit. Im Kapitel der theoretischen Grundlage werden die wichtigsten Begrifflichkeiten definiert, die rechtlichen Grundlagen im Bezug auf Selbstbestimmung erläutert und relevante Konzepte wie Empowerment und Normalisierungsprinzip vorgestellt. Die Planung und Darstellung der Forschung beinhaltet die Beschreibung des Klientels und die Dokumentation von Alltagsbeobachtungen. Außerdem wird die Methodik der durchgeführten Befragung von Klienten und Betreuern erläutert. Im Kapitel der Verknüpfung von Theorie und Praxis werden die gewonnenen Erkenntnisse anhand der zuvor beschriebenen theoretischen Grundlagen analysiert und auf ihre praktische Relevanz hin untersucht. Die Zusammenfassung und der Ausblick fassen die Ergebnisse der Arbeit zusammen und reflektieren die Rolle der Autorin im Kontext der Thematik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Selbstbestimmung, Fremdbestimmung, Behinderung, Empowerment, Normalisierungsprinzip, SGB IX, UN-Behindertenrechtskonvention, Wohneinrichtungen, pädagogische Fachkräfte, Alltagsbeobachtungen, Fragebogen, Praxisanalyse, Reflexion.
- Arbeit zitieren
- C. Foteinos (Autor:in), 2021, Fremdbestimmung in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung. Diskrepanz zur Förderung von Selbstwirksamkeit durch pädagogische Fachkräfte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1135032