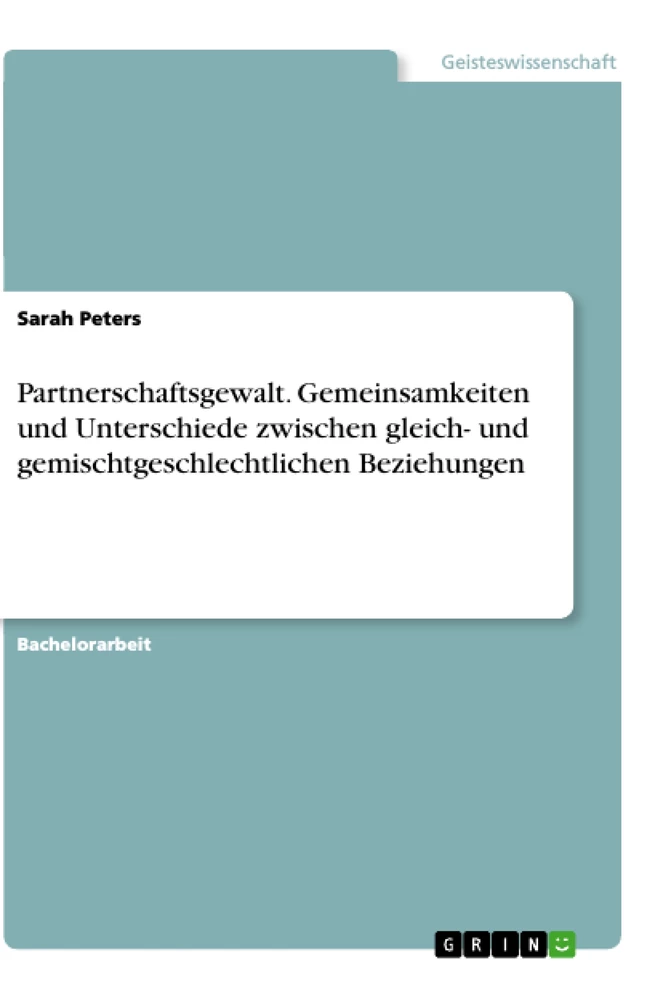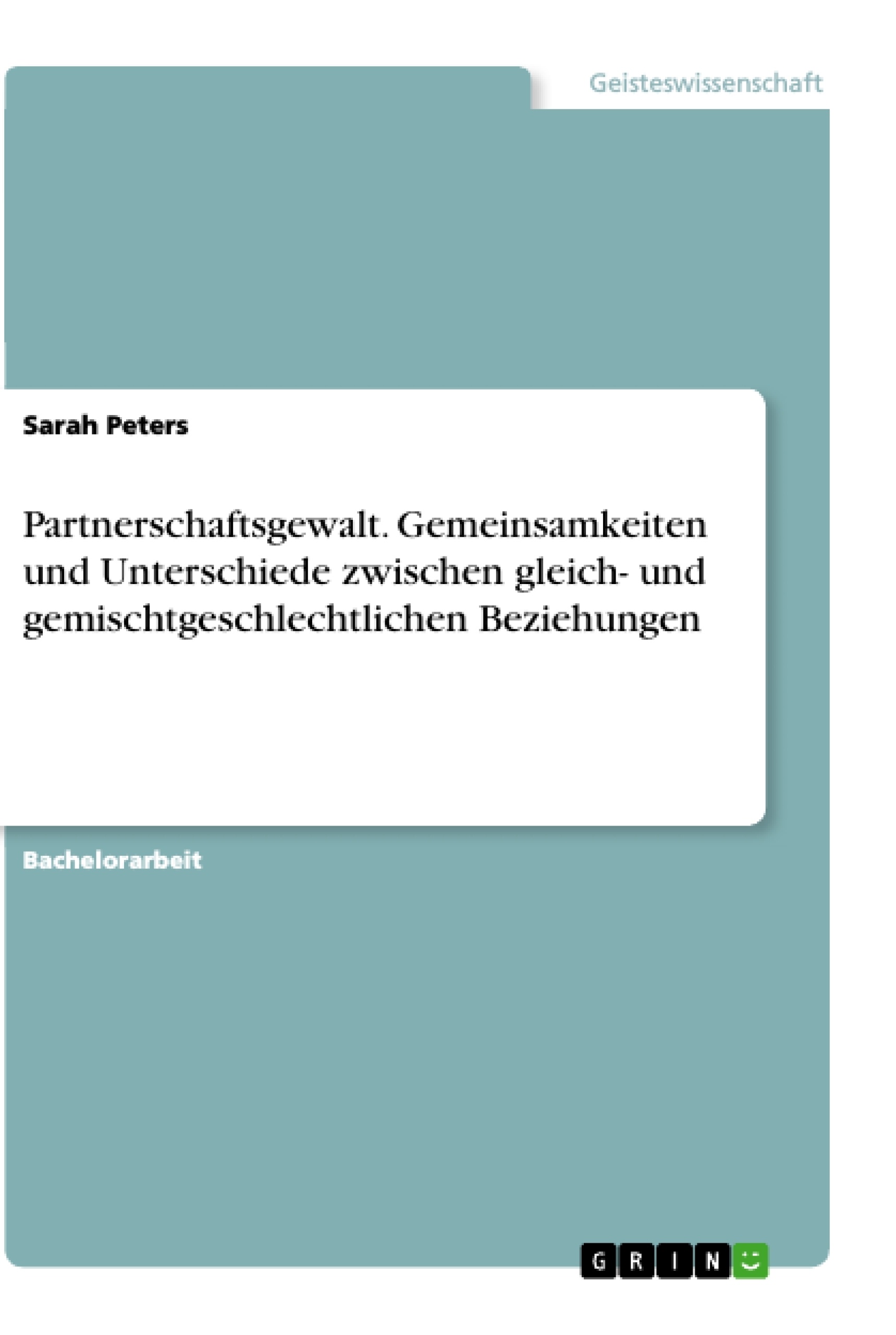Diese Arbeit setzt sich mit den Unterschieden zwischen gleich- und gemischgeschlechtlicher Beziehungsarbeit auseinander. Hierbei werden zunächst die Definitionen von Gewalt und die damit einhergehenden sozialwissenschaftlichen Erklärungsansätze dargestellt. Besonders in dieser Arbeit ist, dass die Informationen anhand des patriarchatskritischen Ansatzes überprüft werden. Nach der Darstellung der verschiedenen Einflussvariablen auf Partnerschaftsgewalt, Tätertypologien und dem Phänomen "Frauen als Täterinnen - Männer als Opfer" werden die individuellen Risikofaktoren innerhalb lesbischer Beziehungen erörtert. Abschließend werden die Defizite der Beratungs- und Hilfsangebote dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewalt
- Definitionen von Gewalt
- Sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze – „Warum übt ein Subjekt Gewalt aus?"
- Der feministische /patriarchatskritische Ansatz
- Zusammenfassung
- Partnerschaftsgewalt in gemischt-geschlechtlichen Beziehungen
- Risikofaktoren
- Alter und Zivilstand
- Sozialer und sozioökonomischer Status
- Alkohol
- Schwangerschaft
- Tätertypologien
- Zusammenfassung
- Risikofaktoren
- Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen
- Frauen als Täterinnen- Männer als Opfer
- Forschungsschwierigkeiten
- Ein Vergleichsversuch von heterosexueller und lesbischer PG
- Gemeinsamkeiten
- Besonderheiten von lesbischer PG
- Defizite der Beratungsangebote
- Einflussvariablen
- Der Einfluss von Gender Stereotypen auf die Bewertung lesbischer PG
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Gewalt in Partnerschaften, insbesondere mit der Frage, ob sich heterosexuelle Partnerschaftsgewalt von Gewalt in lesbischen Beziehungen unterscheidet. Dabei wird eine literaturbasierte Herangehensweise gewählt, die auf Erkenntnisse der Gewaltforschung zurückgreift, wobei ein Schwerpunkt auf der feministischen Epistemologie liegt. Die Untersuchung bezieht sich auf die Bedeutung gesellschaftlicher Machtverhältnisse für die Entstehung von Partnerschaftsgewalt (im Folgenden mit „PG“ abgekürzt).
- Die Bedeutung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen für die Entstehung von Partnerschaftsgewalt.
- Die Analyse von Risikofaktoren für Partnerschaftsgewalt in heterosexuellen Beziehungen.
- Die Relevanz der feministischen Theorie für die Erforschung von weiblicher Täterschaft in Partnerschaften.
- Die Untersuchung von Besonderheiten und Gemeinsamkeiten von Gewalt in heterosexuellen und lesbischen Beziehungen.
- Die Berücksichtigung von Genderstereotypen und deren Einfluss auf die Bewertung von lesbischer Partnerschaftsgewalt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik der Partnerschaftsgewalt in heterosexuellen und lesbischen Beziehungen vor und erläutert die Motivation der Autorin. Sie stellt die Forschungsfrage nach Unterschieden zwischen Gewaltformen in beiden Beziehungstypen und beleuchtet die Relevanz der feministischen Perspektive.
- 1 Gewalt: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Gewaltbegriff und seiner Abgrenzung zu anderen verwandten Begriffen wie Macht, Aggression, Konflikt und sozialem Zwang. Es werden verschiedene Definitionen von Gewalt aus soziologischer und psychologischer Sicht vorgestellt, die sich auf Machtstrukturen, gesellschaftliche Kontrolle und aggressive Verhaltensweisen beziehen. Außerdem werden die Unterschiede in der Verwendung des Gewaltbegriffs im Deutschen und Englischen hervorgehoben.
- 1.1 Definitionen von Gewalt: Dieses Unterkapitel bietet eine detaillierte Erläuterung des Gewaltbegriffs anhand von unterschiedlichen Definitionen und Konnotationen. Es werden die Verbindungen zu den Begriffen Macht, Aggression, Konflikt, Zwang und Herrschaft diskutiert, wobei insbesondere die Machtausübung im Zusammenhang mit Gewalt im Vordergrund steht.
- 1.2 Sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze – „Warum übt ein Subjekt Gewalt aus?": Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Frage nach den Ursachen für Gewaltausübung. Es werden verschiedene Erklärungsansätze aus unterschiedlichen Perspektiven vorgestellt, darunter personenzentrierte, lerntheoretische und sozialpsychologische Ansätze. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der komplexen Zusammenhänge zwischen individuellem Verhalten, sozialen Strukturen und der Entstehung von Gewalt.
- 1.3 Der feministische /patriarchatskritische Ansatz: Dieses Unterkapitel widmet sich der feministischen Perspektive auf Gewalt und die Rolle gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Es werden die Argumente der feministischen Epistemologie erläutert, die den Einfluss von patriarchalischen Strukturen auf die Entstehung von Gewalt in Partnerschaften betonen. Der feministische Ansatz bildet die Grundlage für die spätere Analyse von Partnerschaftsgewalt in der gesamten Arbeit.
- 2 Partnerschaftsgewalt in gemischt-geschlechtlichen Beziehungen: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen und Risikofaktoren von Partnerschaftsgewalt in heterosexuellen Beziehungen. Es werden vier Faktoren herausgestellt, die scheinbar mit dem Auftreten von Gewalt zusammenhängen: Alter, Zivilstand, Alkoholkonsum und Schwangerschaft.
- 2.1 Risikofaktoren: Dieses Unterkapitel behandelt die Faktoren, die mit dem Auftreten von Partnerschaftsgewalt in Verbindung gebracht werden, und liefert Einblicke in die komplexen Ursachen von Gewalt.
- 2.2 Tätertypologien: In diesem Unterkapitel werden verschiedene Typologien von Tätern in Partnerschaftsgewalt vorgestellt. Die Kapitel beleuchten die unterschiedlichen Verhaltensweisen und Charakteristika von Tätern und bieten somit einen tieferen Einblick in die Heterogenität von Gewalt in Partnerschaften.
- 3 Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob die Erkenntnisse aus der Forschung zu heterosexueller Partnerschaftsgewalt auf gleichgeschlechtliche Beziehungen übertragbar sind. Es untersucht, ob es Besonderheiten und Gemeinsamkeiten zwischen Gewalt in heterosexuellen und lesbischen Beziehungen gibt, und analysiert die Defizite der Beratungsangebote für lesbische Opfer von Partnerschaftsgewalt.
- 3.1 Forschungsschwierigkeiten: Dieses Unterkapitel befasst sich mit den besonderen Herausforderungen, die mit der Erforschung von Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen verbunden sind. Es werden die Gründe für die geringe Forschungsaktivität in diesem Bereich beleuchtet und die Schwierigkeiten bei der Datenerhebung und Interpretation von Forschungsergebnissen diskutiert.
- 3.2 Ein Vergleichsversuch von heterosexueller und lesbischer PG: Dieses Unterkapitel vergleicht die Ergebnisse der Forschung zu heterosexueller und lesbischer Partnerschaftsgewalt. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausprägung und den Ursachen von Gewalt in beiden Beziehungstypen herausgearbeitet.
- 3.3 Einflussvariablen: Dieses Unterkapitel analysiert die Einflussfaktoren, die die Entstehung und Ausprägung von Partnerschaftsgewalt in lesbischen Beziehungen beeinflussen. Es werden die Relevanz von Genderstereotypen und deren Einfluss auf die Bewertung von Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf das Phänomen der Partnerschaftsgewalt in heterosexuellen und lesbischen Beziehungen und untersucht die Bedeutung der feministischen Epistemologie, Risikofaktoren, Tätertypologien, Forschungsschwierigkeiten und die Herausforderungen in der Beratung von lesbischen Opfern von Partnerschaftsgewalt. Der Fokus liegt auf dem Einfluss von Gender Stereotypen und dem Vergleich zwischen heterosexueller und lesbischer Partnerschaftsgewalt. Die Schlüsselbegriffe umfassen daher Begriffe wie Gewalt, Macht, Aggression, Konflikt, sozialer Zwang, Partnerschaftsgewalt, Risikofaktoren, Tätertypologien, feministische Epistemologie, Gender Stereotype, lesbische Partnerschaftsgewalt, Forschungsschwierigkeiten und Beratungsangebote.
Häufig gestellte Fragen
Unterscheidet sich Gewalt in lesbischen Beziehungen von heterosexueller Gewalt?
Die Arbeit untersucht Gemeinsamkeiten und Besonderheiten und zeigt auf, dass Machtverhältnisse auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften eine Rolle spielen, aber oft andere Dynamiken aufweisen.
Was ist der patriarchatskritische Ansatz in der Gewaltforschung?
Dieser Ansatz analysiert, wie gesellschaftliche Machtstrukturen und traditionelle Rollenbilder die Entstehung und Bewertung von Gewalt in Partnerschaften beeinflussen.
Welche Risikofaktoren für Partnerschaftsgewalt gibt es?
Zu den Faktoren zählen unter anderem das Alter, der soziale Status, Alkoholkonsum sowie besondere Belastungssituationen wie eine Schwangerschaft.
Gibt es Defizite bei Hilfsangeboten für lesbische Frauen?
Ja, Beratungsstellen sind oft auf heterosexuelle Muster fixiert, was dazu führen kann, dass lesbische Opfer von Gewalt sich weniger verstanden fühlen oder seltener Hilfe suchen.
Wie wirken sich Gender-Stereotype auf die Wahrnehmung von Gewalt aus?
Stereotype können dazu führen, dass weibliche Täterschaft unterschätzt oder ignoriert wird, da Frauen oft primär als Opfer und Männer als Täter wahrgenommen werden.
- Quote paper
- Sarah Peters (Author), 2017, Partnerschaftsgewalt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen gleich- und gemischtgeschlechtlichen Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1135201