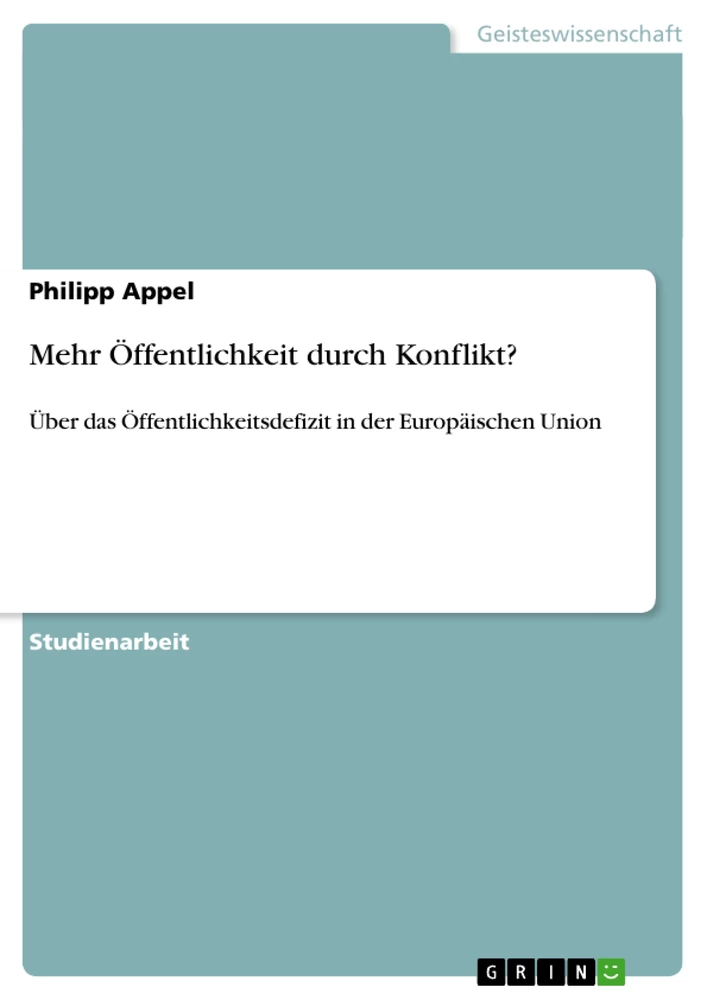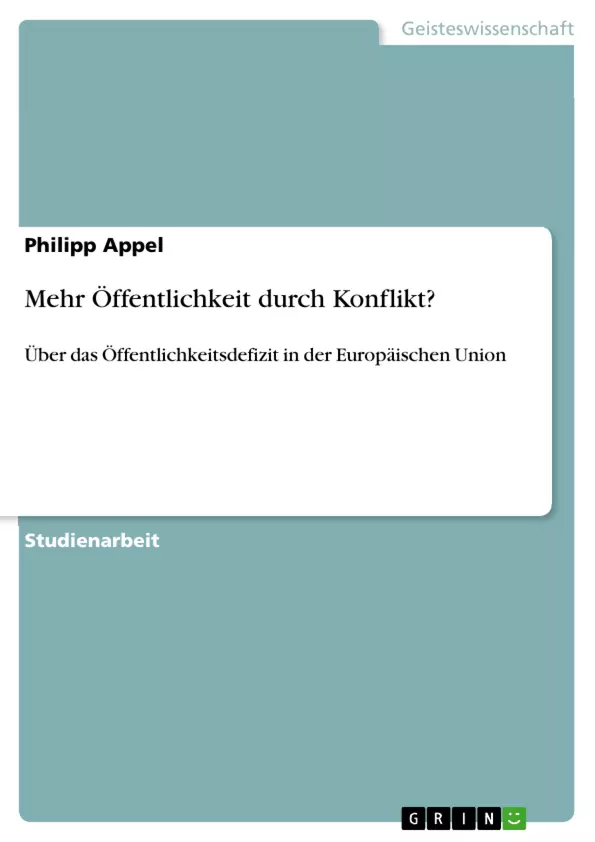Die Europäische Union (EU) hat sich seit der Unterzeichung der Römischen Verträge im Jahre 1957 enorm entwickelt. Zwölf Jahre nach Kriegsende beschlossen damals sechs europäische Staaten, darunter die Erbfeinde Deutschland und Frankreich, eine intensive wirtschaftliche und in der Folge auch politische Kooperation. Fünfzig Jahre später besteht die Europäischen Union aus nunmehr 27 Mitgliedsstaaten aus West-, Nord-, Ost- und Südeuropa. Ein kompliziertes politisches System mit verschiedenen Ebenen, supranationalen sowie nationalen Akteuren, formuliert in immer mehr Politikbereichen für die Mitgliedsstaaten verbindliche Normen und Regeln. Die EU und der im Allgemeinen als Integration beschriebener Prozess der Vergemeinschaftung wird von der politischen Klasse, gerade mit dem Verweis auf die Herausforderungen der Globalisierung, in der Mehrheit begrüßt. Doch jenseits der Gipfelkonferenzen, Grenzöffnungszeremonien und EU-Parlamentssitzungen stößt das Projekt eines wirtschaftlich und politisch geeinten Europas durchaus auf Skepsis. Zwar wurde das Projekt der europäischen Einigung lange von den Bürgern Europas mit „freundlicher Indifferenz“ begleitet, doch scheint dieser „permissive Konsensus“, diese „stillschweigende Zustimmung“ (Schäfer 2006:350) nicht mehr uneingeschränkt zu gelten. So wird zum Beispiel die EU-Erweiterung zunehmend skeptisch gesehen, außerdem wird der EU zu viel Bürokratie und Bürgerferne vorgeworfen. Weiterhin gilt der gilt der EU-Willensbildungsprozess vielen als wenig transparent und undemokratisch (Trenz 2002: 11 & Schäfer 2006: 350). Vielfach wird der Europäischen Union ein Demokratiedefizit attestiert und nicht nur Sozialwissenschaftler fordern eine Aufwertung demokratischer Verfahren und mehr Bürgerbeteiligung in der Europäischen Union (Schäfer 2006:351). Als Defizitär wird von einigen auch der Zustand von Öffentlichkeit in Europa beschrieben. Wissenschaftler und Politiker haben darauf hingewiesen, dass in der Europäischen Union der „(...) von Massenmedien getragene politische Diskurs, der Politik erst zu einer Sache der Allgemeinheit und damit Demokratie erst zur Demokratie macht“ (Kielmannsegg nach Neidhardt et al 2000:263) fehle bzw. dass das größte demokratische Defizit in Europa nicht bei den Institutionen liege, „sondern am Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit“ (Guterres nach Neidhardt et al 2000:263).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Öffentlichkeit, Demokratie und die EU
- Politische Öffentlichkeit und Demokratie
- Das Öffentlichkeitsdefizit und die Europäische Union
- Legitimationsdefizite als Folge von Transnationalisierungsprozessen
- Gibt es ein Öffentlichkeitsdefizit in der Europäischen Union?
- Konflikte als Generator politischer Öffentlichkeit in der EU?
- Konflikt - Öffentlichkeit - Demokratie
- Lösungsstrategien eines Öffentlichkeitsdefizit in der Europäischen Union
- Konflikte als Motor europäischer Öffentlichkeit?
- Demokratie als Motor politischer Öffentlichkeit in Europa
- Schlusswort
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Öffentlichkeitsdefizit in der Europäischen Union. Sie analysiert, ob ein solches Defizit tatsächlich besteht und welche Rolle Konflikte bei der Genese einer politischen Öffentlichkeit in Europa spielen können. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Öffentlichkeit in demokratischen Systemen und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der transnationalen Struktur der EU ergeben.
- Öffentlichkeitsdefizit in der Europäischen Union
- Rolle von Konflikten in der Genese politischer Öffentlichkeit
- Bedeutung von Öffentlichkeit in demokratischen Systemen
- Herausforderungen der transnationalen Struktur der EU
- Demokratie und politische Willensbildung in der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Öffentlichkeitsdefizit in der Europäischen Union dar und skizziert die Forschungsfrage. Sie beleuchtet die Entwicklung der EU und die Herausforderungen, die sich aus der Integration ergeben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Konzept der politischen Öffentlichkeit und ihrer Bedeutung für demokratische Systeme. Es wird ein repräsentativ-liberales Modell von Öffentlichkeit vorgestellt und die Funktionen von Öffentlichkeit in Demokratien erläutert.
Das dritte Kapitel analysiert das Öffentlichkeitsdefizit in der Europäischen Union. Es werden die Ursachen für das Defizit untersucht, darunter die Legitimationsdefizite, die aus Transnationalisierungsprozessen resultieren. Es wird die Frage diskutiert, ob ein solches Defizit tatsächlich besteht und welche Auswirkungen es auf die demokratische Funktionsweise der EU hat.
Das vierte Kapitel untersucht die Rolle von Konflikten bei der Genese einer politischen Öffentlichkeit in der EU. Es wird die These vertreten, dass Konflikte eine konstruktive Rolle spielen können, indem sie die öffentliche Debatte anregen und die Aufmerksamkeit auf wichtige Themen lenken. Es werden verschiedene Lösungsstrategien für das Öffentlichkeitsdefizit diskutiert, darunter die Förderung von Bürgerbeteiligung und die Stärkung der demokratischen Institutionen der EU.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Öffentlichkeitsdefizit, die Europäische Union, politische Öffentlichkeit, Demokratie, Konflikte, Transnationalisierung, Legitimation, Bürgerbeteiligung, Integration und die Herausforderungen der europäischen Integration. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Öffentlichkeit für die demokratische Funktionsweise der EU und untersucht die Rolle von Konflikten bei der Genese einer politischen Öffentlichkeit in Europa.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Öffentlichkeitsdefizit der EU?
Es bezeichnet das Fehlen eines europaweiten, medienübergreifenden Diskurses, der politische Entscheidungen für alle Bürger transparent und demokratisch legitimiert.
Können Konflikte der EU helfen?
Ja, die Arbeit untersucht die These, dass politische Konflikte als Motor für Öffentlichkeit dienen können, indem sie Aufmerksamkeit erzeugen und Debatten anregen.
Was ist der "permissive Konsensus"?
Es beschreibt die lange Zeit herrschende stillschweigende Zustimmung der Bürger zur europäischen Integration, die heute zunehmender Skepsis weicht.
Warum wird der EU ein Demokratiedefizit vorgeworfen?
Kritiker bemängeln zu viel Bürokratie, mangelnde Bürgerbeteiligung und wenig transparente Entscheidungsprozesse in den supranationalen Institutionen.
Welche Rolle spielen die Massenmedien?
Massenmedien sind notwendig, um politische Themen in die Breite der Gesellschaft zu tragen; ihr Fehlen auf EU-Ebene erschwert eine europäische Identität.
- Citar trabajo
- Philipp Appel (Autor), 2008, Mehr Öffentlichkeit durch Konflikt?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113556