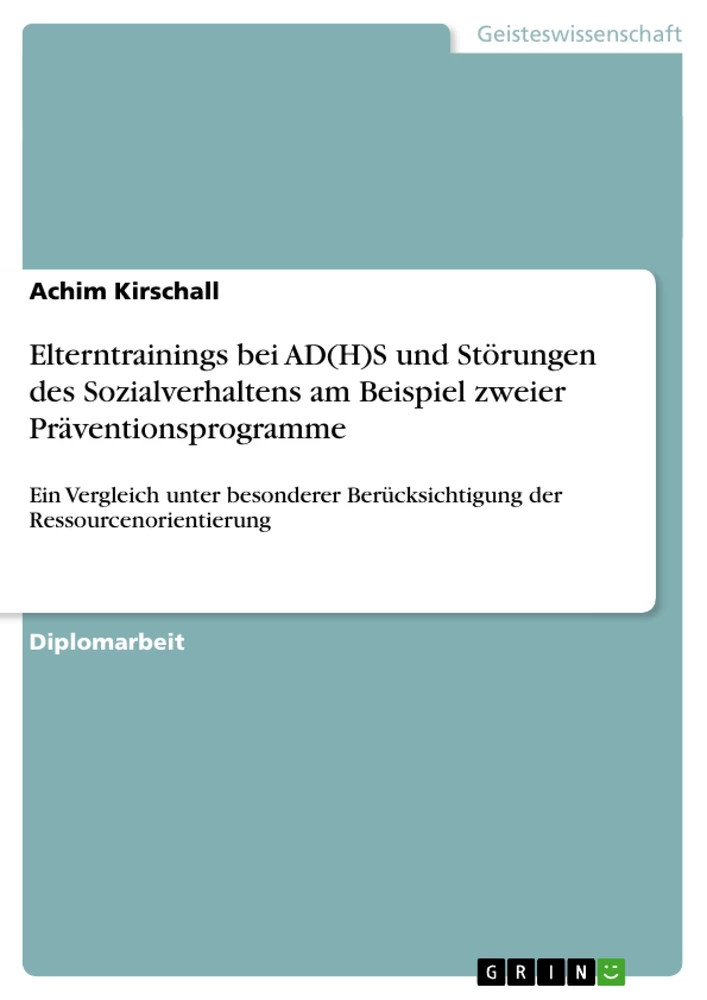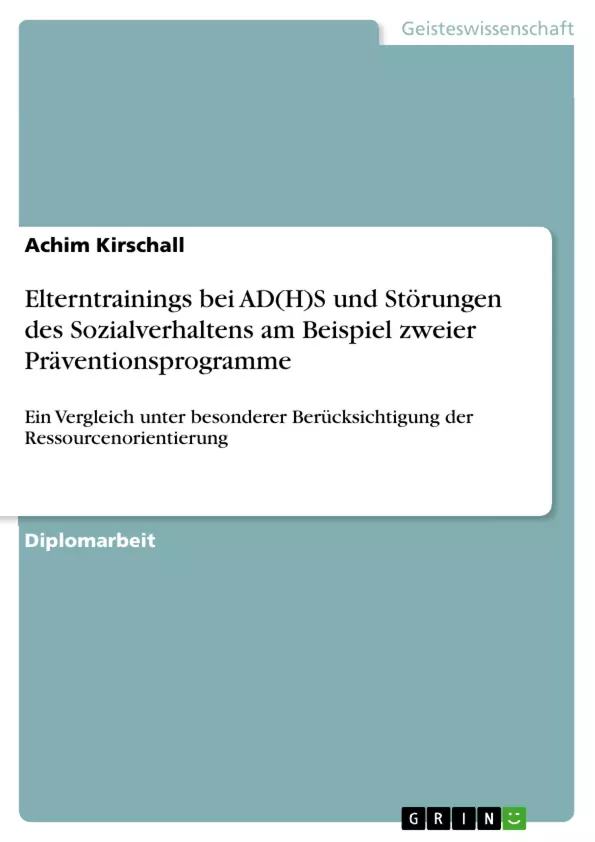In der vorliegenden Arbeit werden das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)“ (Lauth & Heubeck, 2006) und das „Präventionsprogramm für Expansives Problemverhalten (PEP)“ (Plück, Wieczorrek, Wolff Metternich & Döpfner, 2006) untersucht und verglichen. Ziel der Untersuchung war es, die Wirksamkeit beider Programme, ihre Anwendungsmöglichkeiten und ihre Umsetzung von humanistischen und demokratisch-partizipativen Erziehungsprämissen einzuschätzen. Die vergleichende Untersuchung der einzelnen Sitzungen ergab im Hinblick auf aktive Mitarbeit und Aktivierung elterlicher Ressourcen eine Überlegenheit des Programms KES. So zeigte sich in der didaktisch-methodischen Gestaltung von KES ein Schwerpunkt auf der Eigenerfahrung der Eltern. Das Training eignet sich insbesondere für Eltern, die zur aktiven Mitarbeit und zur Reflexion des eigenen Erziehungsverhaltens bereit sind.
Das Programm PEP stellt eine multimodale Intervention dar, da neben den Eltern auch die Erzieher angeleitet werden. Die Vermittlungsstrategie beruht vorrangig auf dem Problemlösetraining und ist überwiegend kognitiv und lösungsorientiert ausgerichtet. Die Analyse der einzelnen Sitzungen ergab eine klar strukturierte und gut verständliche Darstellung, womit sich dieses Programm in recht standardisiert und praxisnah umsetzen lässt. PEP eignet sich für Eltern, die durch die Vermittlung klarer Handlungsanweisungen Veränderungen im Erziehungsverhalten erreichen wollen und weniger an einem intensiven Austausch mit den Trainern und anderen Eltern interessiert sind.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Zusammenfassung
- 1 Einleitung
- 2 Störungsbilder
- 2.1 Aufmerksamkeitsstörungen, AD(H)S, Hyperkinetische Störungen (F 90)
- 2.1.1 Klassifikation und Diagnosekriterien
- 2.1.2 Leitsymptome
- 2.1.3 Subtypen
- 2.1.4 Diagnosekriterien nach ICD-10
- 2.1.5 Erscheinungsbild
- 2.1.6 Prävalenz von Aufmerksamkeitsstörungen
- 2.1.7 Komorbidität
- 2.1.8 Stabilität und Verlauf der Störung
- 2.1.9 Ursachen/Erklärungsmodelle
- 2.1.9.1 Das biopsychosoziale Erklärungsmodell
- 2.1.9.2 Genetische Disposition
- 2.1.9.3 Beeinträchtigte zentralnervöse Aktivierungsregulation
- 2.1.9.4 Beeinträchtigung der zentralnervösen Inhibitionskontrolle
- 2.1.9.5 Motivation
- 2.1.9.6 Zusammenfassung der biologischen und verhaltensgenetischen Grundlagen
- 2.1.9.7 Soziale und sozioökonomische Faktoren
- 2.1.9.8 Psychoanalytische Erklärungsmodelle
- 2.1.9.9 Exkurs: Systemisches Erklärungsmodell psychischer Erkrankungen
- 2.1.10 Therapie/Behandlung
- 2.1.10.1 Kindzentrierte Behandlungen
- 2.1.10.2 Eltern- und familienzentrierte Verfahren
- 2.1.10.3 Exkurs: systemische Therapie
- 2.1.11 Die Kontroverse um AD(H)S
- 2.2 Störung des Sozialverhaltens (F 91)
- 2.2.1 Klassifikation und Diagnosekriterien
- 2.2.1.1 Subtypen
- 2.2.1.2 Diagnosekriterien nach ICD-10
- 2.2.2 Prävalenz
- 2.2.3 Komorbidität
- 2.2.4 Stabilität und Verlauf
- 2,2.2.5 Ursachen/Erklärungsmodelle
- 2.2.5.1 Biologische Einflüsse
- 2.2.5.2 Psychische Einflüsse
- 2.2.5.3 Soziale Einflüsse
- 2.2.5.4 Spezifische Temperamentsmerkmale
- 2.2.5.5 Familiäre Faktoren
- 3 Prävention kindlicher Verhaltensstörungen
- 3.1 Präventionsformen
- 3.2 Anforderungen an Präventionsmaßnahmen
- 4 Theoretische und methodische Hintergründe der Trainingsprogramme
- 4.1 Stress
- 4.2 Therapeutische Grundlagen
- 4.2.1 Operante Konditionierung
- 4.2.1.1 Bestrafung im operanten Konditionieren
- 4.2.1.2 Operantes Konditionieren bei Kindern mit AD(H)S
- 4.2.2 Rational-Emotive Verhaltenstherapie
- 4.2.3 Ressorcenorientierung
- 4.2.4 Lösungsorientierung
- 4.2.5 Autoritärer versus autoritativer Erziehungsstil
- 4.3 Methodische Prinzipien
- 4.3.1 Problemlösetraining
- 4.3.2 Verhaltensprotokollierung
- 4.3.3 Verhaltensverträge
- 4.3.4 Strukturierung von Abläufen-Regulationshilfen
- 4.3.5 Perspektivenwechsel/kognitives Umstrukturieren
- 4.3.6 Auszeit/Time-Out
- 4.3.7 Positive Spielzeit - Wertvolle Zeit
- 4.3.8 Stressimpfung
- 5 Das Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)
- 5.1 Überblick über die einzelnen Trainingseinheiten
- 5.2 Theoretischer Hintergrund
- 5.3 Zielsetzung des Trainings
- 5.4 Indikation und Zielgruppe
- 5.5 Diagnostik
- 5.6 Trainingsaufbau
- 5.7 Methodik
- 5.8 Materialien
- 5.9 Angaben zu Trainerverhalten und Trainerqualifikation
- 3,5.10 Begleitende Evaluation
- 5.11 Die Trainingseinheiten im Einzelnen
- 5.11.1 Trainingseinheit 1: Was soll sich ändern? Was kann so bleiben?
- 5.11.2 Trainingseinheit 2: Eine emotionale Basis haben - Positive Spielzeit
- 5.11.3 Trainingseinheit 3: Eigene Gefühle und Gedanken wahrnehmen
- 5.11.4 Trainingseinheit 4: Abläufe ändern
- 5.11.5 Trainingseinheit 5: Durch Konsequenzen anleiten
- 5.11.6 Trainingseinheit 6: Effektive Aufforderungen stellen
- 5.11.7 Auffrischungssitzung: Ein Blick zurück – auf dem Weg nach vorn
- 6 Präventionsprogramm für Expansives Problemverhalten (PEP)
- 6.1 Überblick über die einzelnen Sitzungen
- 6.2 Theoretischer Hintergrund
- 6.3 Zielsetzung des Trainings
- 6.4 Indikation und Zielgruppe
- 6.5 Diagnostik und Rekrutierung von Gruppen
- 6.6 Programmaufbau
- 6.7 Methodik
- 6.8 Materialien
- 6.9 Angaben zu Trainerverhalten und Trainerqualifikation
- 6.10 Begleitende Evaluation
- 6.11 Forschungsprojekt
- 6.12 Die Sitzungen im Einzelnen
- 6.12.1 Sitzung 0 (Kurzfassung)
- 6.12.2 Sitzung 1: Das Kind - Freud und Leid
- 6.12.3 Sitzung 2: Teufelskreis/Gemeinsame Spielzeit bzw. Wertvolle Zeit
- 6.12.4 Sitzung 3: Energie sparen & Auftanken
- 6.12.5 Sitzung 4: Regeln und wirkungsvolle Aufforderungen
- 6.12.6 Sitzung 5: Positive Konsequenzen
- 6.12.7 Sitzung 6: Negative Konsequenzen
- 6.12.8 Sitzung A: Problemverhalten in der Öffentlichkeit (Kurzfassung)
- 6.12.9 Sitzung B: Ständiger Streit (Kurzfassung)
- 6.12.10 Sitzung C: Spieltraining (Kurzfassung)
- 6.12.11 Sitzung D: Hausaufgaben
- 7 Evaluation der Trainingsprogramme KES und PEP
- 7.1 Evaluation KES
- 7.1.1 Durchführung des Elterntrainings an 16 Erziehungsberatungsstellen
- 7.1.2 Verhaltensübungen im Elterntraining
- 7.1.3 Beurteilung der Evaluation
- 4,7.2 Evaluation PEP
- 7.2.1 Kurzzeiteffekte des indizierten Präventionsprogramms für Expansives Problemverhalten (PEP) auf das elterliche Erziehungsverhalten und auf das kindliche Problemverhalten
- 7.2.2 Beurteilung der Evaluation
- 8 Vergleich der Trainingsprogramme/Präventionsprogramme
- 8.1 Zielgruppe
- 8.2 Platzierung am Markt
- 8.3 Erreichbarkeit der Präventionsmaßnahmen
- 8.4 Anforderungen an die Eltern
- 8.5 Anforderungen an die Trainer
- 8.6 Therapeutische Methoden
- 8.7 Didaktisch-methodische Vermittlung
- 8.8 Zeitliche Gestaltung
- 8.9 Ressourcenorientierung
- 9 Diskussion und Ausblick
- Literatur
- Störungsbilder AD(H)S und Störungen des Sozialverhaltens
- Präventionsformen und -maßnahmen
- Theoretische und methodische Grundlagen der Trainingsprogramme
- Ressourcenorientierung in der Elternarbeit
- Vergleich der Programme KES und PEP
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Evaluation und dem Vergleich zweier Elterntrainings, die sich mit den Themen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (AD(H)S) und Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern auseinandersetzen. Die Arbeit analysiert die beiden Präventionsprogramme "Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder" (KES) und "Präventionsprogramm für Expansives Problemverhalten" (PEP) unter besonderer Berücksichtigung der Ressourcenorientierung. Ziel ist es, die Wirksamkeit und die spezifischen Merkmale der Programme im Hinblick auf ihre praktische Anwendung und ihre Eignung zur Förderung elterlicher Kompetenzen zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Aufmerksamkeitsstörungen, AD(H)S und Störungen des Sozialverhaltens. Es werden die Klassifikation, Diagnosekriterien, Leitsymptome, Subtypen, Prävalenz, Komorbidität, Stabilität und Verlauf der Störungen sowie verschiedene Erklärungsmodelle beleuchtet. Anschließend werden die beiden Präventionsprogramme KES und PEP vorgestellt. Die Arbeit analysiert die theoretischen und methodischen Grundlagen der Programme, ihre Zielsetzung, Indikation, Zielgruppe, Diagnostik, Trainingsaufbau, Methodik, Materialien, Trainerqualifikation, Begleitende Evaluation und die einzelnen Trainingseinheiten bzw. Sitzungen. Im Anschluss werden die Evaluationen der Programme KES und PEP detailliert dargestellt und die Ergebnisse der jeweiligen Studien diskutiert. Abschließend erfolgt ein Vergleich der beiden Programme hinsichtlich ihrer Zielgruppe, Platzierung am Markt, Erreichbarkeit, Anforderungen an die Eltern und Trainer, therapeutischen Methoden, didaktisch-methodischen Vermittlung, zeitlichen Gestaltung und Ressourcenorientierung. Die Arbeit endet mit einer Diskussion der Ergebnisse und einem Ausblick auf zukünftige Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Elterntrainings, AD(H)S, Störungen des Sozialverhaltens, Prävention, Ressourcenorientierung, Kompetenztraining, KES, PEP, Evaluation, Vergleich, Wirksamkeit, Erziehungsverhalten, kindliches Verhalten, Familientherapie, systemische Therapie, Verhaltenstherapie, Erziehungswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Unterschiede zwischen den Programmen KES und PEP?
KES (Lauth & Heubeck) setzt stark auf die Eigenerfahrung und Reflexion der Eltern, während PEP (Döpfner et al.) ein multimodales, lösungsorientiertes Programm mit klaren Handlungsanweisungen ist, das auch Erzieher einbezieht.
Für wen ist das Training KES besonders geeignet?
KES eignet sich für Eltern, die bereit sind, aktiv mitzuarbeiten, ihr eigenes Erziehungsverhalten intensiv zu reflektieren und ihre elterlichen Ressourcen zu aktivieren.
Welchen Ansatz verfolgt das Präventionsprogramm PEP?
PEP ist überwiegend kognitiv und lösungsorientiert. Es nutzt Problemlösetrainings und bietet strukturierte, praxisnahe Anleitungen zur Bewältigung von expansivem Problemverhalten.
Welche Störungsbilder werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS/F 90) sowie Störungen des Sozialverhaltens (F 91).
Was bedeutet Ressourcenorientierung in diesem Kontext?
Ressourcenorientierung bedeutet, die vorhandenen Stärken und Fähigkeiten der Eltern und Kinder zu nutzen und zu fördern, anstatt sich nur auf die Defizite oder Störungen zu konzentrieren.
- Arbeit zitieren
- Dipl. -Pädagoge Achim Kirschall (Autor:in), 2007, Elterntrainings bei AD(H)S und Störungen des Sozialverhaltens am Beispiel zweier Präventionsprogramme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113581