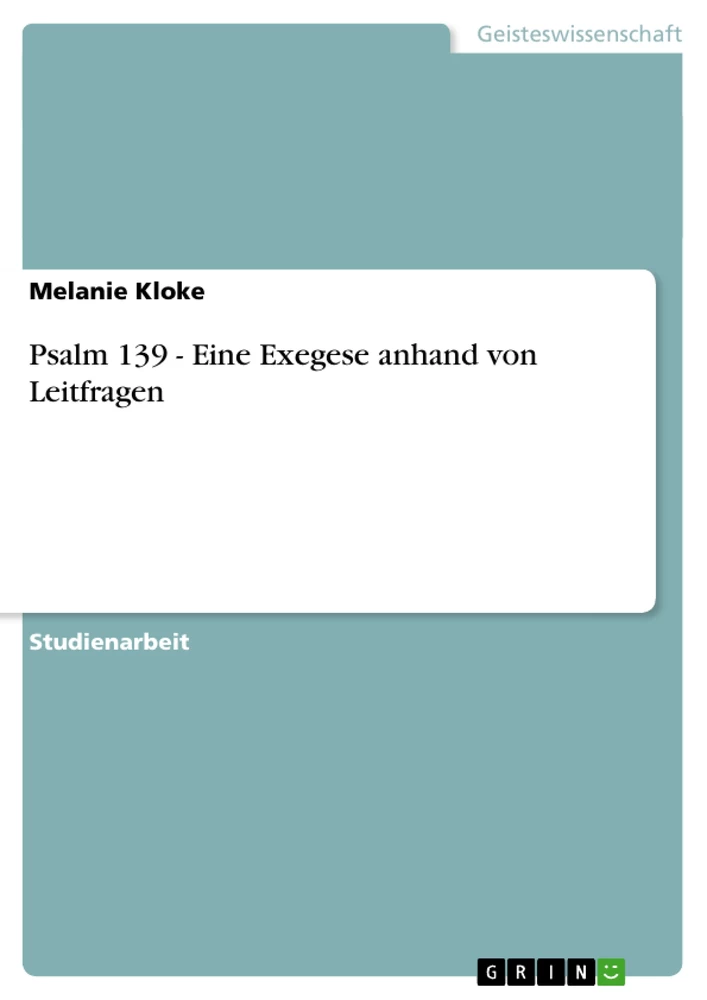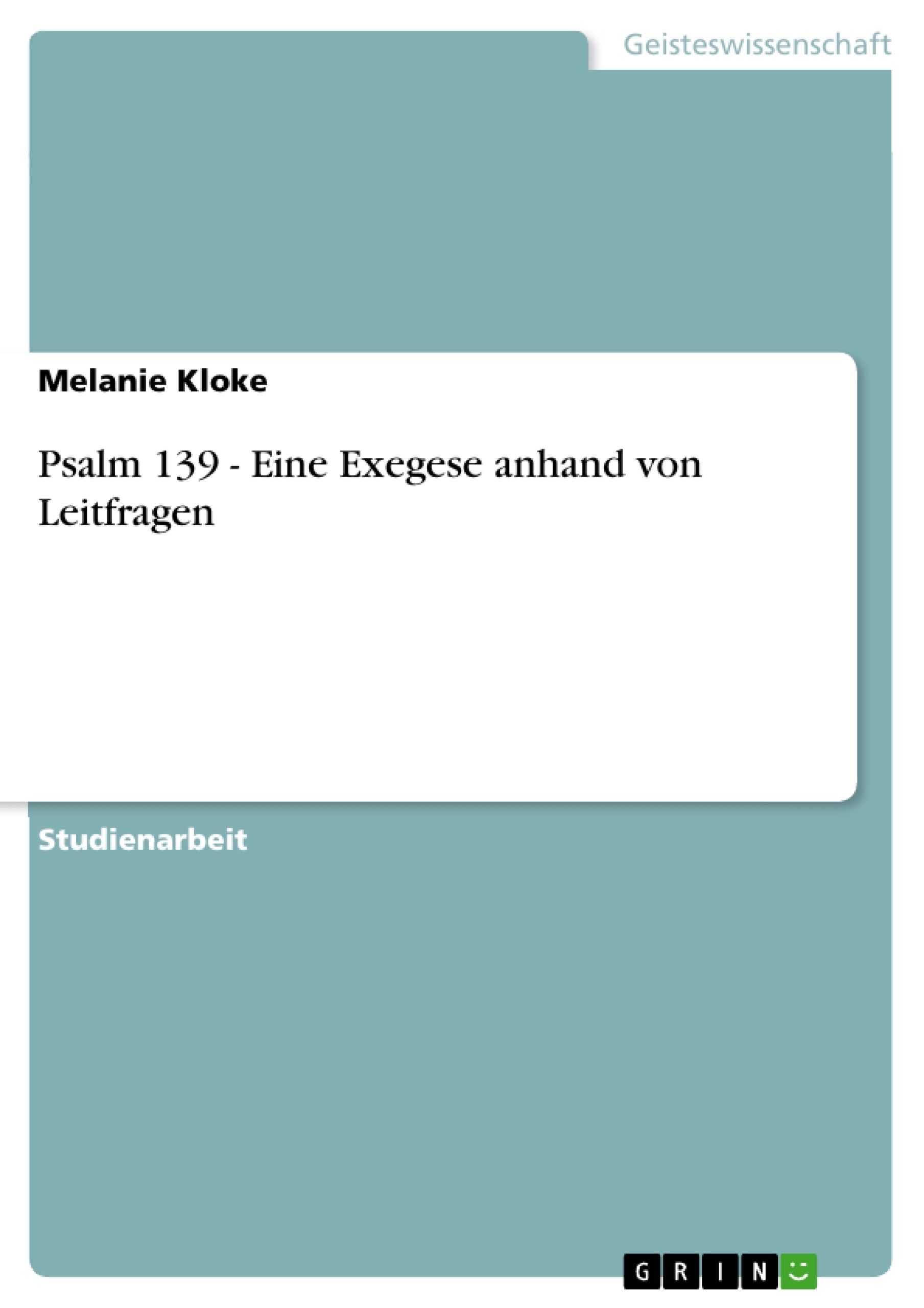Bei der Exegese des Psalms 139 stehen die Ausleger stets vor einem Interpretationsproblem. Es ist unklar, ob der Beter dieses Psalms die Allgegenwärtigkeit und Allwissenheit Gottes preist oder als beängstigend empfindet, was zu kontroversen Aussagen der Exegeten bezüglich der dem Psalm zugrunde liegenden Situation führt. So stellen einige Ausleger, wie Rudolf Kilian oder Klaus Seybold, die These auf, der Psalm schildere eine Gerichtsszene. Klaus Seybold behauptet, der Text stelle das Gebet eines fälschlich der Bilderverehrung Beschuldigten dar, dessen Fall in Kürze vor dem Gericht untersucht werden soll. In seiner Not wendet er sich an Jahwe, der, weil er alles über sein Leben weiß, als Zeuge für ihn eintreten und die bösen Ankläger bestrafen soll.2 Zusätzlich dazu enthält Psalm 139 laut Rudolf Kilian eine tiefe Vertrauensäußerung des Beters gegenüber Gott, weil er weiß dass Gott sich für ihn einsetzen wird, da er die Wahrheit über ihn kennt. Rudolf Kilian meint weiterhin, dass der Beter durch das Vertrauen, das er Gott entgegen bringt, auch andere zum Beten motivieren will. Andere Exegeten, wie zum Beispiel Walter Groß, haben eine andere, deutlich
negativere Betrachtungsweise. Für Walter Groß ist der Psalm ein Erfahrungsbericht eines Einzelnen, der sich von Gott belagert und ausgeforscht fühlt. Er beschreibt, so Groß, die vergeblichen Fluchtversuche des Beters aus der Belagerung Gottes. Im Gegensatz dazu wird der Psalm von einigen Auslegern auch sehr positiv verstanden. Erich Zenger sieht den Psalm als einen Text, der Hoffnung stiften will in einer Welt, die von gottlosen Menschen beherrscht wird. Es geht in ihm um einen Einzelnen, der sein persönliches Gottesverhältnis durch die Herrschaft der Frevler gefährdet sieht. Um ein tieferes Verständnis für den Text zu gewinnen wird Psalm 139 im Folgenden sowohl auf anthropologischer, als auch auf kulturspezifischer Ebene betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Übersetzungsvergleich
- 2.1 Übersetzung des Münsterschwarzacher Psalters
- 2.2 Vergleich mit anderen Bibelübersetzungen
- 3. Literarkritik
- 3.1 Aufbau des Psalms
- 3.2 Die Bedeutung der Verse 19-22 im Psalm
- 4. Gattungskritik
- 4.1 Einordnung in die Anthropologie des Gebets
- 4.1.1 Die vier Arten des Gebets
- 4.1.2 Einordnung des Psalms 139
- 4.2 Persönliche Frömmigkeit
- 4.2.1 Das Phänomen der Persönlichen Frömmigkeit
- 4.2.2 Persönliche Frömmigkeit im Psalm 139
- 4.1 Einordnung in die Anthropologie des Gebets
- 5. Motivkritik
- 5.1 Bedeutung des Ausdrucks: „Du legtest Deine Hand auf mich“ (Vers 5).
- 5.2 Biblische Parallelen zu Vers 13: „Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter“
- 5.3 Bedeutung des Ausdrucks "In deinem Buch war alles schon verzeichnet" (Vers 16)
- 5.4 Fühlt sich der Beter von Gott geborgen oder von Gott verfolgt?
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit einer Exegese des Psalms 139 unter Verwendung von Leitfragen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Interpretationen des Psalms zu beleuchten und ein tieferes Verständnis für den Text zu gewinnen. Die Arbeit untersucht die kontroversen Deutungen des Psalms, die zwischen Lobpreis und Angst vor der göttlichen Allgegenwart schwanken.
- Unterschiede in der Interpretation des Psalms 139
- Analyse des Psalmtextes anhand verschiedener Übersetzungsvarianten
- Einordnung des Psalms in die Anthropologie des Gebets
- Bedeutung wichtiger Motive und deren Interpretation
- Literarkritische und gattungskritische Betrachtung des Psalms
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Interpretation des Psalms 139 ein. Sie hebt die kontroversen Ansichten verschiedener Exegeten hervor, die den Psalm entweder als Lobpreis der göttlichen Allgegenwart oder als Ausdruck von Angst und Bedrohung verstehen. Die unterschiedlichen Perspektiven von Auslegern wie Rudolf Kilian, Klaus Seybold und Walter Groß werden kurz skizziert, um die Bandbreite der Interpretationen zu verdeutlichen. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an, die eine anthropologische und kulturspezifische Betrachtung des Textes beinhaltet, inklusive eines Übersetzungsvergleichs, einer literarkritischen und gattungskritischen Analyse sowie einer Motivkritik.
2. Übersetzungsvergleich: Dieses Kapitel vergleicht verschiedene Bibelübersetzungen des Psalms 139, insbesondere die des Münsterschwarzacher Psalters, der Einheitsübersetzung, der Lutherbibel und der Elberfelder Bibel. Der Fokus liegt auf den Abweichungen in der Übersetzung einzelner Schlüsselverse und deren Auswirkungen auf die Interpretation. Der Vergleich zeigt, wie unterschiedliche Wortwahl und grammatische Strukturen zu verschiedenen Nuancen in der Bedeutung führen können. Zum Beispiel wird die unterschiedliche Verwendung von Präsens und Perfekt in der Übersetzung des ersten Verses und die unterschiedliche Konnotation von Verben wie "erforschen", "kennen", "verstehen" und "durchschauen" analysiert.
3. Literarkritik: Dieses Kapitel analysiert den Aufbau des Psalms 139 und untersucht die Bedeutung der umstrittenen Verse 19-22. Die literarkritische Analyse befasst sich mit der Struktur des Textes, um die einzelnen Abschnitte und deren Zusammenhänge zu verstehen. Die Analyse der Verse 19-22, die häufig als problematisch in der Interpretation gelten, wird im Detail betrachtet, um deren Rolle im Gesamtkontext des Psalms zu beleuchten.
4. Gattungskritik: Dieses Kapitel ordnet Psalm 139 in die Anthropologie des Gebets ein. Es werden verschiedene Arten des Gebets diskutiert und der Psalm daraufhin untersucht, welcher Gattung er zuzuordnen ist. Der Fokus liegt auf der Frage nach der persönlichen Frömmigkeit des Beters und wie sich diese im Psalm ausdrückt. Die Analyse betrachtet sowohl das Phänomen der persönlichen Frömmigkeit allgemein als auch deren spezifische Ausprägung im Psalm 139.
5. Motivkritik: In diesem Kapitel werden ausgewählte Motive des Psalms 139 genauer untersucht, darunter der Ausdruck "Du legtest Deine Hand auf mich" (Vers 5), die biblischen Parallelen zu Vers 13 ("Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter"), der Ausdruck "In deinem Buch war alles schon verzeichnet" (Vers 16) und die Frage, ob sich der Beter von Gott geborgen oder verfolgt fühlt. Für jedes Motiv wird seine Bedeutung im Kontext des gesamten Psalms und seine Relevanz für die verschiedenen Interpretationsansätze erörtert. Die Analyse berücksichtigt biblische Parallelen und die theologischen Implikationen der jeweiligen Motive.
Schlüsselwörter
Psalm 139, Exegese, Bibelübersetzung, Literarkritik, Gattungskritik, Motivkritik, Anthropologie des Gebets, Allgegenwärtigkeit Gottes, persönliche Frömmigkeit, Gotteserfahrung, Interpretationsprobleme.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Exegese des Psalms 139
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet eine umfassende Exegese des Psalms 139. Sie untersucht den Psalm unter Verwendung verschiedener methodischer Ansätze, darunter ein Übersetzungsvergleich, literarkritische, gattungskritische und motivkritische Analysen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Interpretationen des Psalms zu beleuchten und ein tieferes Verständnis für den Text zu gewinnen, insbesondere die kontroversen Deutungen zwischen Lobpreis und Angst vor der göttlichen Allgegenwart.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus verschiedenen exegetischen Methoden. Ein Übersetzungsvergleich analysiert Unterschiede zwischen verschiedenen Bibelübersetzungen (Münsterschwarzacher Psalter, Einheitsübersetzung, Lutherbibel, Elberfelder Bibel) und deren Auswirkungen auf die Interpretation. Literarkritisch wird der Aufbau des Psalms und die Bedeutung einzelner Verse untersucht. Die Gattungskritik ordnet den Psalm in die Anthropologie des Gebets ein und betrachtet die persönliche Frömmigkeit des Beters. Die Motivkritik analysiert Schlüsselmotive wie "Du legtest Deine Hand auf mich", "Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter" und "In deinem Buch war alles schon verzeichnet".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Übersetzungsvergleich, Literarkritik, Gattungskritik, Motivkritik und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Psalmexegse, wobei die einzelnen Kapitel aufeinander aufbauen und sich gegenseitig ergänzen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis des Psalms 139 zu ermöglichen, indem sie die verschiedenen Interpretationsansätze beleuchtet und kritisch bewertet. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Untersuchung der kontroversen Deutungen, die zwischen Lobpreis und Angst vor der göttlichen Allgegenwart schwanken.
Welche Schlüsselverse werden genauer untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Schlüsselverse des Psalms 139, unter anderem Vers 5 ("Du legtest Deine Hand auf mich"), Vers 13 ("Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter") und Vers 16 ("In deinem Buch war alles schon verzeichnet"). Die Analyse konzentriert sich auf die Bedeutung dieser Verse im Kontext des gesamten Psalms und deren Relevanz für die verschiedenen Interpretationsansätze.
Welche Bibelübersetzungen werden verglichen?
Der Übersetzungsvergleich beinhaltet die Analyse von mindestens vier Bibelübersetzungen: der Münsterschwarzacher Psalter, die Einheitsübersetzung, die Lutherbibel und die Elberfelder Bibel. Der Vergleich konzentriert sich auf Abweichungen in der Übersetzung einzelner Schlüsselverse und deren Auswirkungen auf die Interpretation des Psalms.
Wie wird der Psalm in die Anthropologie des Gebets eingeordnet?
Die Gattungskritik ordnet den Psalm 139 in die Anthropologie des Gebets ein, indem sie verschiedene Arten des Gebets diskutiert und den Psalm danach untersucht, welcher Gattung er zuzuordnen ist. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der persönlichen Frömmigkeit des Beters und wie sich diese im Psalm ausdrückt.
Welche Schlüsselfragen werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselfragen der Arbeit sind: Unterschiede in der Interpretation des Psalms 139, Analyse des Psalmtextes anhand verschiedener Übersetzungsvarianten, Einordnung des Psalms in die Anthropologie des Gebets, Bedeutung wichtiger Motive und deren Interpretation, sowie literarkritische und gattungskritische Betrachtung des Psalms. Die Frage, ob sich der Beter von Gott geborgen oder verfolgt fühlt, spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Psalm 139, Exegese, Bibelübersetzung, Literarkritik, Gattungskritik, Motivkritik, Anthropologie des Gebets, Allgegenwärtigkeit Gottes, persönliche Frömmigkeit, Gotteserfahrung, Interpretationsprobleme.
- Citation du texte
- Melanie Kloke (Auteur), 2006, Psalm 139 - Eine Exegese anhand von Leitfragen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113603