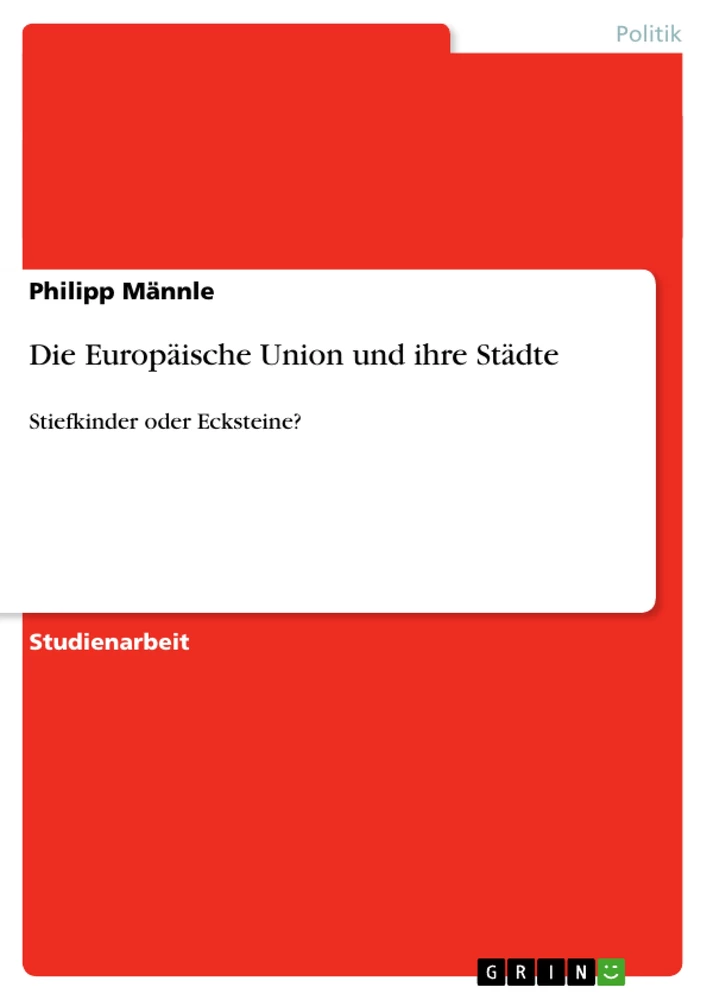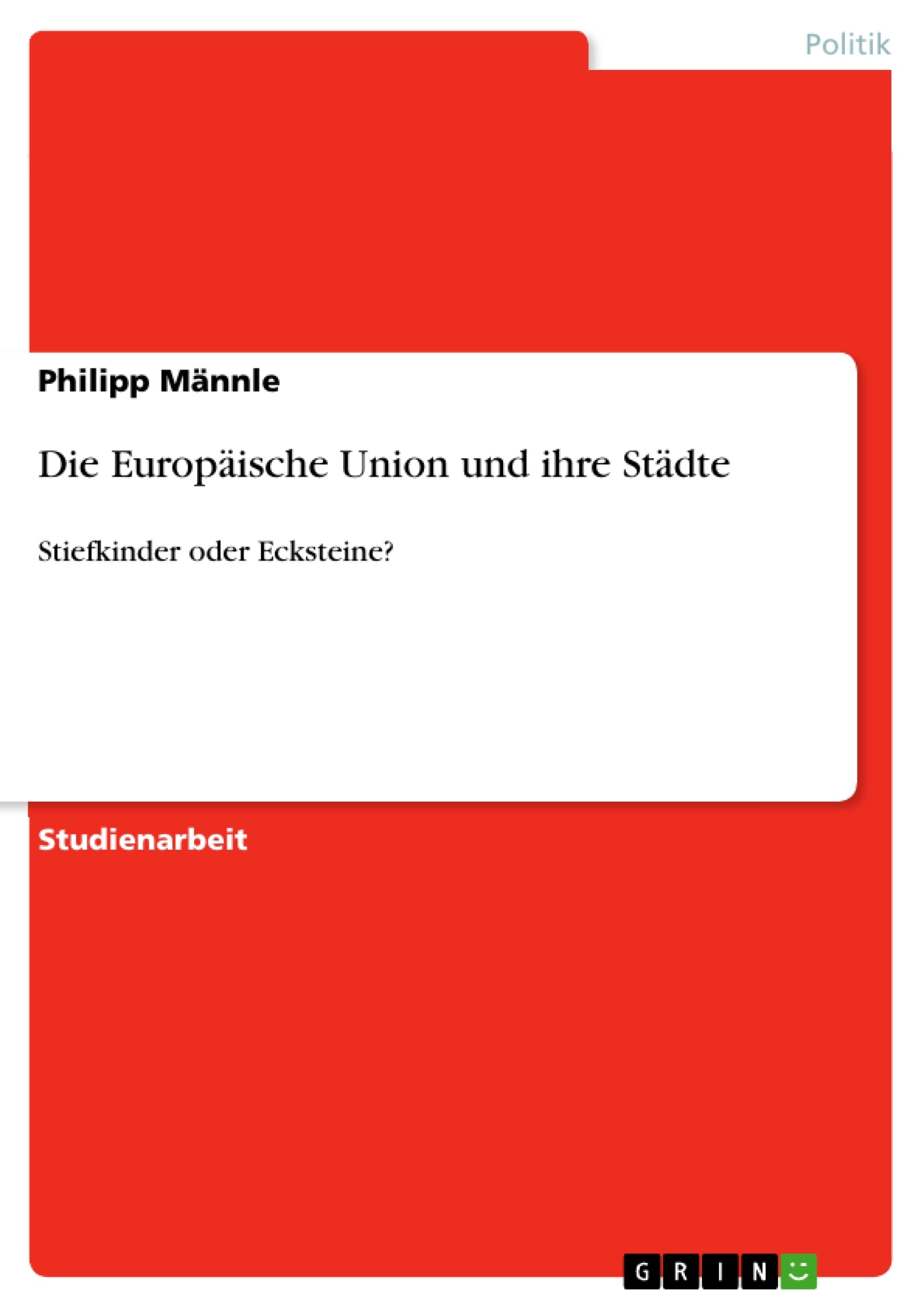»Die Europäische Stadt transzendiert die Gegenwart in beide Richtungen:
durch die Präsenz von Geschichte und durch das Versprechen auf eine offene
Zukunft« (Siebel (2004a) 14).
Wenn Walter Siebel von der Europäischen Stadt schreibt, meint er damit nicht (nur) Paris, Potsdam oder Prag. »Europäische Stadt« ist für ihn ein konzeptioneller Oberbegriff, eine Art Dach, das über den einzelnen europäischen Städten gebaut ist und das diese von den Städten anderer Kontinente unterscheidet. Aber was ist eigentlich die Europäische Stadt?
Ist sie ein bauliches Modell, Utopie, historische Idee? Dieser Text wird sich mit dieser Frage befassen und zunächst eine inhaltliche Füllung des Begriffs »Europäische Stadt« unternehmen.
Hierzu wird in Kapitel II. die Kategorie der »Europäische Stadt« auf theoretischem Wege mithilfe Max Webers methodischem Weg der Idealtypenbildung präzisiert.
Sofern dann die Europäische Stadt dann hinreichend beschrieben ist, lässt sich weiter fragen: Wenn in Europa solche, wie auch immer gearteten Europäischen Städte zu finden sind – was macht Europa dann damit? Weiß Europa überhaupt um die Besonderheit seiner Städte? Fördert Europa die Städte oder stehen europäische politische Vorhaben und Ziele gar in Widerspruch zu deren Bedürfnissen?
Um auf diese Fragen Antwort zu geben, sind zwei weitere, empirisch ausgerichtete Schritte zu gehen. Hierbei wird untersucht, ob – und, falls ja: wie – sich die europäische Politik – das heißt im konkreten: das Agieren der Europäische Union, speziell im Hinblick auf das Handeln der Europäischen Kommission als initiierender Akteur – auf die Europäischen Städte auswirken. Kapitel III. wird sich dabei mit Politikfeldern befassen, auf denen die
dysfunktionale Implikationen der europäischen Politik beobachtbar sind. Kapitel IV. hingegen wird sich den förderlichen Auswirkungen widmen und zeigen, wo die EU ihre Städte unterstützt. In einem abschließenden Fazit in Kapitel V. wird es dann möglich sein, eine Antwort auf die im Titel formulierte, Leitfrage – »Die Europäische Union und ihre Städte – Stiefkinder oder Ecksteine?« – zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Die Europäische Union und ihre Städte – Einführung
- Die Europäische Stadt
- Die antike pólis - Archetyp der Europäischen Stadt
- Die Stadt im Mittelalter - Mauer, Markt und Rathaus
- Die moderne Stadt - Expansive Leistungs- und Versorgungsstadt
- Die Europäische Stadt der Postmoderne – Anonymität und Nachhaltigkeit
- Fazit: Der Idealtyp »>Europäische Stadt<<
- Die europäischen Städte – Stiefkinder der EU?
- Die (Stadt-) Bürgerschaft in der Europäischen Union - Vote und Voice
- Kompakte Stadt vs. Europäische Stadtregionen
- Kommunale Daseinsvorsorge vs. Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
- Europäische Städte im dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt
- Europäische Städtepolitik - ein Widerspruch an sich?
- Subsidiarität oder Substitution?
- Ein Städtenetz in Europa?
- Öffentliche Stadt und Informationsgesellschaft
- Qualität statt Quantität – Schrumpfung in den europäischen Städten
- Umweltbewusstsein und Lebensqualität – Stadtökologie in Europa
- Stadtfunktionen in Europa - Sensibilität und Unterstützung
- Conclusio
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen der Europäischen Union und ihren Städten. Sie untersucht, ob die Europäische Union die Städte als Ecksteine oder eher als Stiefkinder betrachtet und welche Auswirkungen die europäische Politik auf die Entwicklung der Städte hat.
- Der Begriff der »Europäischen Stadt« und seine historische Entwicklung
- Die Rolle der Städte in der Europäischen Union
- Die Auswirkungen der europäischen Politik auf die Städte
- Die Bedeutung von Subsidiarität und Substitution in der Stadtpolitik
- Die Herausforderungen und Chancen für die europäischen Städte im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Begriffs »Europäische Stadt« und versucht, diesen mithilfe des methodischen Wegs der Idealtypenbildung nach Max Weber zu präzisieren. Es werden vier charakteristische Epochen der europäischen Stadtgeschichte – Antike, Mittelalter, Moderne und Postmoderne – betrachtet und die jeweiligen Eigenarten der Städte in diesen Epochen herausgearbeitet.
Das dritte Kapitel analysiert die Auswirkungen der europäischen Politik auf die Städte. Es werden verschiedene Politikfelder betrachtet, auf denen die Europäische Union Einfluss auf die Städte nimmt, und es wird untersucht, ob diese Politik den Bedürfnissen der Städte gerecht wird.
Das vierte Kapitel widmet sich der Frage, ob die Europäische Union die Städte eher unterstützt oder behindert. Es werden Beispiele für die Förderung von Städten durch die EU aufgezeigt, aber auch die Grenzen dieser Förderung werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Europäische Stadt, die Europäische Union, Stadtpolitik, Subsidiarität, Substitution, Stadtentwicklung, Stadtökologie, Lebensqualität, Bürgerbeteiligung, Informationsgesellschaft, Schrumpfung, Wirtschaftsraum, und die Herausforderungen und Chancen für die europäischen Städte im 21. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Idealtyp der "Europäischen Stadt"?
Nach Walter Siebel und Max Weber ist es ein konzeptioneller Begriff für Städte, die durch eine spezifische Geschichte (Präsenz von Geschichte) und das Versprechen auf eine offene Zukunft geprägt sind.
Welche Epochen prägten die europäische Stadtgeschichte?
Die Arbeit unterscheidet die antike Polis, die mittelalterliche Stadt (Markt/Rathaus), die moderne Versorgungsstadt und die postmoderne Stadt.
Wie beeinflusst die EU-Politik die Städte?
Die EU wirkt durch verschiedene Politikfelder auf Städte ein, wobei es Spannungsfelder zwischen kommunaler Daseinsvorsorge und dem europäischen Wettbewerbsrecht gibt.
Sind Städte für die EU "Stiefkinder oder Ecksteine"?
Diese Leitfrage untersucht, ob die EU städtische Bedürfnisse fördert oder ob politische Ziele (z.B. Binnenmarkt) im Widerspruch zu städtischen Strukturen stehen.
Welche Rolle spielt die Stadtökologie in Europa?
Umweltbewusstsein und Lebensqualität sind zentrale Themen der modernen europäischen Stadtpolitik, die von der EU zunehmend unterstützt werden.
- Arbeit zitieren
- Dipl.Verw.wiss.; M.A. Philipp Männle (Autor:in), 2004, Die Europäische Union und ihre Städte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113630