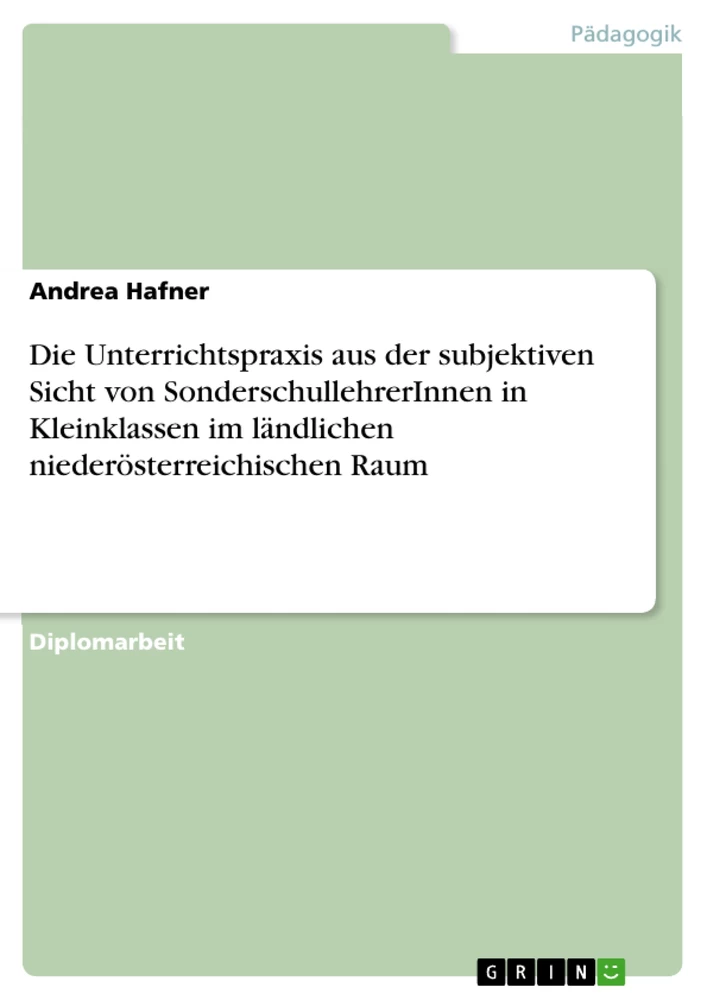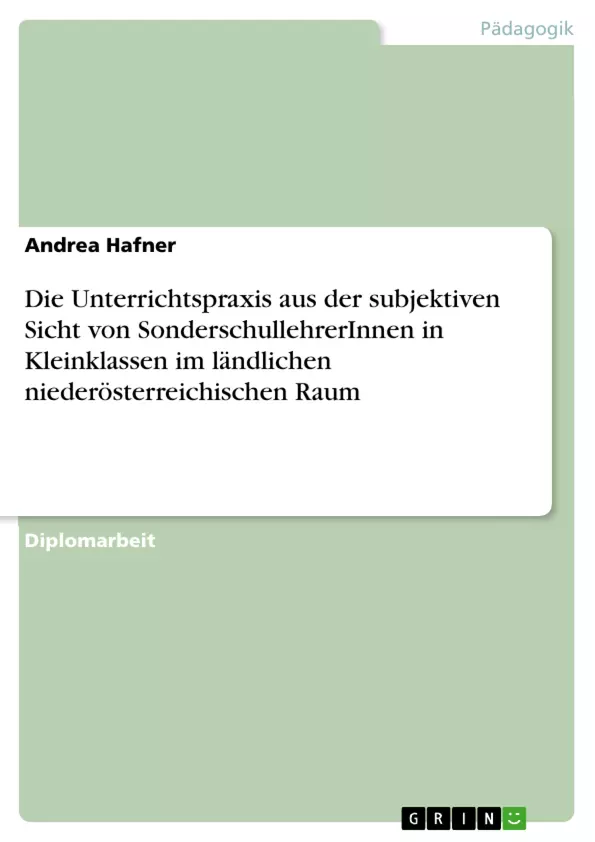Auf zahlreichen Fachtagungen und in der einschlägigen Fachliteratur ist bereits seit einigen Jahren die Rede davon, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in den Sonderschulen überrepräsentiert sind (vgl. u.a. Auernheimer 2001, Leiprecht und Kerber 2005, Merz- Atalik 2001).
Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit lässt sich wie folgt zusammenfassen: Wie verändert sich die Unterrichtspraxis aus der subjektiven Sicht von SonderschullehrerInnen in den Kleinklassen im ländlichen niederösterreichischen Bereich, wenn Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Klasse sind?
Die Ergebnisse der durchgeführten Befragung zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den befragten Kleinklassen der
Allgemeinen Sonderschulen im ländlichen niederösterreichischen Bereich einen individuellen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Unterricht erhalten. Dieser bedeutet für die befragten LehrerInnen keine Mehrbelastung, da sie es gewohnt sind, für jede SchülerIn eine auf deren individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Vorbereitung machen zu müssen.
Das heißt, der Unterricht verändert sich aus der Sicht der befragten
SonderschullehrerInnen nicht, wenn Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Klasse sind. Die Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund erhalten also einen speziell auf sie zugeschnittenen
Unterricht, können aber trotzdem nicht optimal gefördert werden, durch die
Barrieren der Institution Sonderschule. Einerseits erzielen sie in der
Regelschule bessere Lernerfolge (vgl. Studie von Kronig, Haeberlin und Eckart in Kornmann 2003, 7) und andererseits dadurch, weil die Sonderschule stigmatisierend wirkt und deren Absolventen meist in ihrem Berufs- und Lebenschancen massiv beeinträchtigt sind (vgl. Eberwein 1996, 206).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
- Definition
- Lebenssituation der Menschen mit Migrationshintergrund
- Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Ergebnisse der PISA- Studie 2003
- Die besondere Zweisprachigkeit von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Mögliche Gründe für die Sonderbeschulung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Sozioökonomische, -kulturelle und psychosoziale Faktoren
- Sprach- und Verständnisschwierigkeiten
- Diagnostik und Leistungsbeurteilung
- Strukturelle Aspekte
- Das Bildungswesen
- Daten und Fakten zu Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund an Sonderschulen in Österreich
- Unterricht in heterogenen und interkulturellen Klassen
- Begriffsbestimmungen
- Interkulturalität
- Interkulturelles Lernen
- Interkulturelle Kompetenz
- Interkultureller Unterricht und Interkulturelle Kompetenz
- Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule
- Der monolinguale Habitus
- Die Sprache der Mehrheit ist die einzige erlaubte Sprache
- Der Frontalunterricht ist die angestrebte Unterrichtsform
- Kooperation zwischen den ein- und zweisprachigen LehrerInnen
- Empirischer Teil
- Fragen zur Unterrichtssituation
- SchülerInnenbezogene Fragen
- Fragen zur Zusammenarbeit mit Eltern und Kolleginnen
- Fragen zur Ausbildung und Arbeitsbedingungen von LehrerInnen
- Ergebnisse der Untersuchung
- Fragen zur Unterrichtssituation
- SchülerInnenbezogene Fragen
- Fragen zur Zusammenarbeit mit Eltern und Kolleginnen
- Fragen zur Ausbildung und Arbeitsbedingungen von LehrerInnen
- Ergebnisse im Vergleich zu den Ausführungen von Schader und Gogolin
- Basil Schader
- Ingrid Gogolin
- Zusammenfassung
- Ausblick
- Anhang
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Unterrichtspraxis in Kleinklassen von Sonderschulen im ländlichen niederösterreichischen Raum, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Die Arbeit untersucht, wie sich die Unterrichtspraxis aus der subjektiven Sicht von SonderschullehrerInnen verändert, wenn Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Klasse sind.
- Die Lebenssituation und Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Die besonderen Herausforderungen der Zweisprachigkeit von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Die Rolle der Sonderschule in der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Die Unterrichtspraxis in heterogenen und interkulturellen Klassen
- Die subjektiven Erfahrungen von SonderschullehrerInnen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Veränderung der Unterrichtspraxis aus der subjektiven Sicht von SonderschullehrerInnen in Kleinklassen im ländlichen niederösterreichischen Raum, wenn Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Klasse sind.
Das erste Kapitel beleuchtet die Lebenssituation und Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Österreich. Es werden Definitionen, Statistiken und Ergebnisse von Studien präsentiert, die die Herausforderungen und Chancen der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in das österreichische Bildungssystem aufzeigen.
Das zweite Kapitel widmet sich den Daten und Fakten zu Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund an Sonderschulen in Österreich. Es werden Statistiken und Analysen präsentiert, die die Überrepräsentation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Sonderschulen beleuchten.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Unterricht in heterogenen und interkulturellen Klassen. Es werden verschiedene Konzepte und Ansätze des interkulturellen Lernens und der interkulturellen Kompetenz vorgestellt.
Der empirische Teil der Diplomarbeit präsentiert die Ergebnisse einer Befragung von SonderschullehrerInnen in Kleinklassen im ländlichen niederösterreichischen Raum. Die Befragung untersucht die Unterrichtspraxis, die Zusammenarbeit mit Eltern und Kolleginnen sowie die Ausbildung und Arbeitsbedingungen von LehrerInnen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Unterrichtspraxis, SonderschullehrerInnen, Kleinklassen, ländlicher Raum, Niederösterreich, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Integration, Heterogenität, Interkulturalität, interkulturelles Lernen, interkulturelle Kompetenz, Bildungsbeteiligung, Sonderschule, Stigmatisierung, Ausbildung, Arbeitsbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Sind Kinder mit Migrationshintergrund in Sonderschulen überrepräsentiert?
Ja, Fachliteratur und Daten aus Österreich zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund überproportional häufig in Sonderschulen beschult werden.
Wie empfinden Sonderschullehrer den Unterricht mit Migrantenkindern?
Laut der Befragung empfinden Lehrer dies oft nicht als Mehrbelastung, da sie ohnehin an individuelle Vorbereitungen für Kleinklassen gewöhnt sind.
Welche Barrieren verhindert eine optimale Förderung in der Sonderschule?
Neben strukturellen Aspekten wirkt die Sonderschule oft stigmatisierend, was die Berufs- und Lebenschancen der Absolventen massiv beeinträchtigen kann.
Was ist der "monolinguale Habitus" der Schule?
Es beschreibt die Tendenz des Bildungswesens, Einzelsprachigkeit als Norm zu setzen, wodurch die Mehrsprachigkeit von Migrantenkindern oft als Defizit statt als Ressource wahrgenommen wird.
Welche Rolle spielen Sprachschwierigkeiten bei der Sonderschulzuweisung?
Sprachbarrieren führen oft dazu, dass die kognitiven Fähigkeiten der Kinder falsch eingeschätzt werden, was zu einer Überweisung in die Sonderschule führen kann.
- Quote paper
- Mag. Andrea Hafner (Author), 2007, Die Unterrichtspraxis aus der subjektiven Sicht von SonderschullehrerInnen in Kleinklassen im ländlichen niederösterreichischen Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113637