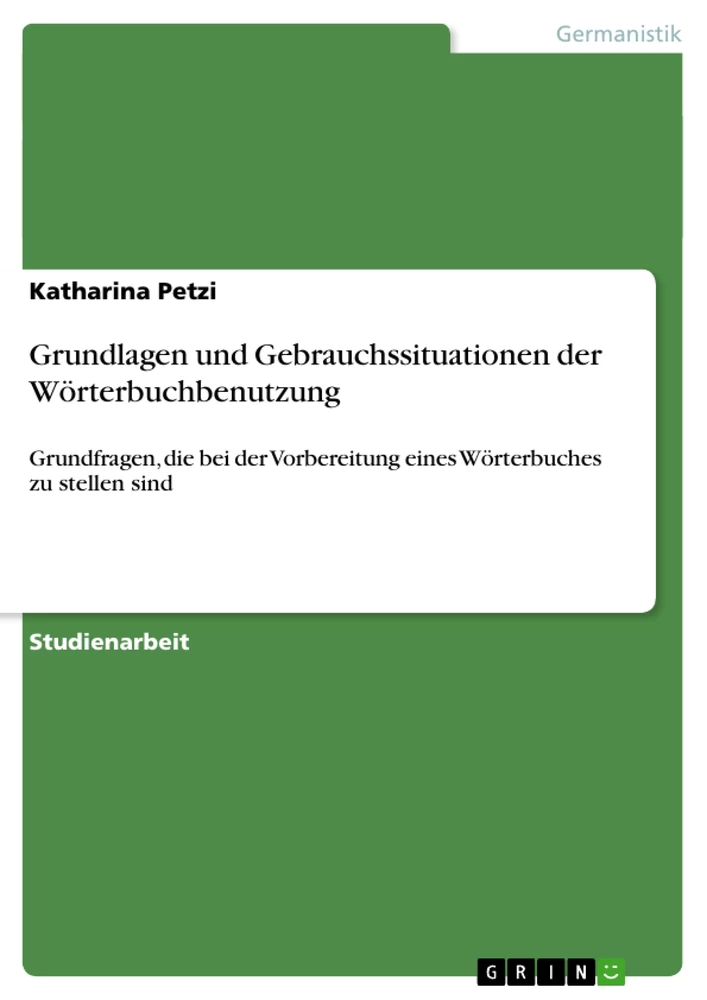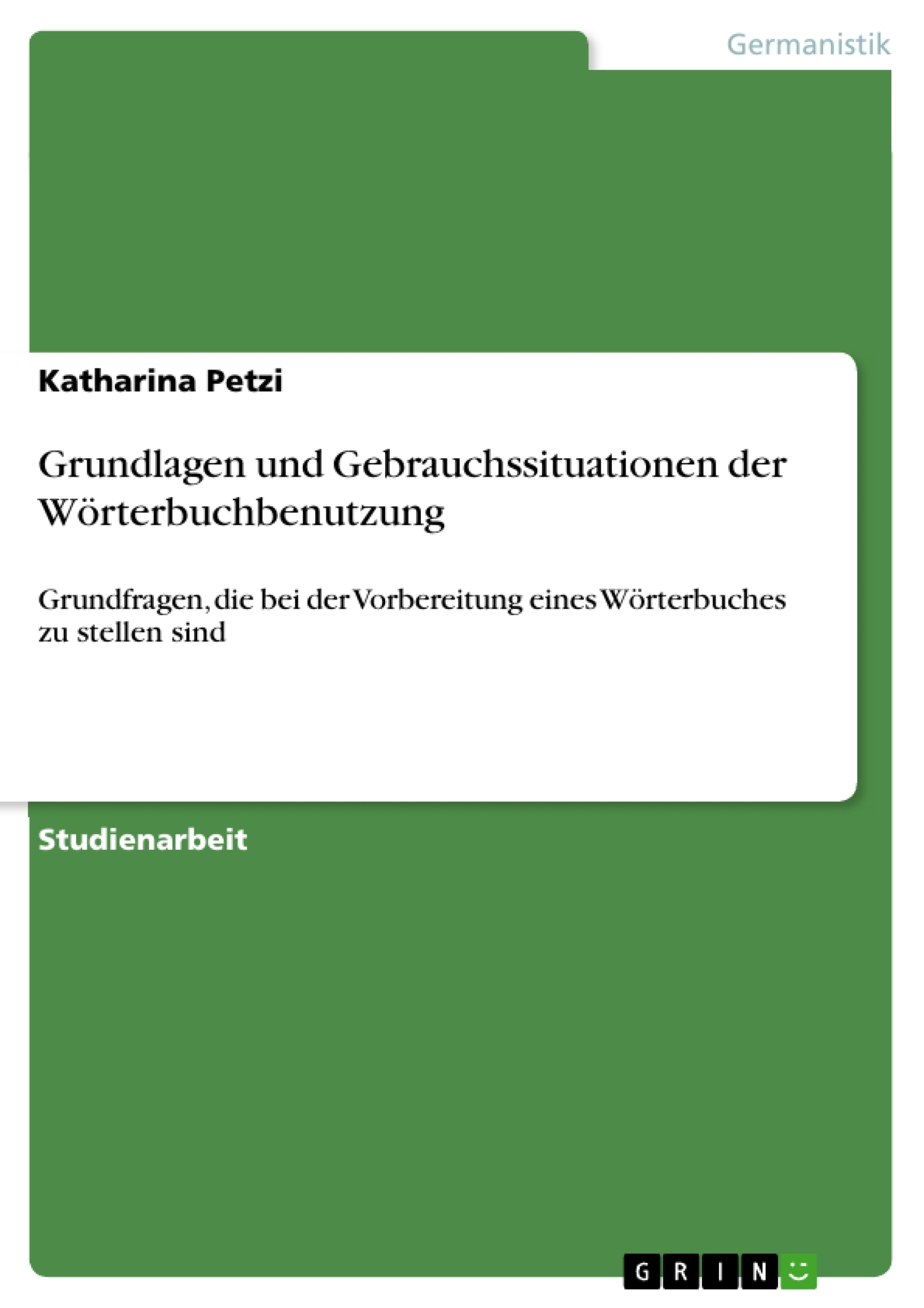Von Kindesbeinen an wird das menschliche Dasein von aneinander gereihten Buchstaben geprägt. Neben dem automatischen Erlernen der Muttersprache bekommt jeder Mensch nach und nach Kontakt zu Gedrucktem. Dieser entsteht anfänglich meist durch abendliche Vorlesestunden im Kleinkindalter. Bücher, Zeitschriften und Zeitungen begleiten den Menschen auf dem Weg vom ABC-Schützen bis zum Erwachsenwerden.
Kurz gesagt:
Buchstaben, Wörter, Sätze, Texte sind ständig präsent. Sie prägen und gestalten den menschlichen Alltag, das Erfassen und Verfassen von Texten, sind Grundvoraussetzungen für Bildung und Lebenstüchtigkeit. Dass es bei Textrezeption und Textproduktion, also beim Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören, angesichts der enormen Fülle von Wörtern, Ausdrucksweisen oder grammatikalischen Kombinationsmöglichkeiten einer Sprache zu
Verständnisproblemen kommen kann, ist klar. Dann erfolgt der Griff zum Wörterbuch, das wie selbstverständlich neben Kinderbüchern, Sachbüchern und Romanen in den Bücherregalen vieler Haushalte einen festen Platz hat. Dabei bleibt die wichtige kulturelle, gesellschaftliche oder auch politische Bedeutung der Wörterbücher weitgehend ungeachtet.
Der neue „Mankell“ findet mit Sicherheit größere Aufmerksamkeit als eine Neuauflage des „Dudens“, des wohl renommiertesten Wörterbuches.
Während Autoren berühmter Romane für ihre Verdienste gefeiert werden, bleiben die Verfasser von Wörterbüchern eher im Hintergrund. Ihre Arbeit ist jedoch nicht leicht. Mehr als jeder andere Autor müssen sie sich im Vorfeld an ihre künftigen „Leser“ annähern. Dabei müssen sie sich durch theoretische Überlegungen in den Benutzer des Wörterbuches hineindenken und sein potentielles Verständnisproblem erahnen. Es ist nötig, mögliche
Fragestellungen der Kommunikation auszuloten, um dem Wörterbuchbenutzer optimale
Lösungen zu liefern. Wie sehen nun diese theoretischen Überlegungen aus?
Inhaltsverzeichnis
- WÖRTERBÜCHER ALS SELBSTVERSTÄNDLICHE BEGLEITER
- WICHTIGE ÜBERLEGUNGEN VOR BEGINN DER WÖRTERBUCHPRODUKTION
- DIE SUCHE NACH DEM UNBEKANNTEN WÖRTERBUCHBENUTZER
- VERSCHIEDENSTE WÖRTERBUCH-BENUTZUNGSSITUATIONEN
- DIE WORTLÜCKE ALS SIMPLEXLÜCKE
- DIE WORTBEDEUTUNGSLÜCKE
- DIE WORTLÜCKE ALS ABLEITUNGSLÜCKE
- DIEWORTLÜCKE ALS KOMPOSITUMLÜCKE
- DIE WORTREZEPTIONSUNSICHERHEIT
- DIE WORTDIFFERENZIERUNGSLÜCKE
- PHRASEOLOGISCH BEDINGTE REZEPTIONSSTÖRUNGEN
- DIE LEXIKALISCH-SEMANTISCHE GENERALISIERUNG
- DIE LEXIKALISCH-SEMANTISCHE SPEZIFIZIERUNG
- DIE LEXIKALISCH-SEMANTISCHE NUANCIERUNG
- DIE LEXIKALISCH –SEMANTISCHE POLARISIERUNG
- DIE LEXIKALISCH-SEMANTISCHE BEDEUTUNGSDIFFERENZIERUNG
- EIN WÖRTERBUCH FÜR ALLES?
- BENUTZERBEDÜRFNISSE MÜSSEN AUCH GEWECKT WERDEN
- DAS WÖRTERBUCH - VERBUNDEN MIT STAATLICHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN INTERESSEN
- LITERATURANGABEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Grundlagen und Gebrauchssituationen der Wörterbuchbenutzung. Sie analysiert die verschiedenen Motivationen und Bedürfnisse von Wörterbuchbenutzern und untersucht die Herausforderungen, die sich bei der Erstellung eines Wörterbuches ergeben. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Benutzerhypothese und die Notwendigkeit, den unbekannten Wörterbuchbenutzer zu verstehen.
- Die Bedeutung der Wörterbuchbenutzung für die Kommunikation und das Verständnis von Sprache
- Die Herausforderungen der Wörterbuchproduktion und die Notwendigkeit, den Benutzerkreis zu definieren
- Die verschiedenen Motivationen und Bedürfnisse von Wörterbuchbenutzern
- Die Rolle der empirischen Sozialforschung bei der Erforschung der Wörterbuchbenutzung
- Die Bedeutung der Benutzerhypothese für die Erstellung eines erfolgreichen Wörterbuches
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die allgegenwärtige Präsenz von Wörtern und Texten im menschlichen Leben und die Bedeutung von Wörterbüchern als Hilfsmittel zur Bewältigung von Verständnisproblemen. Es wird die Bedeutung der Wörterbuchbenutzung für Bildung und Lebenstüchtigkeit hervorgehoben und die Herausforderungen für Lexikographen bei der Annäherung an den unbekannten Benutzerkreis beschrieben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den wichtigen Überlegungen, die vor Beginn der Wörterbuchproduktion zu treffen sind. Es werden die vier Hypothesen - Notwendigkeits- und Zweckhypothese, Benutzerhypothese, Umfangs- und Bearbeitungszeithypothese sowie Verfasserhypothese - vorgestellt und ihre Bedeutung für die Erstellung eines erfolgreichen Wörterbuches erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Suche nach dem unbekannten Wörterbuchbenutzer. Es wird die Schwierigkeit, einen gesicherten Benutzerkreis zu definieren, betont und die Notwendigkeit, sich dem Benutzer durch empirische Sozialforschung zu nähern, hervorgehoben. Der Fragenkatalog von Herbert E. Wiegand wird als Beispiel für die Erforschung der Benutzerbedürfnisse vorgestellt.
Das vierte Kapitel analysiert verschiedene Situationen der Wörterbuchbenutzung, die auf semantische Motivationen zurückzuführen sind. Es werden verschiedene Arten von Wortlücken und Rezeptionsproblemen vorgestellt, die den Benutzer zum Wörterbuch greifen lassen. Die Kapitelüberschriften geben einen Einblick in die verschiedenen Situationen, die im Detail behandelt werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Wörterbuchbenutzung, die Benutzerhypothese, die Lexikographie, die Semantik, die empirische Sozialforschung und die verschiedenen Motivationen und Bedürfnisse von Wörterbuchbenutzern. Der Text beleuchtet die Herausforderungen der Wörterbuchproduktion und die Bedeutung der Benutzerorientierung bei der Erstellung eines erfolgreichen Wörterbuches.
Häufig gestellte Fragen
Warum benutzen Menschen Wörterbücher?
Wörterbücher werden meist zur Klärung von Wortbedeutungen, Rechtschreibung, Grammatik oder bei Verständnisproblemen in der Textrezeption und -produktion verwendet.
Was ist die "Benutzerhypothese" in der Lexikographie?
Dies ist die theoretische Annahme der Wörterbuchautoren über die Bedürfnisse, Vorkenntnisse und typischen Probleme ihrer potenziellen Leser.
Welche Arten von "Wortlücken" gibt es?
Es wird zwischen Simplexlücken (unbekanntes Wort), Bedeutungslücken, Ableitungslücken und Kompositumlücken unterschieden.
Welche Rolle spielt die empirische Sozialforschung für Wörterbücher?
Sie hilft dabei, das tatsächliche Benutzungsverhalten zu untersuchen, um Wörterbücher benutzerfreundlicher und zielgerichteter zu gestalten.
Ist der Duden das einzige wichtige Wörterbuch in Deutschland?
Der Duden ist das renommierteste Werk, aber es gibt eine Vielzahl spezialisierter Wörterbücher für Fachsprachen, Dialekte oder Lernerbedürfnisse.
- Citation du texte
- Katharina Petzi (Auteur), 2005, Grundlagen und Gebrauchssituationen der Wörterbuchbenutzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113649