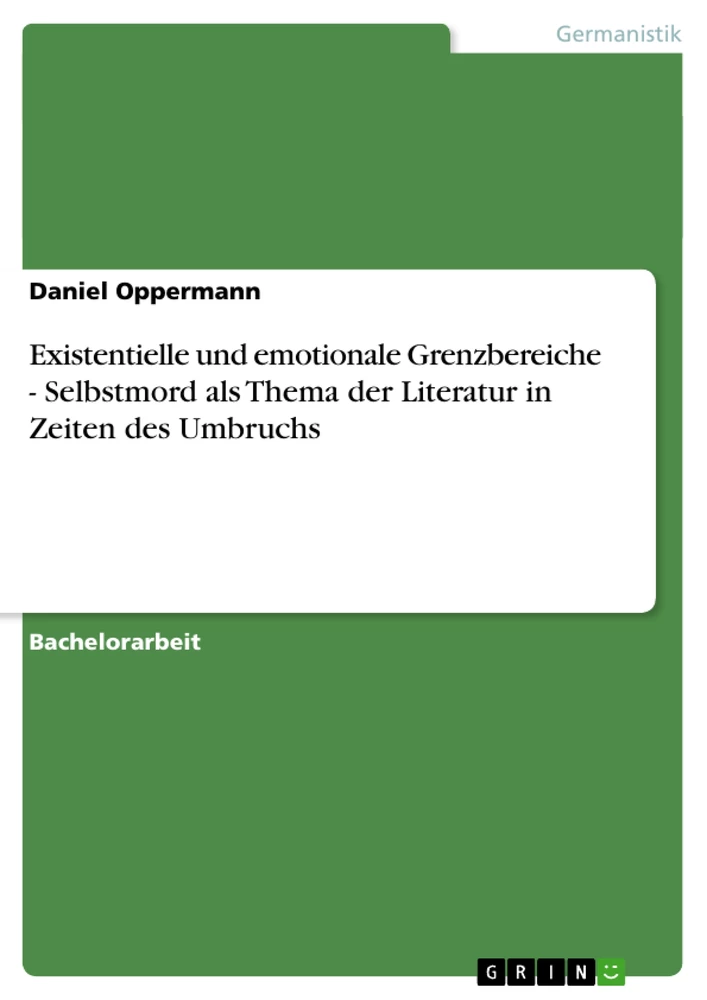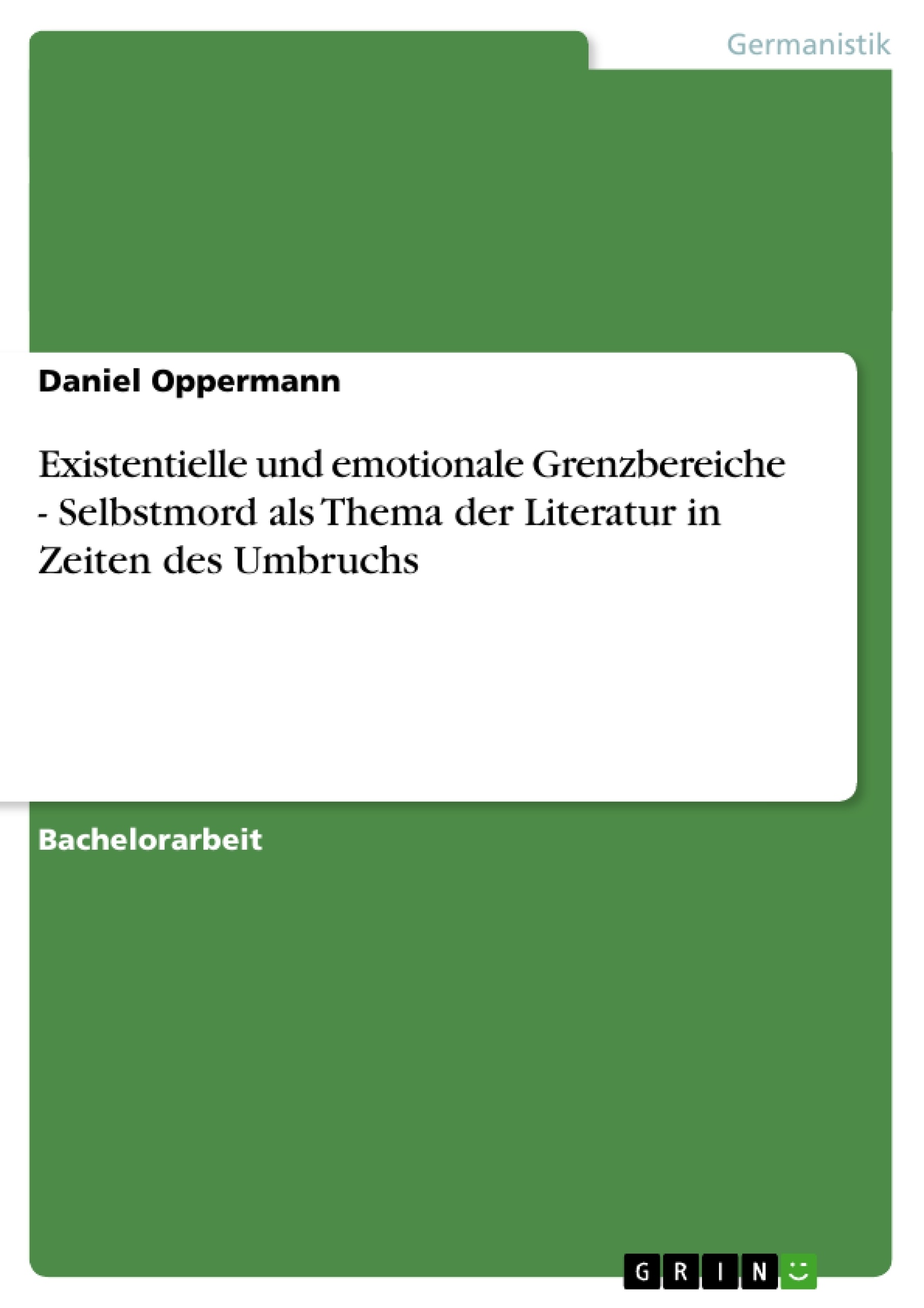Der Tod ist einer der existentiellen und emotionalen Grenzbereiche. Der Mensch hat die Möglichkeit diese Grenze aktiv und eigenhändig zu überschreiten – freiwillig in den Tod zu gehen, oder etwa nicht? Oder ist der Selbstmord das Produkt des Teufels, vielleicht gar das eines strafenden Gottes? Wenn man an die Existenz eines freien Willens glaubt, dann ist zu diskutieren ob ein Selbstmord als ein moralisch gut entschiedener Akt vollzogen werden kann. Mit der Entwicklung von Modellen der modernen Psyche, die vielleicht nur
physiologischen Prozessen unterwürfig sind, kommt eine weitere Dimension hinzu. Innerhalb dieser ist der Suizid das Ergebnis eines psychischen und körperlichen Misstandes – was heute wohl allgemein als Volkskrankheit Depression gilt.
In der Literatur wird das Phänomen des Selbstmords seit jeher als kulturelles Motiv überliefert, als Problem diskutiert, als Akt der Freiheit verehrt, als Ende eines selbst- oder fremdbestimmten elenden Daseins markiert. Oder es wird einfach nur dargestellt. Der Selbstmord des Sokrates bei Platon, die angedeutet mögliche Selbstentleibung des Iweins von Hartman von Aue, der schändliche Tod des Judas in der Bibel, auch denke man hier an Dantes Göttliche Komödie, in den Kreisen des Infernos begegnet man dem ein oder anderen Selbstmörder, in der Geschichte der Literatur schreckte man nicht davor zurück Jesus zum
Archetypus des christlichen Selbstmörders zu stilisieren, natürlich Johan Wolfgang von Goethes Roman Die Leiden des Jungen Werthers, das Urteil von Franz Kafka, Hermann Hesses Steppenwolf oder Unterm Rad sind nur einige der prominentesten Beispiele.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeiten des Umbruchs
- Die Umbrüche des 18. Jahrhunderts und der Selbstmord
- Der Werther als Paradigma der Umbruchszeit
- Die Leiden des Jungen Werthers
- Der Urkonflikt und der tragische Weg
- Artverwandte Diskurse und potentielle Wege
- Kritische Stimmen vs. Wertherfieber
- Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Phänomenologie des Freitods in der Umbruchszeit des 18. Jahrhunderts. Es soll versucht werden den Grenzbereich des Suizids auszuloten. Die moralische, anthropologisch-psychologische und theologische Erfahrungs- und Vorstellungswelt des 18. Jahrhunderts sind hier näher zu beleuchten. Diese Welt der existenziellen und emotionalen Grenzlinien soll nun in der Literatur, die das 18. Jahrhundert betrifft, aufgezeigt werden.
- Die moralische und gesellschaftliche Kontroverse um den Selbstmord im 18. Jahrhundert
- Die Rolle des Selbstmords in der Literatur des 18. Jahrhunderts
- Die Bedeutung von Goethes "Die Leiden des Jungen Werthers" für die Selbstmorddebatte
- Die Auswirkungen des Werther-Romans auf die Gesellschaft
- Die anthropologisch-philosophischen und theologischen Aspekte des Selbstmords
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Selbstmord als existentiellen und emotionalen Grenzbereich ein und stellt die Relevanz des Themas in der Literatur dar. Sie beleuchtet die verschiedenen Begriffsbedeutungen von Selbstmord und die unterschiedlichen Perspektiven auf das Phänomen. Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile: die Analyse der Selbstmorddebatte anhand relevanter Literatur und die Untersuchung des Werther-Romans im Hinblick auf den Selbstmord.
Das Kapitel "Zeiten des Umbruchs" analysiert die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen des 18. Jahrhunderts, die die Selbstmorddebatte prägten. Es werden die antiken Wurzeln der Selbstmorddebatte bei Platon, Aristoteles und Seneca beleuchtet, sowie die christliche Lehre und ihre Rezeption der Antike. Das Kapitel zeichnet die moralische Kontroverse des 18. Jahrhunderts nach, die durch den Wandel von christlich-religiösen zu aufklärerischen Denkweisen geprägt war. Es werden religiöse Traktate, David Hume als Selbstmordapolget und Jean Jaque Rousseau als Gegenposition vorgestellt. Die allgemeine Auffassung der Selbstentleibung, die Gesetzeslage und die medizinische und psychologische Erfahrungswelt des 18. Jahrhunderts werden ebenfalls skizziert.
Das Kapitel "Die Leiden des Jungen Werthers" untersucht Goethes Roman im Hinblick auf den Selbstmord. Es werden die charakteristischen Merkmale des Werthers für die Umbrüche des 18. Jahrhunderts analysiert und die Leiden des Werthers näher beleuchtet. Die Arbeit identifiziert grundlegende Argumente der Selbstmorddebatte, die auf die Umwälzungen der Zeit bezogen werden. Es werden relevante Textbeispiele herangezogen, um den Selbstmord als Thema des Werthers innerhalb der Umbruchszeit zu erörtern. Die kontroverse Wirkung des Romans und seine immense Rezeption werden grob nachgezeichnet, wobei die vehement kritischen Argumente des Theologen Johann Melchior Goezes im Kontrast zur emphatischen Rezeption des Werthers stehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Selbstmord, die Umbruchszeit des 18. Jahrhunderts, die moralische und gesellschaftliche Kontroverse um den Selbstmord, die anthropologisch-philosophischen und theologischen Aspekte des Selbstmords, Goethes "Die Leiden des Jungen Werthers" und die Rezeption des Werther-Romans.
- Citation du texte
- Daniel Oppermann (Auteur), 2008, Existentielle und emotionale Grenzbereiche - Selbstmord als Thema der Literatur in Zeiten des Umbruchs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113664