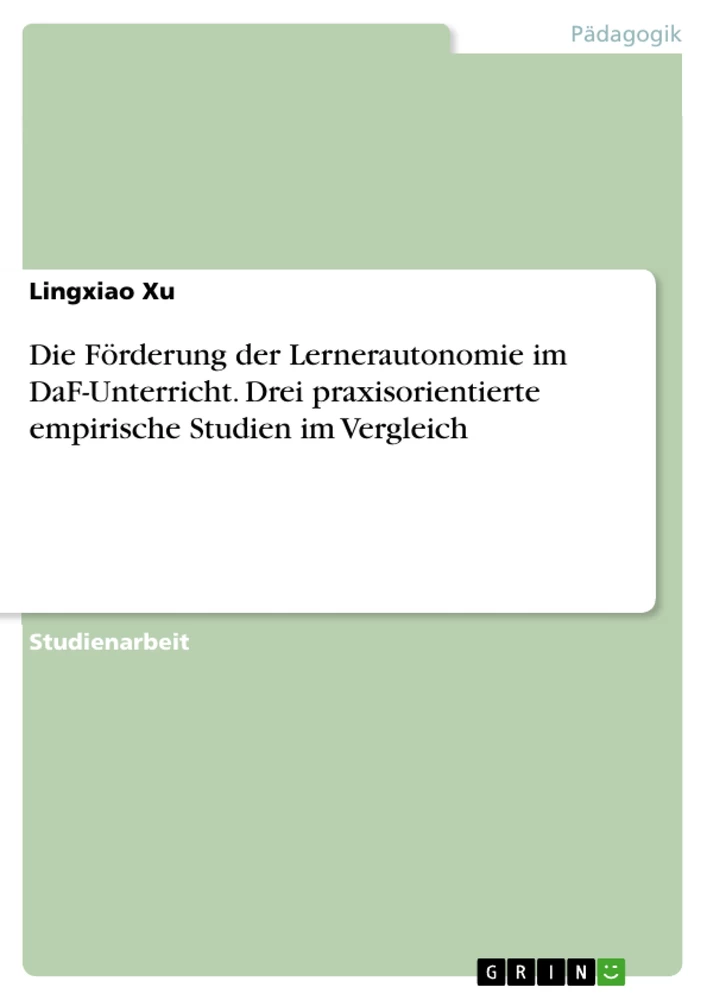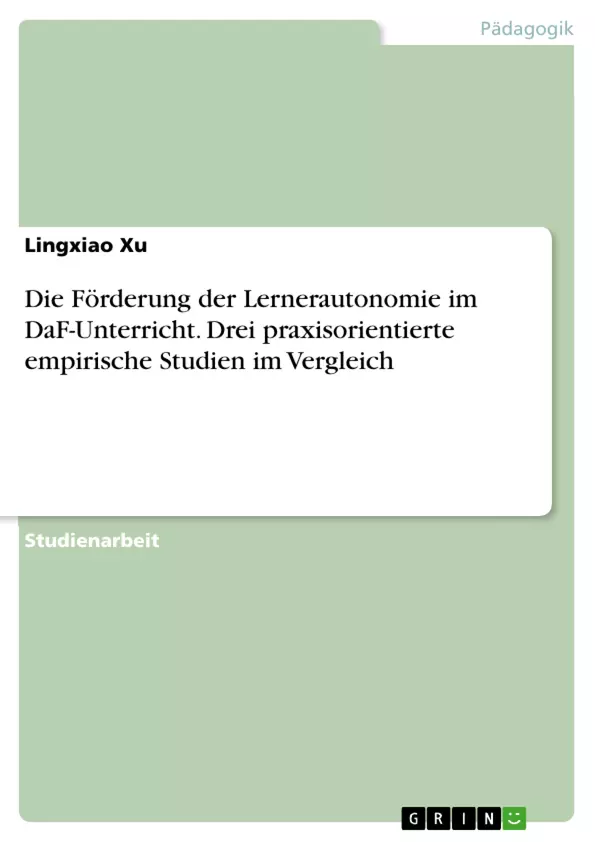Diese Hausarbeit beschäftigt sich damit, wie die Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht, besonders im DaF-Unterricht, gefördert wird.
Um diese Frage zu beantworten, versuche ich in dieser Arbeit, drei praxisorientierte empirische Studien für die Förderung der Lernerautonomie im DaF-Unterricht zu vergleichen und über sie zu reflektieren, um die möglichen notwendigen Voraussetzungen für die Förderung der Lernerautonomie im DaF-Unterricht und die möglichen praktizierten Mittel dafür zu finden.
Jeder Lerner hat seine eigenen unterschiedlichen Motivationen, Erfahrungen, Fähigkeiten, und Lernstile für das Lernen einer Sprache. Das Lernen wird als Prozess der Informationsverarbeitung aufgefasst, der die Aktivierung des vorhandenen Wissens und die immer neue Strukturierung des gesamten Wissens beinhaltet. Es ist notwendig, solche individuellen unterschiedlichen Faktoren im Fremdsprachenunterricht zu berücksichtigen, um den Lernprozess der verschiedenen Lernenden adäquat zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die bestehende Konzeptionen der Lernerautonomien in der Fremdsprachedidaktik.
- Die situativ-technizistische Autonomiekonzeption
- Handlungstheoretische Autonomiekonzeption (Henri Holec)
- Strategisch-technische Autonomiekonzeption
- Konstruktivistische Autonomiekonzeption
- Entwicklungspsychologische Autonomiekonzeption (David Little)
- Pädagogisch-fächerübergreifende Autonomiekonzeption
- Darstellungen der Zusammenfassung und Reflexion der empirischen Studien
- Die Studie von Bouchama (2019): Lernerautonomie in der Praxis des DaF-Unterrichts: Anwendungsmöglichkeiten durch handlungsorientierte Unterrichtsaktivitäten und Lernstrategievermittlung
- Reflexion über die Studie von Bouchama (2019):
- Die Studie von Al Marqini (2018): Lernerautonomie im DaF-Unterricht für arabische Lernende – Eine empirische Untersuchung zur Bedeutung metakognitiver Lernstrategien für die Förderung der Lernerautonomie
- Die Studie von Rasoulifard Kashani (2014): Förderung der Lernerautonomie im universitären DaF-Unterricht im nahöstlichen Raum am Beispiel des Iran
- Reflexion der Studie von Al Marqini 2018 und Rasoulifard Kashani 2014
- Meine Ergebnisse.
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Förderung der Lernerautonomie im DaF-Unterricht. Sie analysiert drei praxisorientierte empirische Studien, die sich mit der Umsetzung und Förderung der Lernerautonomie im Unterricht befassen. Das Ziel ist es, die notwendigen Voraussetzungen und die möglichen Mittel für die Förderung der Lernerautonomie im DaF-Unterricht zu identifizieren.
- Verschiedene Konzeptionen der Lernerautonomie in der Fremdsprachedidaktik
- Analyse empirischer Studien zur Förderung der Lernerautonomie im DaF-Unterricht
- Reflexion der Ergebnisse der empirischen Studien
- Identifizierung von didaktischen Hinweisen und offenen Fragen zur Förderung der Lernerautonomie
- Zusammenfassende Schlussfolgerungen zur Bedeutung der Lernerautonomie im DaF-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Relevanz der Lernerautonomie im Kontext des heutigen Wandels der Gesellschaft und Technik dar. Sie betont die Notwendigkeit, individuelle Lernbedürfnisse zu berücksichtigen und Lernende zur Selbstständigkeit im Fremdsprachenlernen zu befähigen.
- Die bestehende Konzeptionen der Lernerautonomien in der Fremdsprachedidaktik: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Konzeptionen der Lernerautonomie im fremdsprachendidaktischen Diskurs. Es werden die situativ-technizistische, die handlungstheoretische, die strategisch-technische, die konstruktivistische, die entwicklungspsychologische und die pädagogisch-fächerübergreifende Autonomiekonzeption vorgestellt.
- Darstellungen der Zusammenfassung und Reflexion der empirischen Studien: Dieses Kapitel fasst drei empirische Studien zur Förderung der Lernerautonomie im DaF-Unterricht zusammen und reflektiert deren Ergebnisse. Es werden die Studien von Bouchama (2019), Al Marqini (2018) und Rasoulifard Kashani (2014) betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind Lernerautonomie, Fremdsprachenlernen, DaF-Unterricht, empirische Studien, handlungsorientierte Unterrichtsaktivitäten, Lernstrategien, metakognitive Lernstrategien, individualisiertes Lernen, selbstgesteuertes Lernen.
- Quote paper
- Lingxiao Xu (Author), 2020, Die Förderung der Lernerautonomie im DaF-Unterricht. Drei praxisorientierte empirische Studien im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1137400