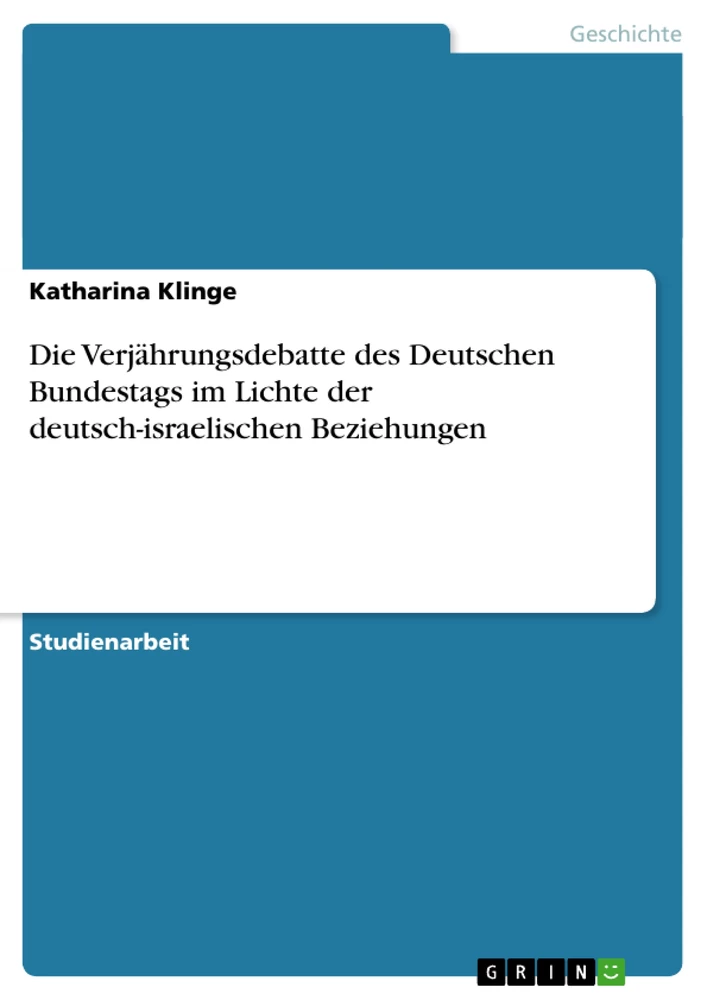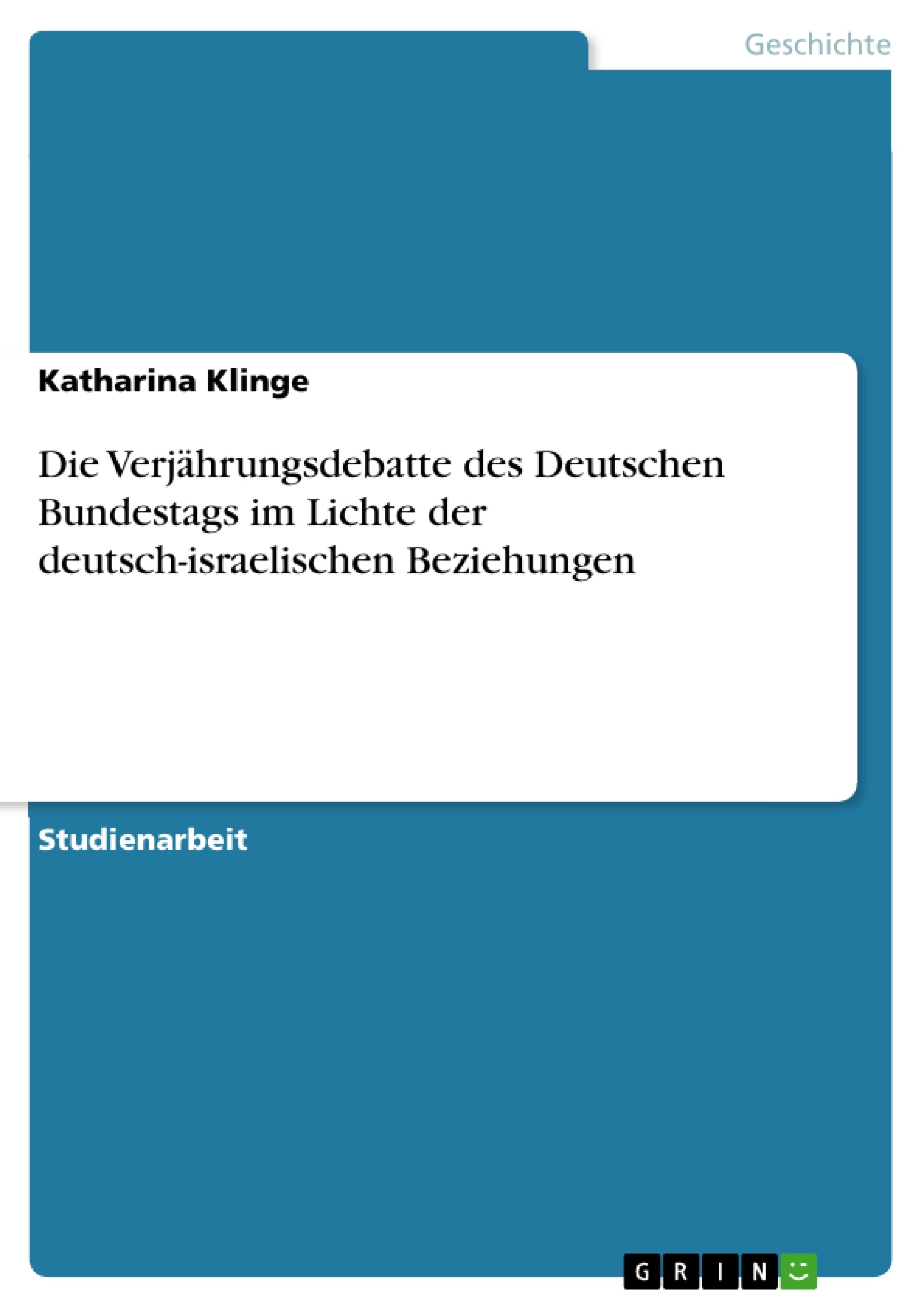Das Ende der Ära Adenauer und die Regierungsübernahme durch Ludwig Erhard waren geprägt von zahlreichen innen- und außenpolitische Verwirrungen. Besonders das Verhältnis zu Israel – zu dem zum damaligen Zeitpunkt noch keine offiziellen diplomatischen Beziehungen bestanden – wurde Anfang der 60er Jahre mehrfach getrübt: Auf die Auseinandersetzungen um deutsche Wissenschaftler, die an ägyptischen Rüstungsprogrammen forschten, folgte der weltweite Eklat um die Aufdeckung der heimlichen deutschen Waffenlieferungen an Israel. Im Herbst 1964 setzte in der Bundesrepublik Deutschland des Weiteren eine Kontroverse um die drohende Verjährung von NS-Verbrechen ein und avancierte schnell zum „beherrschenden Problem der sechziger Jahre“1. Die damals geltende Strafgesetzordnung sah eine Verjährung der von den Nationalsozialisten begangenen Morde 20 Jahre nach Kriegsende vor, demzufolge am 8. Mai 19652. Am 10. März 1964 debattierten die Parlamentarier im Deutschen Bundestag die Argumente für und wider diese Verjährung und erörterten eine mögliche Verschiebung oder Aufhebung eben dieser. Dieser Aufsatz wird einen vertiefenden Blick auf die historische Debatte um die Verjährungsfrist von Morden im Deutschen Bundestag werfen und die unterschiedlichen Positionen im Parlament aufzeigen. Nach einem kurzen Ausblick auf die Weiterentwicklung der Diskussion bis ins Jahr 1979 und der öffentlichen Meinung in Deutschland in Bezug auf die Verjährungsdebatte soll außerdem die Frage geklärt werden, inwieweit diese Diskussion Auswirkungen auf das Verhältnis der Bundesrepublik zum Staat Israel und die spätere Aufnahme diplomatischer Beziehungen hatte3 In der zeitgeschichtlichen Forschung finden sich unter anderem bei Reichel, Jelinek, Weingardt und Deligdisch zahlreiche Ausführungen zur Verjährungsdebatte. Als Hauptquellen dieser Arbeit sind jedoch die „Stenographische Berichte des Deutschen Bundestages“ zu nennen. Umfangreiche Sammlungen von Unterlagen, Berichten und Gesprächsnotizen zu diesem Themenkomplex aus israelischer Perspektive hat Tuviah Friedman, Leiter des Instituts zur Erforschung der Nazi-Verbrechen in Haifa, zusammengestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Debatte um die Verjährung von NS-Verbrechen
- Die Verjährungsdebatte im Deutschen Bundestag von 1965
- Ausblick auf die Verjährungsdebatten von 1969 und 1979
- Die öffentliche Haltung in Deutschland zur Verjährungsdebatte
- Auswirkungen der Debatte auf das Verhältnis zu Israel
- Schlussbetrachtungen
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Verjährungsdebatte im Deutschen Bundestag von 1965 im Kontext der deutsch-israelischen Beziehungen. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Positionen der Parlamentarier und die Auswirkungen der Debatte auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel. Die Arbeit untersucht die historischen Hintergründe der Debatte, die Argumente für und wider eine Verlängerung der Verjährungsfrist sowie die öffentliche Meinung in Deutschland.
- Die Verjährungsdebatte im Deutschen Bundestag von 1965
- Die Auswirkungen der Debatte auf das Verhältnis zu Israel
- Die Rolle der öffentlichen Meinung in Deutschland
- Die historischen Hintergründe der Debatte
- Die Argumente für und wider eine Verlängerung der Verjährungsfrist
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Verjährungsdebatte ein und stellt den historischen Kontext dar. Sie beleuchtet die politischen und gesellschaftlichen Spannungen im Deutschland der frühen 1960er Jahre und die Bedeutung der deutsch-israelischen Beziehungen in dieser Zeit. Die Einleitung skizziert die zentralen Fragen, die in der Arbeit behandelt werden, und stellt die wichtigsten Quellen und Forschungsliteratur vor.
Das Kapitel „Die Debatte um die Verjährung von NS-Verbrechen“ analysiert die Verjährungsdebatte im Deutschen Bundestag von 1965 im Detail. Es beleuchtet die unterschiedlichen Positionen der Parlamentarier, die Argumente für und wider eine Verlängerung der Verjährungsfrist sowie die Rolle der Bundesregierung in der Debatte. Das Kapitel untersucht auch die öffentliche Meinung in Deutschland und die Auswirkungen der Debatte auf die deutsche Gesellschaft.
Das Kapitel „Auswirkungen der Debatte auf das Verhältnis zu Israel“ untersucht die Auswirkungen der Verjährungsdebatte auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel. Es analysiert die Reaktionen der israelischen Regierung und der israelischen Öffentlichkeit auf die Debatte und beleuchtet die Bedeutung der Debatte für die Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehungen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Verjährungsdebatte, NS-Verbrechen, deutsch-israelische Beziehungen, Vergangenheitsbewältigung, öffentliche Meinung, Politik und Recht. Die Arbeit analysiert die Debatte um die Verjährung von NS-Verbrechen im Deutschen Bundestag von 1965 und beleuchtet die unterschiedlichen Positionen der Parlamentarier sowie die Auswirkungen der Debatte auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel. Die Arbeit untersucht die historischen Hintergründe der Debatte, die Argumente für und wider eine Verlängerung der Verjährungsfrist sowie die öffentliche Meinung in Deutschland.
- Quote paper
- Katharina Klinge (Author), 2007, Die Verjährungsdebatte des Deutschen Bundestags im Lichte der deutsch-israelischen Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113750