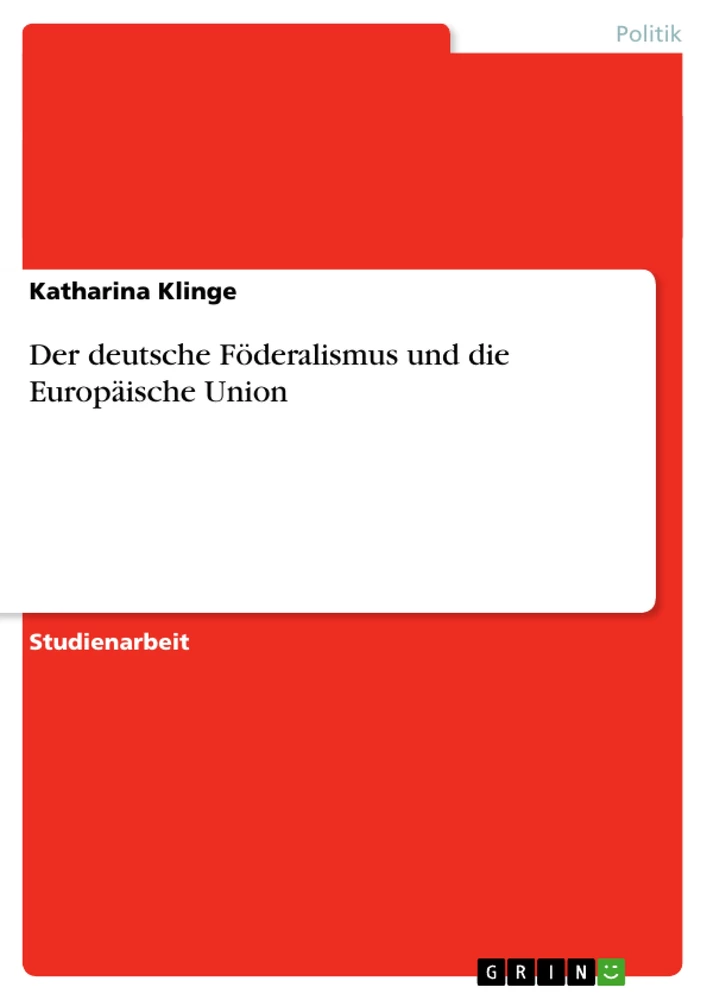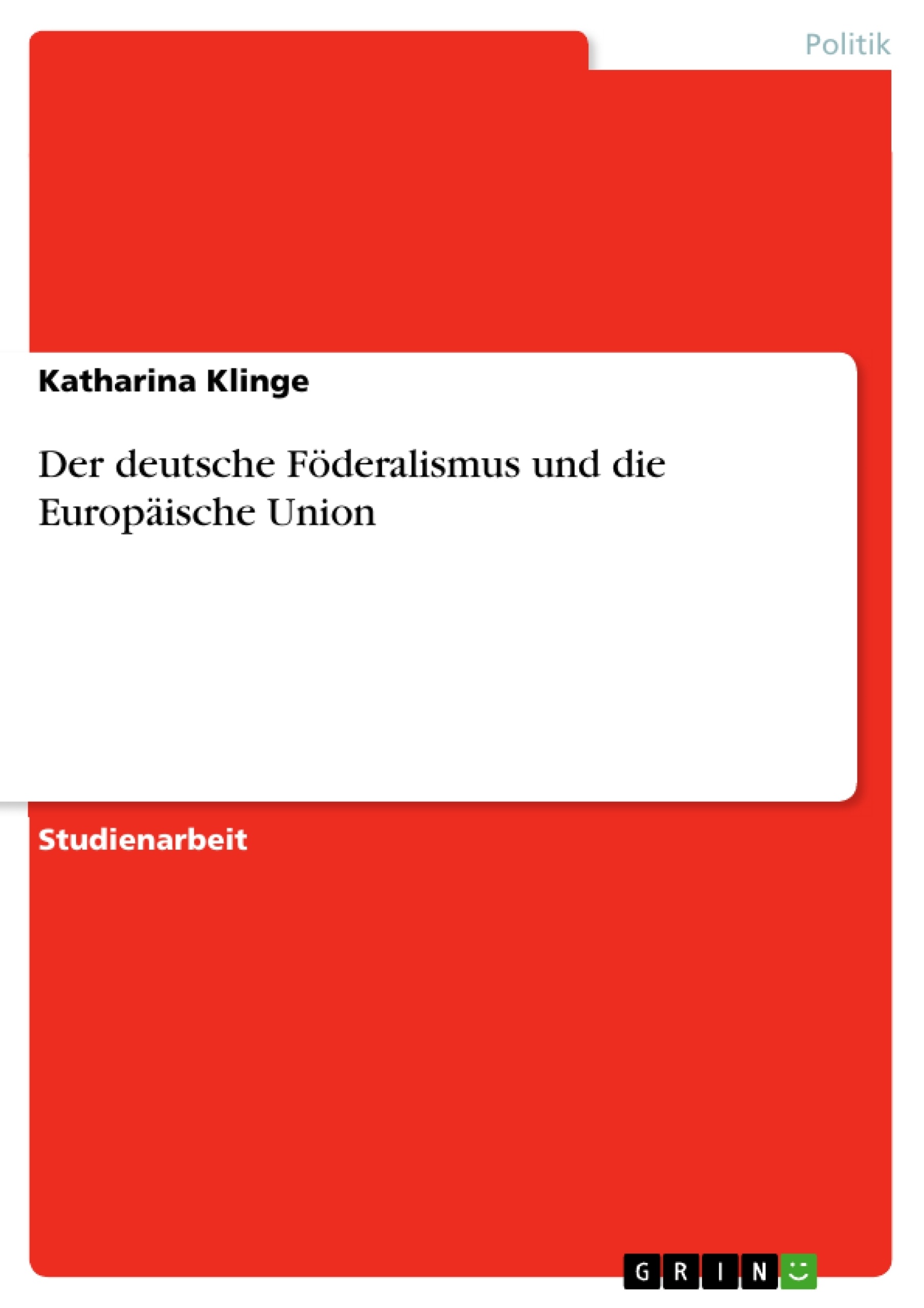Die feierliche Eröffnung der (von der Presse gern als „Neuwahnstein“ bezeichneten) bayerischen Landesvertretung im Zentrum Brüssels im September 2004 war wohl eines der medienwirksameren Zeichen von Veränderungen, die die zunehmende Integration in die Europäische Union (EU) für Deutschland mit sich bringt. Dass es überhaupt Landesvertretungen in der EU gibt, ist eine Folge des föderalistischen Aufbaus der Bundesrepublik und unter anderem des Artikel 23 GG,
welcher die deutschen Bundesländer in die politische Entscheidungen auf der europäische Ebene mit einbezieht. Dieser Aspekt brachte deshalb vor allem in Bezug auf deren Mitbestimmungskompetenzen viele Veränderungen. Diese Veränderungen sollen in vorliegender Hausarbeit thematisiert werden: Welche Herausforderungen stellt die Europäisierung den Ländern? Bedeutet die europäische Integration einen Zuwachs oder eine Verringerung der politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Länder? Verliert der Föderalismus in Deutschland durch die Europäisierung an Bedeutung? Und welche Auswirkungen hat die Kompetenzverschiebung auf die deutsche Politik? Nach einer kurzen theoretischen Einführung in die Struktur des deutschen Föderalismus und in
die Entwicklung der EU in Kapitel zwei, sollen diese Fragen erörtert und geklärt werden. Im dritten Kapitel werde ich mich dann mit den Einschnitten und den Erweiterungen der Mitbestimmungsmöglichkeiten der deutschen Länder beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Grundlagen und Begriffsklärung
- Der deutsche Föderalismus und der Bundesrat
- Deutschland und die Europäische Union
- Die Länder in der EU
- Einschnitte in Länderkompetenzen
- Neue Mitwirkungsmöglichkeiten
- Mitwirkungsrechte der Länder bis Maastricht
- Mitwirkungsrechte der Länder seit Maastricht
- Der Ausschuss der Regionen
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der europäischen Integration auf den deutschen Föderalismus. Sie analysiert die Veränderungen in den Mitbestimmungsrechten der deutschen Länder im Kontext der EU-Entwicklung und untersucht, ob die Europäisierung zu einem Zuwachs oder einer Verringerung der politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Länder führt.
- Entwicklung des deutschen Föderalismus
- Integration Deutschlands in die Europäische Union
- Einschnitte und Erweiterungen der Mitbestimmungsrechte der Länder
- Auswirkungen der Kompetenzverschiebung auf die deutsche Politik
- Bedeutung des Föderalismus im Kontext der Europäisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach den Auswirkungen der Europäisierung auf den deutschen Föderalismus. Es wird die Bedeutung des Artikels 23 GG für die Mitwirkung der Länder in der EU-Politik hervorgehoben.
Das zweite Kapitel beleuchtet die historischen Grundlagen des deutschen Föderalismus und die Entwicklung der Europäischen Union. Es werden die Strukturen des deutschen Föderalismus, die Rolle des Bundesrats und die enge Verflechtung Deutschlands mit der EU seit deren Gründung erläutert. Der Begriff der Europäisierung wird definiert und das Subsidaritätsprinzip als ein zentrales Element der EU-Integration vorgestellt.
Das dritte Kapitel analysiert die Auswirkungen der Europäisierung auf die Kompetenzen der deutschen Länder. Es werden sowohl die Einschnitte in Länderkompetenzen durch die EU-Integration als auch die neuen Mitwirkungsmöglichkeiten der Länder im EU-Rahmen beleuchtet. Die Entwicklung der Mitwirkungsrechte der Länder bis und seit Maastricht sowie die Rolle des Ausschusses der Regionen werden näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den deutschen Föderalismus, die Europäische Union, die Mitbestimmungsrechte der Länder, die Europäisierung, die Kompetenzverschiebung, die Auswirkungen auf die deutsche Politik und den Artikel 23 GG.
- Citar trabajo
- Katharina Klinge (Autor), 2005, Der deutsche Föderalismus und die Europäische Union, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113753