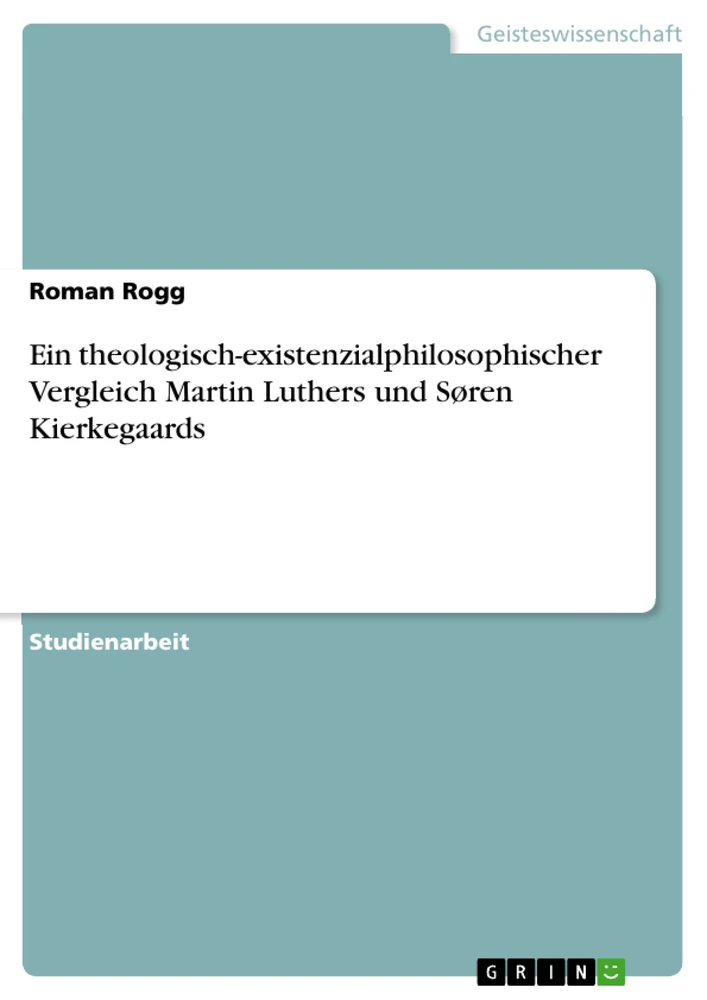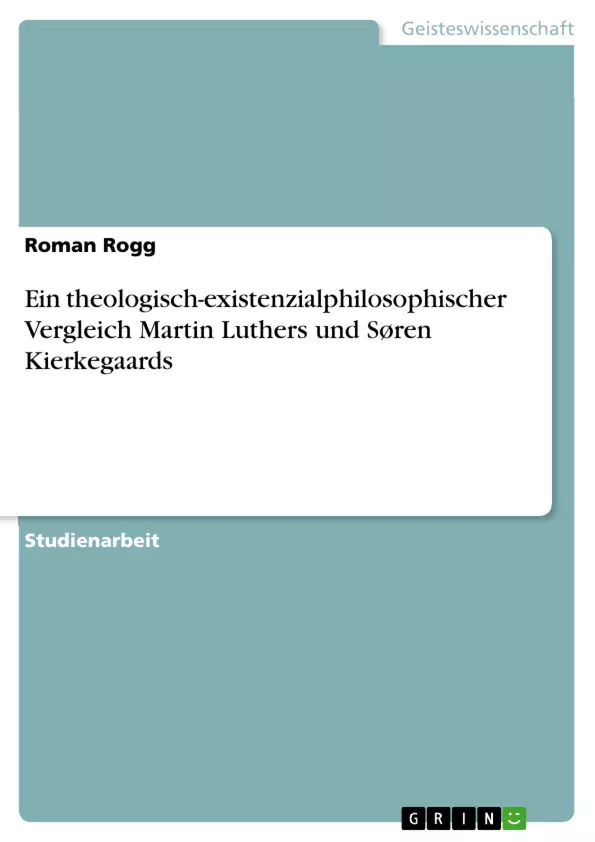Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard gilt als der Initiator des Existenzialismus. Die theologisch-historische Gegenüberstellung Kierkegaards und Luthers soll die zentralen Inhalte von Sünden- und Gewissenslehre beider Denker zutage bringen.
Die vorliegende Arbeit bemüht sich um eine Darstellung der Theologie der lutherischen Reformation unter Bezugnahme ihrer Umstände zunächst in Hinsicht auf die ihre Zeit sowie im Folgenden auf die noch integraleren Bedingungen menschlicher wie christlicher Grunderfahrung der Existenz. Diese hingegen, wenn sie auch in ihren jeweiligen Kontexten differieren mag, ist als zeitloses Phänomen zentraler Bestandteil christlicher Anthropologie und demnach unverzichtbar für jede Reflexion Martin Luthers. Hierbei dient uns Luthers Klagelied Aus tiefer Not schrei ich zu dir als hervorragendes Zeugnis seines Lebens und Denkens und bereitet uns auf die anschließende Gegenüberstellung mit einem in vergleichbarer Weise von den Wogen des Lebens gezeichneten theologischen Denker: dem Dänen Søren Kierkegaard. Uns interessieren innerhalb dieses Rezeptionsrahmens ihre jeweiligen Konzeptionen des Gewissens als Orientierungsinstanz und Spiegel der eigenen Existenz.
Es wird sich zeigen, dass die Reformation der Katholischen Kirche zur Zeit Luthers ein in keiner Weise zufälliges Ereignis, sondern die logische Konsequenz der Kombination aus den eigenen Missständen sowie der Person des Reformators war. Zudem markieren die beiden Denker Luther und Kierkegaard einen Versuch des theologischen Paradigmenwechsels hin zum Menschen und seinen Nöten. Will die Kirche weiterhin erste Anlaufstelle für den Menschen in der Bewältigung seines Lebens bleiben, ist sie auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen und steht dabei in der Tradition der Bemühungen von Psychologie wie Soziologie und damit unter dem Dach philosophischer Reflexion. Genauer: der Philosophie der Existenz
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITENDE BEMERKUNGEN: MUSIK ALS ZEUGNIS DER ERFAHRUNG
- II. DIE LUTHERISCHE REFORMATION
- A. Historischer Hintergrund
- B. Person
- C. Theologie
- 1. Theologische Schuldanthropologie
- 2. Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide
- D. Musik
- 1. Luther und die Musica practica
- 2. Aus tiefer Not schrei ich zu Dir
- III. DAS VERÄNGSTIGTE GEWISSEN
- A. Abriss von Leben und Denken Søren Kierkegaards
- B. Gewissensmodell Søren Kierkegaards
- C. Gewissenskonzeption Martin Luthers
- IV. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theologie der lutherischen Reformation im Kontext ihrer historischen Umstände und existentiellen Grunderfahrungen. Sie beleuchtet Luthers Theologie anhand seines Klageliedes „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ und vergleicht seine Gewissenskonzeption mit der von Søren Kierkegaard. Ziel ist es, die Reformation als logische Konsequenz historischer und persönlicher Faktoren zu verstehen und den Beitrag beider Theologen zu einem theologischen Paradigmenwechsel hin zum Menschen darzustellen.
- Die lutherische Reformation als Reaktion auf gesellschaftliche und kirchliche Missstände.
- Luthers Theologie und seine existentielle Grunderfahrung.
- Der Vergleich der Gewissenskonzeptionen Luthers und Kierkegaards.
- Die Bedeutung von Musik als Ausdruck existentieller Erfahrung.
- Die Rolle der interdisziplinären Zusammenarbeit für die Kirche.
Zusammenfassung der Kapitel
I. EINLEITENDE BEMERKUNGEN: MUSIK ALS ZEUGNIS DER ERFAHRUNG: Dieses einleitende Kapitel betont die Bedeutung von Musik als Ausdruck menschlicher Erfahrung und Kommunikationsform. Es wird argumentiert, dass die Auseinandersetzung mit Musik einen wertvollen Einblick in die jeweilige Epoche und deren Erfahrungen bietet. Die Arbeit selbst wird als eine Darstellung der lutherischen Theologie im Kontext ihrer Zeit und der grundlegenden menschlichen und christlichen Existenz vorgestellt. Luthers "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" wird als zentrales Zeugnis seines Lebens und Denkens eingeführt und die anschließende Gegenüberstellung mit Kierkegaard angekündigt, wobei der Fokus auf den Konzeptionen des Gewissens beider Theologen liegt.
II. DIE LUTHERISCHE REFORMATION: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der lutherischen Reformation. Der historische Hintergrund wird beleuchtet, wobei der Fokus auf den Machtwechsel in Politik und Kirche liegt. Die Kapitelteile beschreiben die kirchlichen Missstände (Machtzentralismus der Kurie, Ablasshandel, Reformstau), die gesellschaftlichen Veränderungen (Buchdruck, aufkommende Aufklärung, Nationalstaaten) und die Rolle von Persönlichkeiten wie Erasmus von Rotterdam. Der Abschnitt über Luther selbst skizziert sein Leben und seine theologische Entwicklung als Reaktion auf die vorherrschenden Umstände.
III. DAS VERÄNGSTIGTE GEWISSEN: Dieses Kapitel vergleicht die Konzeptionen des Gewissens bei Luther und Kierkegaard. Es skizziert zunächst Leben und Denken Kierkegaards, um anschließend sein Gewissensmodell zu erläutern. Im Anschluss wird die Gewissenskonzeption Martin Luthers dargestellt und im Vergleich zu Kierkegaard analysiert. Der Fokus liegt auf dem Gewissen als Orientierungsinstanz und Spiegel der eigenen Existenz in beiden theologischen Systemen. Die Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Lebensumständen der Theologen und ihren unterschiedlichen Gewissenskonzepten werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Lutherische Reformation, Rechtfertigungstheologie, Existentielle Grunderfahrung, Gewissen, Søren Kierkegaard, Musik, Historischer Kontext, Kirchliche Missstände, Theologischer Paradigmenwechsel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Lutherische Reformation und das verängstigte Gewissen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Theologie der lutherischen Reformation im Kontext ihrer historischen Umstände und existentiellen Grunderfahrungen. Sie beleuchtet Luthers Theologie anhand seines Klageliedes „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ und vergleicht seine Gewissenskonzeption mit der von Søren Kierkegaard. Ziel ist es, die Reformation als logische Konsequenz historischer und persönlicher Faktoren zu verstehen und den Beitrag beider Theologen zu einem theologischen Paradigmenwechsel hin zum Menschen darzustellen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die lutherische Reformation als Reaktion auf gesellschaftliche und kirchliche Missstände; Luthers Theologie und seine existentielle Grunderfahrung; der Vergleich der Gewissenskonzeptionen Luthers und Kierkegaards; die Bedeutung von Musik als Ausdruck existentieller Erfahrung; und die Rolle der interdisziplinären Zusammenarbeit für die Kirche.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung (Musik als Zeugnis der Erfahrung); Die lutherische Reformation (mit Unterkapiteln zu historischem Hintergrund, Luther als Person, seiner Theologie und seiner Musik); Das verängstigte Gewissen (Vergleich der Gewissenskonzeptionen Luthers und Kierkegaards); und abschließende Bemerkungen.
Was wird im Kapitel zur lutherischen Reformation behandelt?
Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der lutherischen Reformation, beginnend mit dem historischen Hintergrund (kirchliche Missstände, gesellschaftliche Veränderungen). Es beschreibt Luthers Leben, seine theologische Entwicklung und seine Musik, insbesondere sein Lied „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“.
Was ist der Fokus des Kapitels „Das verängstigte Gewissen“?
Dieses Kapitel vergleicht die Gewissenskonzeptionen Luthers und Kierkegaards. Es skizziert Leben und Denken Kierkegaards und erläutert sein Gewissensmodell. Anschließend wird Luthers Gewissenskonzeption dargestellt und im Vergleich zu Kierkegaard analysiert. Der Fokus liegt auf dem Gewissen als Orientierungsinstanz und Spiegel der eigenen Existenz.
Welche Rolle spielt Musik in dieser Arbeit?
Musik spielt eine wichtige Rolle als Ausdruck existentieller Erfahrung. Die Arbeit betont die Bedeutung von Musik als Kommunikationsform und nutzt Luthers Lied „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ als zentrales Beispiel für die Verbindung von Theologie und persönlicher Erfahrung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lutherische Reformation, Rechtfertigungstheologie, Existentielle Grunderfahrung, Gewissen, Søren Kierkegaard, Musik, Historischer Kontext, Kirchliche Missstände, Theologischer Paradigmenwechsel.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Reformation als logische Konsequenz historischer und persönlicher Faktoren zu verstehen und den Beitrag Luthers und Kierkegaards zu einem theologischen Paradigmenwechsel hin zum Menschen darzustellen. Die detaillierten Schlussfolgerungen sind im letzten Kapitel zusammengefasst.
- Citation du texte
- Roman Rogg (Auteur), 2020, Ein theologisch-existenzialphilosophischer Vergleich Martin Luthers und Søren Kierkegaards, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1137571