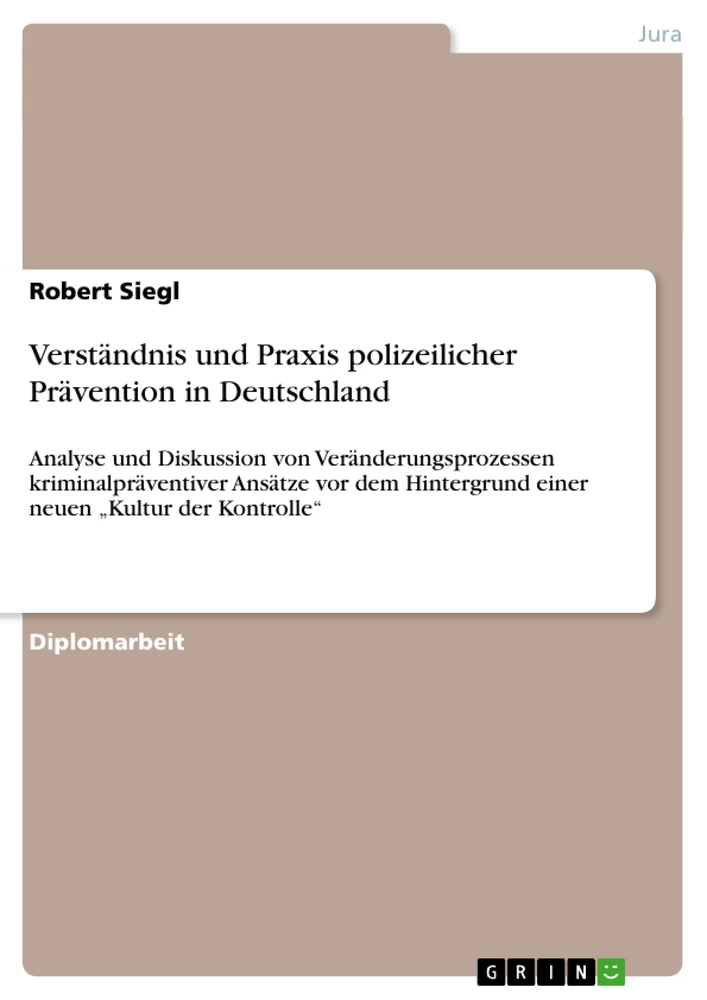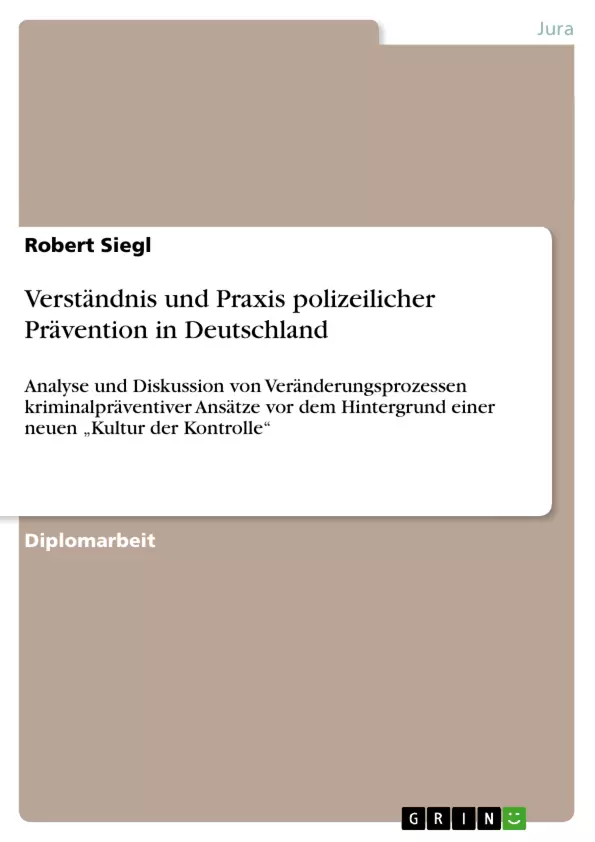In Anlehnung an die von Philip K. Dick 1956 veröffentlichte Kurzgeschichte „Minority Report“ (Dick, 2002) skizziert die Verfasserin des vorangestellten Zitats einen Wendepunkt innerhalb der zeitgenössischen gesellschaftlichen Konstitution sowie einen hierin enthaltenen Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Kriminalitätsphänomen. Die Protagonisten der von Dick entworfenen Zukunftsvision leben in einer vollkommen kriminalitätsfreien Gesellschaft, da sie in der Lage sind, zukünftige Rechtsverstöße vorauszusehen und deren Verursacher bereits vor dessen Begehung auszuschalten. Mit unserer heutigen Lebenswirklichkeit hat diese Utopie einer omnipotenten Kriminalitätskontrolle natürlich wenig gemein, obgleich dem Ansatz der „Kriminalprävention“ heutzutage, vollkommen unabhängig von dessen genauer Ausprägung, mehr denn je eine Schlüsselfunktion zugesprochen wird. Dieser Umstand stellt auch die Kriminologie vor ein ernstes Problem:
Im Sinne eines traditionellen kriminologischen Verständnisses be-fasst sich diese mit der empirischen Erforschung des Verbrechens und mit der Täterpersönlichkeit (Kaiser, 1993, S. 2). Den inhaltlichen Überzeugungen der sogenannten „kritischen“ Kriminologie ist es zu verdanken, dass diese Engführung auf die Person des „Täters“ (zumindest zu Teilen) aufgegeben wurde und nunmehr auch der Prozess der Kriminalisierung und die Reaktion der hierbei beteiligten staatlichen Institutionen auf kriminalisierte Verhaltensweisen zu Objekten des kriminologischen Erkenntnisinteresses wurden (vgl. Sack, 1985, S. 277ff). In diesem Kontext stagniert die kriminologische Analyse und Problematisierung der Kriminalitätsproduktion, als ein „intellectual offspring of a post- crime society in which crime is conceived principally as harm or wrongdoing and the dominant ordering practices arise post hoc” (Zedner, 2007, S. 262). Der in dem Zitat von Zedner angesprochene Über-gang von einer “Post-Society” zu einer „Pre-Crime-Society“ implementiert daher auch für die Kriminologie die Aufgabe, sich verstärkt mit Kontrollmechanismen auseinanderzusetzen, welche nicht länger eine Reaktion auf kriminalisierte Verhaltensweisen darstellen, sondern dem Versuch gleichkommen, aus einer prospektiven Erwartungshaltung auf diese einzuwirken.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kriminalprävention im Wandel
- Begriffsklärung
- Das „traditionelle“ Verständnis von Kriminalprävention
- Das „neue Verständnis von Kriminalprävention
- Kriminalprävention im Kontext einer neuen Kontrollkultur
- Skizzierung einer neuen Kultur der Kontrolle
- Dichotome Entwicklungen und die „neuen“ Rollen der Polizei
- Die Polizei im Kontext einer Strategie souveräner Staatlichkeit bei der Kriminalitätsbekämpfung
- Die Polizei im Kontext einer adaptiven Strategie bei der Kriminalitätsbekämpfung
- Souveräne Staatlichkeit und neue Sicherheitsgesetzgebung
- Das Grundgesetz – Schutz vor der Staatsgewalt oder staatliches Eingriffrecht?
- Strafrecht - zwischen retrospektiver Steuerung und Vorfeldkriminalisierung
- Strafprozessrecht
- Polizeirecht
- Polizei(recht) im Kontext von Sicherheit und Freiheit
- Der allgemeine Gefahrenbegriff
- Konkrete und abstrakte Gefahr
- Objektiver und subjektiver Gefahrenbegriff
- Die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten
- Adaptive Strategien und kommunale Kriminalprävention
- KKP als Bestandteil einer adaptiven Kontrollstrategie
- KKP als Ausdruck einer demokratischen Praxis zeitgenössischer Kriminalitätskontrolle
- KKP in der Kritik
- Antidemokratische Kontrollpraxis
- Mehr Kontrolle und weniger soziale Absicherung
- Responsibilisierung
- Praxis Divergenzen zwischen Rhetorik und Realität
- Rolle und Funktion der Polizei
- Auf dem Weg zu einer demokratischeren Polizei
- Die „Verpolizeilichung“ der Gesellschaft
- Zusammenführung der Ergebnisse und Ausblick
- Quellenverzeichnis
- Eidesstattliche Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung und Praxis polizeilicher Kriminalprävention in Deutschland. Sie analysiert die Veränderungsprozesse kriminalpräventiver Ansätze vor dem Hintergrund einer neuen „Kultur der Kontrolle“. Die Arbeit untersucht, wie sich das Verständnis von Kriminalprävention im Laufe der Zeit gewandelt hat und welche neuen Herausforderungen sich für die Polizei im Kontext einer zunehmenden Sicherheitsorientierung ergeben.
- Wandel des Kriminalpräventionsverständnisses
- Neue Kontrollkultur und ihre Auswirkungen auf die Polizei
- Souveräne Staatlichkeit und neue Sicherheitsgesetzgebung
- Adaptive Strategien und kommunale Kriminalprävention
- Rolle und Funktion der Polizei in einer sich verändernden Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kriminalprävention ein und stellt den aktuellen Forschungsstand dar. Sie beleuchtet den Wandel von einer „Post-Crime-Society“ zu einer „Pre-Crime-Society“ und die damit verbundenen Herausforderungen für die Kriminologie.
Kapitel 1 befasst sich mit dem Wandel des Kriminalpräventionsverständnisses. Es werden die traditionellen und neuen Ansätze der Kriminalprävention definiert und die jeweiligen Verantwortlichkeiten der Akteure beleuchtet.
Kapitel 2 analysiert die Kriminalprävention im Kontext einer neuen Kontrollkultur. Es werden die Merkmale einer neuen Kultur der Kontrolle beschrieben und die Auswirkungen auf die Rolle der Polizei untersucht.
Kapitel 3 befasst sich mit der souveränen Staatlichkeit und der neuen Sicherheitsgesetzgebung. Es werden die Auswirkungen der neuen Gesetze auf die Freiheit des Einzelnen und die Rolle der Polizei im Kontext von Sicherheit und Freiheit untersucht.
Kapitel 4 analysiert die adaptiven Strategien und die kommunale Kriminalprävention. Es werden die Vor- und Nachteile der kommunalen Kriminalprävention diskutiert und die Rolle der Polizei in diesem Kontext beleuchtet.
Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen der Kriminalprävention.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kriminalprävention, Kontrollkultur, Polizei, Sicherheitsgesetzgebung, Staatlichkeit, Freiheit, Demokratie, kommunale Kriminalprävention, Responsibilisierung, Verpolizeilichung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Paradigmenwechsel zur „Pre-Crime-Society“?
Es beschreibt den Übergang von einer Polizei, die primär auf begangene Straftaten reagiert, hin zu einer präventiven Kontrolle, die versucht, Gefahren bereits im Vorfeld zu erkennen und auszuschalten.
Was ist der Unterschied zwischen souveräner und adaptiver Strategie?
Souveräne Strategien setzen auf staatliche Härte und neue Sicherheitsgesetze. Adaptive Strategien setzen auf Prävention durch Kooperation mit der Zivilgesellschaft und kommunale Netzwerke.
Wie hat sich das Polizeirecht im Kontext der Sicherheit verändert?
Es gibt eine Tendenz zur Vorfeldkriminalisierung, bei der polizeiliche Eingriffsbefugnisse zeitlich weit vor eine konkrete Gefahr verlagert werden, was das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit verschärft.
Was bedeutet „Responsibilisierung“ in der Kriminalprävention?
Responsibilisierung bedeutet, dass der Staat die Verantwortung für Sicherheit teilweise auf Bürger, Kommunen und private Akteure überträgt, die nun aktiv zur Kriminalitätsbekämpfung beitragen sollen.
Was wird an der Kommunalen Kriminalprävention (KKP) kritisiert?
Kritiker bemängeln eine zunehmende soziale Kontrolle, die Ausgrenzung bestimmter Gruppen aus dem öffentlichen Raum und eine „Verpolizeilichung“ gesellschaftlicher Probleme.
Welche Rolle spielt der allgemeine Gefahrenbegriff heute?
Der Gefahrenbegriff wurde durch Konzepte wie die „abstrakte Gefahr“ oder „drohende Gefahr“ erweitert, was der Polizei ermöglicht, früher und mit weniger konkreten Anhaltspunkten einzugreifen.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Kriminologe / Dipl. Soz. Pädagoge Robert Siegl (Autor:in), 2007, Verständnis und Praxis polizeilicher Prävention in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113811