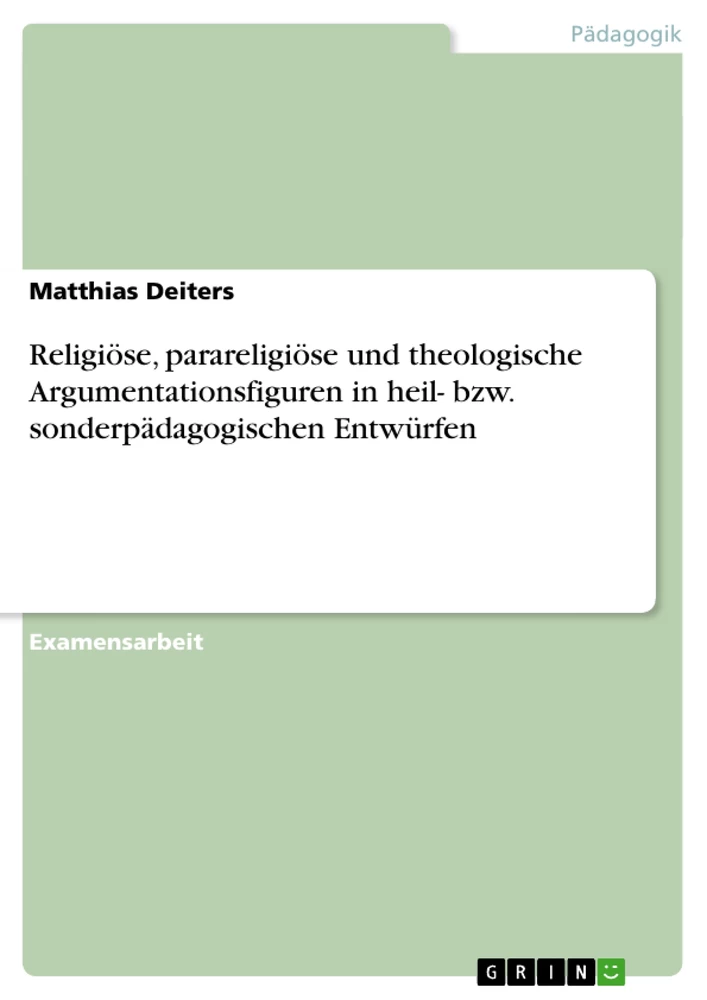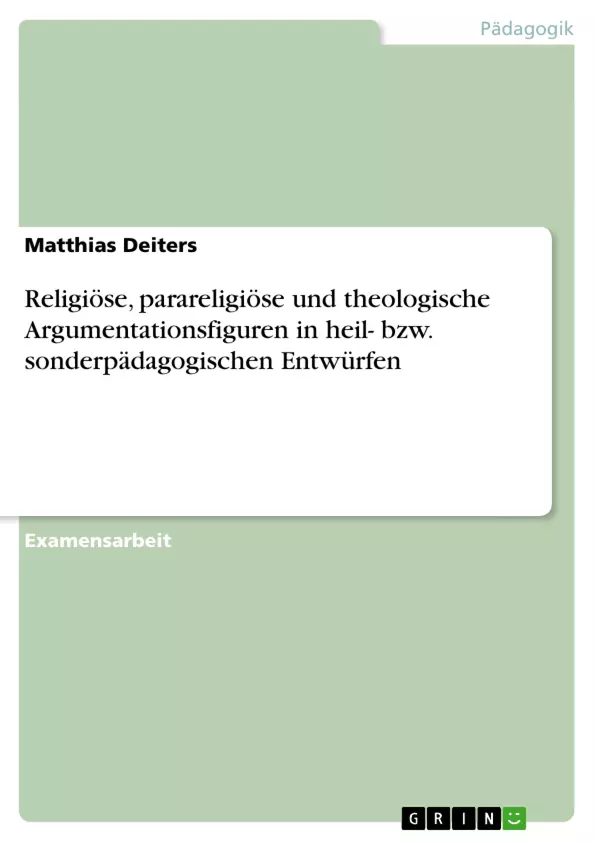Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffliche Klärungen
2.1. Heilpädagogik und Sonderpädagogik
2.2. Theologie, Religion und parareligiöse Aspekte
2.2.1. Theologie und Religion
2.2.2. Parareligiösität als Religion außerhalb der Religionen
3. Theologische, religiöse und parareligiöse Aspekte in den Entwürfen von Bopp, Haeberlin und Jantzen
3.1. Die Heilpädagogik des Theologen: „Allgemeine Heilpädagogik” von Linus Bopp
3.1.1. Heilpädagogik unter theologischen Rahmenbedingungen - ein Modell normativer Heilpädagogik
3.1.2. Wertsinnshemmung als Behinderung
3.1.2.1. Das geschichtliche Ereignis: Die Wiederherstellung des Urwertes der Gottebenbildlichkeit (Imago Dei) durch Christus
3.1.2.2. Der Urwert an der Spitze eines treppenförmigen Wertesystems
3.1.2.3. Mangel an Wertsinn und Wertwillen als Behinderung
3.1.3. Der Heilerzieher
3.1.3.1. Biblische Vorbilder für heilpädagogisches Handeln: Christus und der barmherzige Samariter
3.1.3.2. Zur Rolle des Heilerziehers
3.1.4. Erziehungsziel Sakramentsteilnahme
3.1.5. Anmerkungen zu Bopps „Allgemeiner Heilpädagogik”
3.2. Religiöse Wertbegründung jenseits der Konfessionen: Urs Haeberlins „Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft”
3.2.1. Wertgeleiteter Methodenpluralismus als Konvergenz verschiedener theoretischer Konzepte
3.2.2. Geschöpflichkeit des Menschen - ein durch Glaubensentscheidung abgesichertes anthropologisches Modell
3.2.3. Der Auftrag der Heilpädagogik vor dem Hintergrund des Modells von der Geschöpflichkeit des Menschen: Gesellschaftliche Veränderung und erzieherische Haltung
3.2.3.1. Wertgeleitete Heilpädagogik und ihre Grundwerte: Die Vision von einer besseren Gesellschaft
3.2.3.2. Die heilpädagogische Haltung
3.2.3.2.1. Das dialogische Prinzip in der erzieherischen Haltung als Respekt vor einer gottgewollten Verschiedenheit
3.2.3.2.2. Der Personalismus in der erzieherischen Haltung
3.2.4. Entsoldidarisierungstendenzen im Rahmen der Geschichte christlicher Religion
3.2.5. Haeberlins Nähe zum Religionsverständnis Hanselmanns
3.2.6. Anmerkungen zu Haeberlins „Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft”
3.3. Parareligiöse Elemente in der marxistisch-materialistischen „Allgemeinen Behindertenpädagogik” von Wolfgang Jantzen
3.3.1. Die „Allgemeine Behindertenpädagogik” als Beispiel für materialistische Theoriebildung innerhalb der Sonderpädagogik
3.3.2 Historischer Materialismus als eine Art Heilsgeschichte
3.3.2.1. Die christliche Interpretation der Geschichte als Heilsgeschichte
3.3.2.2. Die marxistische Interpretation der Geschichte als Gesetzmäßigkeit
3.3.2.3. Der marxistische Geschichtsbegriff bei Jantzen
3.3.2.4. Theimers Kritik an der marxistischen Geschichtsauffassung
3.3.3. Das Ende der Klassenkämpfe als Eschatologie im Marxismus
3.3.3.1. Das christliche Eschatologie-Modell
3.3.3.2. Das Ende des Kapitalismus und des bürgerlichen Staates bei Marx und Engels
3.3.3.3. Gedanken zu einer zukünftigen Gesellschaft bei Jantezen- motivierende Utopie und erste Ansätze in der Praxis
3.3.4. Die Ambivalenz von Religion: Legitimation von Herrschaft aber auch Träger der Revolution
3.3.5. Anmerkungen zu Jantzens „Allgemeiner Behindertenpädagogik”
4. Schlussbetrachtung und Ertrag
4.1. Geschöpflichkeit als anthropologische Grundannahme
4.2. Nicht verhandelbare Grundwerte
4.3. Utopie als Rüstung für die soziale Realität
5. Literatur
1. Einleitung
Theologische und religiöse Argumentationsfiguren in heil- und sonderpädagogischen Zusammenhängen nehmen in der Breite der wissenschaftlichen Diskussion - betrachtet man Zeitschriften und Bücher - eher einen marginalen Raum ein, dennoch stößt man in bestimmten Zusammenhängen, wie der Beschäftigung mit der Geschichte der Heilpädagogik, zwangsläufig auf religiöse bzw. kirchliche Wurzeln. Ein heilpäda- gogisches Engagement jenseits der Kirchen, so schreibt es Kobi, bildete bis zum 20. Jh. eher die Ausnahme.[1] Sieht man einmal von den vielen staatlich getragenen Sonderschulen ab, so wird man feststellen, dass viele heilpädagogische Einrichtungen auch heute noch konfessionell getragen werden, d.h. im Grunde weltanschaulich auf christlicher Basis stehen, ohne dass dies eine öffentliche Betonung erfährt. Skiba spricht angesichts dieses Phänomens von einer Unverbundenheit zwischen christlicher Rahmensetzung und heilpädagogischer Konzeption.[2]
Hinter religiösen und theologischen Argumenten verbergen sich viele zum Teil stark widersprüchliche Motive und Traditionsstränge, so einerseits die neutestamentliche Botschaft von der Erwähltheit der Schwachen und Ohnmächtigen, andererseits die zeitweilige Macht der Kirche über viele Bereiche, u.a. das Erziehungswesen. Quasi als Scharnier zwischen Botschaft und Macht ist die Tätigkeit der Mission einzuordnen, mittels derer Menschen für den Glauben gewonnen werden sollen. Die Frage an eine religiös begründete Heilpädagogik ist damit heute in zumeist multikulturell geprägten Arbeitsfeldern auch die Frage nach dem missionarischen Charakter und dessen Legitimität angesichts der Forderung nach Integration von Behinderten, die selbst auch Teil dieser multikulturellen Gesellschaft sind.
Die Erörterung religiöser Aspekte hat ihren wissenschaftlichen Ort in der Frage nach der Wertfreiheit in der Pädagogik als Erziehungswissenschaft. Eine religiöse Begründung beinhaltet Werte, es werden z.b. Aussagen über ein Menschenbild gemacht. Bleidick forderte in den achtziger Jahren eine saubere Trennung in empirisch zu verstehende Erziehungswissenschaft und die für Werte und Normen zuständige Erziehungsphilosophie, um eine unwissenschaftliche Wertevermischung auf der Ebene der Wissenschaftlichkeit zu verhindern, in der praktischen Pädagogik würden die beiden Betrachtungsweisen dann wieder zusammenfließen.[3] Speck billigt hingegen der Wertfreiheit in der Wissenschaft wenig Raum zu, da „weltanschauliche Bindungen einen starken Einfluss auf die Behauptungen wissenschaftlicher Hypothesen haben,..” denn „Weltanschauungen sind im Menschen, vor allem in seinen Gefühlen, tief verankert und bilden einen Teil seiner Identität.”[4]
Weltanschauung kann sich als Religion äußern oder als parareligiöses Phänomen. In seinem Aufsatz über heilpädagogisch-theologisches Denken erwähnt Kobi zwar eine „parareligiöse Emphase...”, die „... aus entschieden areligiösen und/oder ‘streng wissenschaftlich’ gemeinten Attitüden” durchschimmert,[5] eine genauere Bestimmung dieser Parareligiösität lässt er aber vermissen. Die inhaltliche Füllung von „Parareligiösität” wird weiter unten erfolgen, zunächst sei nur gesagt, dass hiermit eine Weltanschauung gemeint ist, die religiöse Züge hat oder haben kann, obwohl die Vertreter dieser Weltanschauung dieses Etikett der Religion weit von sich weisen würden. Der Entwurf, der in dieser Richtung untersucht werden soll, ist Wolfgang Jantzens zweibändige „Allgemeine Behindertenpädagogik” (1. Band 19922; 2. Band 1990). Als Beispiel einer konfessionellen Heilpädagogik habe ich die 1930 erschienene „Allgemeine Heilpädagogik” von Linus Bopp ausgewählt, ein bereits betagter Entwurf, dennoch halte ich seine Erörterung für sinnvoll, da er als das Beispiel für theologisch geprägte Heilpädagogik auch heute noch oft herangezogen wird.[6] Der dritte Entwurf, der sich als religiös dabei aber nicht konfessionell geprägt ausgibt, ist Urs Haeberlins „Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft” (1996).
Der Erörterung dieser Werke soll zunächst eine begriffliche Klärung von Heil- und Sonderpädagogik und der Termini Theologie, Religion und Parareligion vorangehen. Im Anschluss daran sind die theologischen, religiösen oder parareligiösen Aspekte der jeweiligen Entwürfe aufzusuchen und von hier aus die bereits aufgeworfenen Problemstellungen des Geschichtsbildes, der wissenschaftlichen Einordnung und des Menschenbildes (Behindertenbegriff, Rolle des Heil- bzw. Sonderpädagogen) zu betrachten. Bei aller Verschiedenheit, die etwa angesichts der materialistischen Sichtweise Jantzens und der theologischen Sichtweise Bopps bereits im Vorfeld konstatiert werden kann, soll auch nach Gemeinsamkeiten gefragt werden.
2. Begriffliche Klärungen
2.1. Heilpädagogik und Sonderpädagogik
Der Titel dieser Arbeit spricht hinsichtlich einer spezialisierten Pädagogik für Behinderte von Heil- und Sonderpädagogik. Der Name Heilpädagogik ist der ältere der beiden Begriffe. Erstmals wurde er mit der Erscheinung des Werkes „Die Heilpädagogik mit besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalten” 1861/1863 von Deinhardt und Georgens gebraucht.[7] Der Wortbestandteil „Heil” deutet auf Wurzeln, die bereits davor u.a. durch Comenius und Rousseau ihren Einzug in die Pädagogik gehalten haben. Comenius benutzt den Begriff Remedium (Heilmittel) im Zusammenhang mit Kindern, die in der pädagogischen Sprache der Gegenwart als geistig behindert bezeichnet würden, im „Emile ou de l´ éducation” Rousseaus allerdings zielt der Gebrach von remédier auf Untugenden nichtbehinderter Kinder.
Speck weist auf drei Traditionslinien hin, die sich trotz unterschiedlicher Ansätze alle auf das Präfix „heil” stützen.[8] Erstens die „heilende Erziehung”, die Heilung vor dem Hintergrund von Kinderfehlern verstand. Einer der bekanntesten Vertreter war Strümpell mit seiner systematischen Ausarbeitung der „Pädagogischen Pathologie oder der Lehre von den Kinderfehlern”. Zweitens die Mediko-Pädagogik mit der Dominanz der medizinischen Diagnostik, die Heil im Sinne der Heilung einer medizinischen Krankheit verstand und drittens die theologisch geprägte Heilpädagogik, mit der religiösen Deutung des Heils auf einen göttlichen Heilsplan hin, für die Bopp ein typischer Vertreter ist.
Aufgrund der vieldeutigen Interpretationen, die letztlich zu Unklarheit führten, wurde am Oberbegriff Heilpädagogik immer wieder Kritik geübt. Moor wies darauf hin, dass man besonders vom medizinischen Begriff der Heilung dort absehen muss, wo etwas Unheilbares vorliegt.[9] Hanselmann sah in „Sondererziehung” eine treffendere Bezeichnung, obwohl auch er u.a. im Buchtitel „Einführung in die Heilpädagogik” an dem alten Disziplinbegriff durchgehend festhielt.[10] Bleidick nahm diese Einflüsse auf, zudem sah er die Notwendigkeit von Sonderpädagogik statt Heilpädagogik zu reden vor allem durch den Ausbau des Sonderschulsystems gekommen. Aus system- theoretischer Perspektive zeigt sich dieser Ausbau als Differenzierung von Komplexität, indem das System Schule das Subsystem Sonderschule ausdifferenziert: „Für Behinderte gibt es besondere Schulen... der theoretische Überbau dieses Systems heißt `Sonderpädagogik´. Dadurch kommt es auch, dass Sonderpädagogik sich - viel stärker, als bei den Begriffssystemen Heilpädagogik...- zumeist als Sonderschulpädagogik kon- stituierte.”[11]
Neben Heil- und Sonderpädagogik wurden durch andere Ansätze oder Entwicklungen weitere Begriffe wie Rehabilitationspädagogik, Behindertenpädagogik und Integrationspädagogik für diese Disziplin in die Diskussion gebracht.[12] Rehabilitationspädagogik” hat sich in der ehemaligen DDR als Oberbegriff in Abhebung vom westdeutschen Sprachgebrauch etabliert und ist teilweise im universitären Bereich (Universitäten Berlin und Halle) der neuen Bundesländer beibehalten worden.[13] Der Gebrauch von „Behindertenpädagogik” wurde von Bleidick angeregt, der ihn terminologisch mit Sonderpädagogik gleichsetzt.[14] Speck sieht den „Nachteil dieses Begriffs... in der Verabsolutierung von Behinderung und damit in der übergangslosen Grenzsetzung gegenüber ‘Nichtbehinderung’.”[15] In der „Allgemeinen Behindertenpädagogik” Jantzens steht diese Bezeichnung im Titel, obgleich seine materialistisch ausgerichtete sonderpädagogische Perspektive eine völlig andere ist als die Bleidicks. Der Titel des Buches steht bei Jantzen hart neben dem sonst eher integrativ intendierten Ansatz.[16] In ähnliche Richtung weist der Gebrauch von „Integrationspädagogik” u.a. im Untertitel des „Handbuchs Lernen und Lern- Behinderungen” von Eberwein, das konzeptionell mit dem Anspruch auftritt alle bisherigen Begriffssysteme besonderer Pädagogik, die nicht mehr tragbar sind, durch den Integrationsgedanken überflüssig zu machen.[17]
Trotz aller Widersprüche in den Begriffen und trotz der neueren Impulse sind Heil- und Sonderpädagogik nach wie vor die maßgeblichen Begriffe für die Disziplin, in der es um eine spezielle Pädagogik für Behinderte geht, weshalb sie auch in dieser Arbeit beibehalten werden sollen.[18]
2.2. Theologie, Religion und parareligiöse Aspekte
Eine erste Trennung innerhalb von theologischen, religiösen und parareligiösen Aspekten kann m.E. in zwei Bereiche geschehen. Während die Phänomene der Theologie oder der Religiösität nach geläufigen Definitionen auf Transzendenz, Heiliges oder Göttliches zu beziehen sind, mit der Folge, dass man diese Phänomene objektiv wie auch subjektiv feststellen kann, z.b. indem jemand von sich behauptet „Ich bin ein religiöser Mensch”, so ist Parareligiösität (griechisch para = bei; neben) zunächst nur beschreibend aus einer Beobachterposition festzustellen, etwa im Sprachgebrauch, wodurch sich allerdings auch gleich ein Sachverhalt ergibt.[19] Aus diesem Grunde werden in einem Abschnitt Theologie und Religion und danach gesondert Parareligiösität behandelt.
2.2.1. Theologie und Religion
Der Gebrauch des Begriffs Religion hat seine Wurzeln bereits im Altertum. Cicero verstand unter religio (lat. immer wieder durchgehen; genau beachten) eine gewissenhafte Beobachtung des menschlichen Verhaltens gegenüber göttlichen Ansprüchen, unter anderem die Frage nach der Einhaltung von Kultvorschriften.[20] Im Laufe der Geschichte hat sich der Gebrauch von „Religion” vielfach verändert, seit der Aufklärung wird er als Allgemeinbegriff benutzt und meint sowohl die Gesamtheit von sozialen Sinnsystemen, die von Gruppen oder Völkern ausgebildet wurden, wie auch die auf die Einzelperson bezogene anthropologische Bedingtheit des Menschen als religiöses Wesen. Der Begriff Religion zielt also einerseits auf die Tatsache der Vielfalt der Religionen, andererseits auf die individuelle Angelegenheit der Religion, die jedem Menschen zugesprochen wird. Friedrich Schleiermacher sah in seinen „Reden über die Religion” (1799) eine vom Individuum erlebte Beziehung zum Ewigen oder Göttlichen, wobei er Religion und Frömmigkeit eine Eigenständigkeit zuordnete, die das ganze Leben betrifft und Religion gleichzeitig gegenüber der Theologie abgrenzt, in der wiederum Dogmen und symbolische Lehren eine entscheidende Rolle spielen.[21] Im Anschluss an Schleiermacher sprach Ernst Troeltsch vom „religiösen Apriori”,[22] demzufolge jeder Mensch notwendigerweise religiöse Vorstellungen entwickele.
Der moderne Religionsbegriff bezieht sich auf das Verständnis individuell gelebter Religion, somit gehört Religion in diesem Sinn zu den „Wegbereitern moderner Individualitätskultur ... das als Gottesbewusstsein sich verstehende religiöse Subjekt weiß sich also in einem transzendenten Grund gegründet.”[23] Religion bezeichnet damit keinen Glaubensgegenstand, der dem religiösen Subjekt vorgegeben ist, es ist für die Gehalte und die Art und Weise des Glaubens selbst zuständig. Eine Manifestation der religiösen Inhalte artikuliert sich sprachlich in der Folge von Emotionen und kognitiven oder voluntativen Bewusstseinsakten.[24]
Werner Gephart sieht eine zentrale Funktion der modernen Religion in der Identitätsstiftung, hier werden Antworten auf die Fragen „Wer sind wir, woher kommen wir, und wohin gehen wir?”[25] gegeben, zeitlich gesehen werden damit Dimensionen wie Schöpfung (Vergangenheit) und Jenseitserwartungen bzw. Verheißungen (Zukunft) abgedeckt.
Die Trennlinie zwischen Religion und Theologie, wie sie heute nicht mehr allgemein üblich ist, mir dennoch für diese Arbeit sinnvoll erscheint, ist mit den Stichworten der Kirchlichkeit und Offenbarung gegeben. Falk Wagner weist in seinem Artikel über Religion auf den Bruch in der deutschsprachigen ev. Theologie hin, der sich in der Zeit während und nach dem ersten Weltkrieg ereignete.[26] Der auf Schleiermacher zurückgehende Religionsbegriff wurde heftig von einem Kreis von Theologen um Karl Barth kritisiert, weil man hier die „Vergöttlichung des Menschen und die Vermenschlichung Gottes” propagierte.[27] Die religiösen Fragestellungen gehen vom Menschen aus und infolgedessen sind auch oft die Antworten eher anthropozentrisch gestaltet. Eine Erkenntnis Gottes aber hat sich dem „’unendlich qualitativen Unterschied’ von Gott und Mensch” zu stellen.[28] Dies ist nicht durch das religiöse Bemühen des Menschen möglich, der Gott aus seiner Existenz oder aus der Natur heraus erkennen möchte, sondern nur durch die Offenbarung, wie sie in Christus stattgefunden hat, mithin durch die Schriften des Alten und primär des Neuen Testaments. Mit dieser Eingrenzung des Offenbarungsbegriffes ging eine binnenkirchliche Orientierung der Theologie einher, weg vom religiösen Modell aber auch von sozial- , human- und kulturwissenschaftlichen Einflüssen.[29]
Im Hinblick auf die Entwürfe von Bopp und Haeberlin sei bereits an dieser Stelle auf die Unterscheidung ihrer Perspektiven hingewiesen. Während Bopp seine Schrift aus der Sicht des katholischen Theologen verfasste, der seine Gedanken auf kirchlich - sakramentales Geschehen ausrichtete, vertritt Haeberlin eine Religiösität, die sich bewusst von jeglicher Konfessionalität distanziert.
2.2.2. Parareligiösität als Religion außerhalb der Religionen
In seinem Werk „Der Mensch in der Revolte” (1951) beschrieb Albert Camus in kritischer Auseinandersetzung den Marxismus mit religiösen Attributen wie apokalyptisch oder prophetisch, hinsichtlich der Anhängerschaft der marxistischen Lehre sprach er von „wachsendem Glauben.”[30] Den materialistischen Atheismus interpretierte er als umgedeutete Religion: „Er setzt doch das höchste Wesen auf der Ebene des Menschen wieder ein... Unter diesem Gesichtspunkt ist der Sozialismus ein Unternehmen zur Vergöttlichung des Menschen und hat einige Merkmale der traditionellen Religionen angenommen.”[31]
Eine solche Sichtweise, wie sie Camus hatte, ist nach Robert Schlette nicht möglich, solange Inhalte der Religion lediglich auf Transzendenz, Göttlichkeit und das Heilige beschränkt werden, denn hiermit wird der Religionsbegriff nur auf binnenreligiöse Phänomene eingegrenzt. Bezieht man aber Haltungen wie religiösen Eifer oder Hingabe ein, so wird man auch außerhalb der positiven Religionen fündig „nicht zuletzt in den verschiedenen Varianten Marxscher Provenienz.”[32]
In der radikalen Religionskritik Feuerbachs, an die auch Marx angeknüpfte,[33] sollte der Mensch an die Stelle Gottes treten, Theologie sollte durch Anthropologie ersetzt werden. Diesen Ersatz einfach mit Ersatzreligion, Religionsersatz oder säkularisierte Religion zu betiteln, hält Schlette für nicht angemessen. Ausgehend von gleichgebliebenen anthropologischen Konstanten, die in etwa mit Troeltschs religiösen Apriori zu vergleichen sind, spricht er von menschlichen Grundkräften, die nur einmal zu vergeben sind Das würde bedeuten, dass es sich auch hier „um dieselben Energien handelt, die hier oder dort ‘gebunden’ eingesetzt werden.”[34] Diese in verschiedene Richtung entwickelbare religiöse Grundkraft, die auf einem erweiterten Religions- begriff basiert, findet sich, wenn auch mit anderen Ausrücken, ebenfalls bei anderen Autoren. Max Scheler nannte sie die „Absolutsphäre”; Paul Tillich spricht „von dem, was den Menschen unbedingt angeht.”[35] Parareligiösität als Religiösität außerhalb oder neben den Religionen basiert demnach auf gleichen Mechanismen wie die Religion selbst, auch wenn eine transzendente oder metaphysische Orientierung nicht enthalten ist.
3. Theologische, religiöse und parareligiöse Aspekte in den Entwürfen von Bopp, Haeberlin und Jantzen
3.1. Die Heilpädagogik des Theologen: „Allgemeine Heilpädagogik” von Linus Bopp
Exemplarisch für einen theologisch ausgerichteten Entwurf der Heilpädagogik wird folgend die „Allgemeine Heilpädagogik” von Linus Bopp (1887-1971) erörtert werden. Mit dem Erscheinungsjahr 1930 ist diese - laut Speck - „erste auch wissenschafts- theoretisch gelungene pädagogische Gesamtkonzeption einer Behindertenhilfe”[36] zwar schon älter, dennoch wird immer wieder auf sie als typisches Beispiel einer christlich geprägten Systematik zurückgegriffen. Wesentliche Impulse dieses christlichen Ansatzes von Bopp flossen u.a. in die Arbeit Eduard Montaltas ein, auf evangelischer Seite wurde er von Ludwig Schlaich aufgegriffen.[37]
Bopp war 1924 als katholischer Priester zum Ordinarius für Pastoraltheologie und Pädagogik der Freiburger Universität (i. Breisgau) berufen worden. Einen Lehrstuhl für Heilpädagogik gab es zu dieser Zeit in ganz Europa noch nicht, weshalb diese Aufgabe von heilpädagogischen Experten anderer Lehrstühle - u.a. Linus Bopp - abgedeckt wurde.[38]
Das Werk ist folgendermaßen aufgebaut: Auf eine Einleitung mit Begriffs- klärungen und einem Blick auf die Geschichte der Heilpädagogik folgen fünf Hauptteile. 1. über den Heilzögling mit dem Schwerpunkt auf dessen Wertsinn- sentwicklung, 2. über den Heilerzieher, 3. über die heilpädagogischen Ziele, 4. über die heilpädagogischen Methoden und 5. über die heilpädagogische Organisationslehre. Theologische Akzente werden vor allem in der Einführung, sowie in den Erörterungen über den Heilerzieher und die Erziehungsziele gesetzt.
3.1.1. Heilpädagogik unter theologischen Rahmenbedingungen - ein Modell normativer Heilpädagogik
Bopp entwirft seine Vorstellung einer Allgemeinen Heilpädagogik im Rahmen der katholischen Theologie: „Es ist allmählich eine Binsenweisheit geworden, dass bei jeder Pädagogik die Weltanschauung eine Hauptrolle spielt, ferner dass es praktisch kaum eine rein natürliche nur durch Philosophie zu begründende Erziehung geben kann, darum hat auch die Theologie Anspruch auf die Beeinflussung wie der Pädagogik überhaupt so auch der Heilpädaogik.”[39] Theologischen Gedanken wird in diesem Entwurf demnach eine konstituierende Rolle zugebilligt.
In einer vorgreifenden Zusammenfassung ließe sich sein Werk wie folgt skizzieren: Den zentralen Bestandteil seines Denkgebäudes bildet das christologisch gedeutete Modell der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Von den beiden zentralen Aussagen, dass der Mensch bei der Schöpfung gleichsam als Gottesähnlichkeit einen
„Urwert” mitbekommen hat, der in der Folgezeit zwar verschüttet wurde aber von Christus vorbildhaft in einem heilend-erlösenden Akt wieder hergestellt werden konnte, lassen sich Linien zum Behindertenbegriff und zur Rolle des Heilpädagogen ziehen. Eine Linie führt vom geschöpflichen Urwert hin zur Spitze eines treppenförmigen Wertegefüges, dass die menschliche Gesellschaft als solche zusammenhält. Behinderung beginnt da, wo diese im Grunde bereits angeborenen Werte nicht geweckt werden, sich nicht richtig entwickeln können oder gehemmt sind. Hier setzt die Arbeit des Heilpädagogen ein, zu dem eine Linie vom Christusgeschehen führt. In ähnlicher Weise wie der Heiland zum Heil des Menschen beitrug, versucht der Heilpädagoge den defekten Wertsinn des Behinderten wieder in die Bahnen der Normalentwicklung zu lenken.
Wissenschaftstheoretisch verortet Bleidick den Entwurf Bopps bei den Modellen normativer Heilpädagogik.[40] E. König definiert normative Erziehungswissenschaft als die Aufstellung von „wissenschaftlich begründeten Normen für die Erziehungspraxis”.[41] Normative Heilpädagogik, die ebenso in evangelischer oder anthroposophischer Tradition zu finden ist, zeichnet sich nach Bleidick aus durch eine enge Anbindung an „christliche Wertphilosophie, die im theologischen Sinne dogmatisch gefasst ist. Der Zentralbegriff ist - etymologisch und metaphorisch verstärkt - das ‘Heil des Heilzöglings.”[42]
Mit dem theologischen Rahmen, der letztlich auch seine pädagogischen Gedanken abstützt, ist Bopp also ein typischer Vertreter dieses normativen Modells.
3.1.2. Wertsinnshemmung als Behinderung
3.1.2.1. Das geschichtliche Ereignis: Die Wiederherstellung des Urwertes der Gottebenbildlichkeit (Imago Dei) durch Christus
Den Ausgangspunkt der theologischen Begründung bildet die Verklammerung von Heilpädagogik und Christusgeschehen durch den Heilbegriff. „Heilen und Helfen ist etwas echt Christliches.”[43] Bopp räumt ein, dass auch ein natürlicher Mensch Kranken zu einer Heilung verhelfen kann, durch den christlichen Impuls aber hat das Heilen eine transzendent begründete Qualitätssteigerung erfahren, das Christentum hat es „übernatürlich erhöht, geweiht und verstärkt.”[44]
Heiland - der Name zeugt bereits von der Tätigkeit. Die zentrale Rolle des Heilands wird unterstrichen durch den historischen Abriss der heilerzieherischen Praxis und Theorie, die noch in der Einführung erfolgt.[45] Beginnend mit der Antike über das Mittelalter hin zur Neuzeit spannt der Verfasser einen Bogen der heilpädagogischen Tätigkeit. Freilich betont er, dass man in der Antike noch nicht von einer heilpädagogischen Theorie reden könne, da sie erst ein Ergebnis der Neuzeit ist, der eine lange Zeit der Praxis voranging, in der man sich lediglich fragte, „wie man sich überhaupt gegenüber den Objekten der Heilerziehung benahm, wie man sie behandelte und wie man die entfernteren Grundlagen für die richtige und erfolgreiche Behandlungsart legte.”[46] Berichte aus dieser Praxis über Kinder, Waisenkinder oder Fürsorgebedürftige aus der antiken griechisch-römischen Welt oder aus dem Alten Testament werden vor dem kontrastierenden Hintergrund des kommenden Christentums gesehen.
„Jesus Christus kam als Heiland. Die Kranken, nicht die Gesunden, brauchen den Arzt.”[47] Die Person des Messias bildet in diesem historischen Durchgang den Gipfel einer Heilsgeschichte, in der Bopp den christlichen Erlösungsgedanken mit erzieh- erischer und heilpädagogischer Tätigkeit in einer Person verknüpft. M.E. hat hier auch die Wert- bzw. Wertsinnstheorie dieses Werkes einen wichtigen Ausgangspunkt. Die Erlösung wird notwendig, weil „der Mensch von seiner Idee abgeirrt war... .”[48] Bopp bleibt in dieser Passage etwas unklar hinsichtlich der genaueren Beschreibung dieser
„Idee”, von der der Mensch abirrte. Er führt aus, dass dennoch „... sein Urwert nicht restlos vernichtet, sondern nur verschüttet, getrübt und geschwächt wurde.”[49] Des Menschen Urwert ist hinsichtlich seiner Natur „auch der Erhebung, Heilung, Klärung, Stärkung, der Wiedergeburt fähig.”[50]
Die Vermutung liegt nahe, dass Bopp hier, ohne es anzusprechen, das Modell der Gottebenbildlichkeit und die christliche Sündenfalltheorie voraussetzt. Der Gedanke vom Urwert als göttlicher Idee weist in diese Richtung. Nicht zuletzt sieht er bereits vorher eines der wichtigsten Erziehungsziele darin, „die sittlich-religiöse Werthaftigkeit gottähnlich...” zu gestalten, was „...zugleich Gottes Ehre fördert und des Menschen Heil bedeutet.”[51] Gottähnlichkeit oder Gottebenbildlichkeit sind mithin Ausgangspunkt für den pädagogischen Auftrag.
Die Imago-Dei- oder Gottebenbildlichkeitsvorstellung basiert auf Aussagen der biblischen Schöpfungsgeschichte: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde.” (Genesis 1,27) Bopp schreibt darüber: „Da der Mensch nicht von sich selber, vielmehr ein Geschöpf Gottes ist, und da Gott wie jeder Künstler seinem Werk etwas von sich selber gegeben haben muss, so folgt für ihn als äußeres Ziel, dass er für Gott da ist, Gott zu Willen und zu Dienst sein muss, dass andererseits sein immanentes Ziel die Herausarbeitung des Göttlichen in ihm, des Gottesbildes sein muss.”[52] Der Mensch hat also im Schöpfungsakt Eigenschaften, Fähigkeiten etc. von Gott mitbekommen, die ihn an seine Herkunft erinnern, was sich wiederum auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch auswirkt. Der Mensch hat dadurch eine, wie auch immer geartete, Vorstellung oder ein Wissen, wie er Gottes Willen, der sich u.a. in Geboten äußert, entsprechen kann.[53] In so einem Wissen wäre dann die o.g. Idee zu sehen bzw. in der mitgegebenen Ebenbildlichkeit der Urwert des Menschen. Der Mensch, der zunächst dem Anspruch Gottes entsprach, kehrt sich im Sündenfall, wider seine Ebenbildlichkeit, von Gott ab.[54] Die Folge dieses „geschöpflichen Abfalls”[55] ist das physische und moralische Übel in der Welt. Bopp betont, dass dessen Auftreten aber zeitlich nach der Schöpfung gekommen ist, während die Existenz Gottes demgegenüber ewig ist. Trotz des Sündenfalls hat der Mensch durch seine Gottebenbildlichkeit einen Rest des Urwertes in sich, der ihn heilbar macht. Mit dieser Nachzeitigkeit der Sünde lehnt Bopp auch einen Zusammenhang von Krankheit bzw. Behinderung und Sünde ab, der an einigen Stellen im Alten Testament z.b. als Tun-Ergehens-Zusammenhang oder als Prüfungssituation formuliert wurde.[56]
3.1.2.2. Der Urwert an der Spitze eines treppenförmigen Wertesystems
Der Urwert, in dem das Wissen um die Schöpfung steckt, ist zugleich der höchste Wert bzw. er bildet die höchsten Werte, die der Mensch haben kann. Diese sittlich-religiösen Werte gilt es in der Erziehung anzustreben, da „die Erziehung ... in ihrem letzten Ziel irgendwie mit dem Ziel und Ende des Menschen überhaupt übereinstimmen muss, also vom christlichen Standpunkt aus theozentrisch sein muss, sofern die sittlich-religiöse Werthaftigkeit gottähnlich gestaltet und so zugleich Gottes Ehre fördert.”[57]
Diese Spitze der Werte wird gestützt durch „ein ganzes Treppensystem von untergeordneten Werten, ...als Ausdruck, zur Verkörperung und Bewährung religiös-ethischer Werte, die sich darin gleichsam ihren Leib schaffen und ihr Gewand weben.”[58] Zwischen den Treppenstufen sieht Bopp eine Wechselbeziehung Einerseits erhalten sie von den oberen Stufen ihren Sinn, andererseits sind die oberen Stufen nicht ohne die unteren Stützstufen, wo z.b. der Sinn für Arbeit[59] entsteht, kulturelle Leistungen wie Technik und Ingenieurskunst[60] angesiedelt sind oder wirtschaftliche Selbstständigkeit[61] verortet wird, zu denken: „Ein noch so religiöser Mensch wäre allgemein gefährdet, wenn er arbeitsscheu wäre.”[62]
Die Werte realisieren sich in einer Kulturgemeinschaft. Durch die arbeitsteilige Struktur dieser Gemeinschaft wird eine Höherentwicklung gewährleistet, jeder kann auf seinem Gebiet seine Fertigkeiten einbringen. Im Zusammenhang dieser Erörterung wird die katholische Perspektive deutlich, die Welt aus der Sicht des corpus christianum[63] zu sehen, wonach sich alle Völker im Herrschaftsbereich Gottes befinden: „Durch die berufliche Differenzierung kann die Kulturgemeinschaft wesentlich höher steigen, weil nicht jeder für jedes sorgen muss, sondern durch die isolierte Aufmerksamkeit und Fertigkeit Bestes auf einem Teilgebiet schaffen kann. Die große Kulturgemeinschaft eines Volkes und idealerweise der Völker kann darum ein wesentlich vollkommeneres Abbild des vollkommenen himmlischen Vaters darstellen.”[64]
Die Entwicklung des Menschen, der sich diese Werte aneignet, geschieht ebenfalls in einer Stufenstruktur. „Denn nicht in einem einzigen kühnen Aufschwung steigt der Mensch zum göttlichen Leben empor, vielmehr vollzieht sich diese Entwicklung stufengemäß. Er bedarf der Geschöpfe; wie man bei einer Leiter zur höchsten Sprosse nur kommen kann, wenn man die darunterliegenden übersteigt, und höchstens die eine oder andere übergehen kann, so ist es auch hier. Darum muss auch der Sinn für übergeordnete Werte und Güter entwickelt werden, soll der höchste Wertsinn für Religion und Ethos erblühen.”[65]
Den Prozess der Erziehung versteht Bopp somit als Weckung des Wertsinns.[66] Zugleich, da der Wert ja bereits im Menschen angelegt ist, kommt er zu der fast konstruktivistisch anmutenden Feststellung, dass alle erziehende Arbeit nur Hilfe bei einem Prozess ist, der der Selbststeuerung unterliegt: „Alle Erziehung ist letztlich Unterstützung der Selbsterziehung.”[67]
Bleidick beklagt in seiner „Pädagogik der Behinderten” die unklare Definition von Bopps Wertbegriff, er konstatiert zwar einen Einfluss der Wertphilosophie, der sich in gelegentlichen Bezügen auf Franz Xaver Eggersdorfer äußere, sonst sei aber nicht „klar definiert, was unter ‘Wert’ verstanden wird.”[68] M.E. wird aber die theologische Verankerung einerseits an den theologischen Ausführungen Bopps deutlich, andererseits an seinem Erziehungsziel, das sehr stark auf kirchliche Teilhabe zielt, von dem für Bopp alles andere abhängt. Unklar wird Bopp lediglich bei der Konkretisierung der so genannten Stützwerte, die in der Hierarchie unter dem obersten Wert stehen, er deutet sie in der Allgemeinen Heilpädagogik nur an einigen Stellen an.
3.1.2.3. Mangel an Wertsinn und Wertwillen als Behinderung
Vom Wertbegriff aus entwickelt Bopp Gedanken zur Normalerziehung und zur Heilpädagogik. Der Wert als Gegenstand sowohl der Erziehung als auch der Heilerziehung führt zur Identifikation der beiden Tätigkeiten. Heilerziehung ist „so wesentlich und so gut wie normale Erziehung, aber sie hat zum Gegenstand krankes, beschädigtes, gehemmtes und eben darum besonderer Hilfe, besonderer Maßnahmen bedürftiges Menschenleben. Heilerziehung ist vertiefte Normalerziehung... sie treffen sich im Begriffe des Wertes.”[69]
Von hier aus trifft Bopp auch die Unterscheidung von erzieherischen und medizinischen Maßnahmen. Wenn Bopp von Heilung spricht, so meint er explizit pädagogisches Handeln. „Andere Anomalien, die nicht durch Erziehung beeinflussbar sind, sind Gegenstand der Medizin... oder auch der Psychotherapie. Im letzteren Fall mag der Heilvorgang... begleitet werden von erzieherischer Beeinflussung, aber wenn es sich nicht um einen inneren Wesenszusammenhang handelt oder das erzieherische Moment nicht die Führung... besitzt, werden wir nicht von eigentlicher Heilerziehung reden.”[70] Heilerziehung schließt also medizinische Indikationen aus. Auch Körperbehinderung wäre nicht im Sinne Bopps unter Behinderung zu subsummieren.
Der Behindertenbegriff Bopps - der Terminus „Behinderung” selbst war zu seiner Zeit auf dem Gebiet der Heilpädagogik noch nicht gebräuchlich - ergibt sich damit aus der Unfähigkeit oder gehemmten Fähigkeit „die gültigen Werte der Kulturgemeinschaft im notwenigen Maße sich anzueignen...,” Bopp führt aus, es sei ein „...Mangel an Wertfähigkeit und Wertwilligkeit,”[71] das das Wesen des Heilzöglings bestimme. An anderer Stelle spricht er von Wertsinn[72] bzw. Wertsinnshemmung.[73]
[...]
[1] Vgl. Kobi 1999, 225f.
[2] Skiba 2001, 512.
[3] Bleidick 1985, 65.
[4] Speck 1993, 182f.
[5] Kobi 1999, 231.
[6] Etwa bei Skiba 2001, 511 oder Speck 1993, 52.
[7] Vgl. hierzu Kobi, 1993, 121 f.
[8] Vgl. Speck 1993, 49 ff.
[9] Vgl. Bleidick 1983, 63.
[10] Speck 1993, 54.
[11] Bleidick 1985a, 258.
[12] Weitere Bezeichnungen, die vor allem im europäischen Ausland gebräuchlich sind: „Orthopädagogik” (Benelux-Staaten) oder „Spezielle Pädagogik” (im angelsächsischen oder französischem Sprachgebiet). Siehe hierzu: Kobi 1993, 125.
[13] Vgl. Speck 1993, 57 f.
[14] Vgl. Bleidick 1983, 72 und Speck 1993, 56.
[15] Speck 1993, 56.
[16] Vgl. Speck 1993, 57.
[17] Vgl. Eberwein 1996, 13.
[18] Vgl. Sassenroth 2002, 6.
[19] Vgl. Schlette 1971, 158 f.
[20] Vgl. Wagner 1997, 522 ff.
[21] Vgl. Hornig 1988, 150.
[22] Vgl. Graf 1993, 302.
[23] Wagner 1997, 526.
[24] Vgl. ebd..
[25] Gebhart 1999, 261.
[26] Vgl. Wagner 1997, 522.
[27] Karl Barth zitiert bei Zahrnt 1982, 35.
[28] Zahrnt 1982, 27.
[29] Vgl. Wagner 1997, 522.
[30] Camus 1986, 153.
[31] Ebd., 156.
[32] Schlette 1971, 158.
[33] vgl. Marx 1971, 140.
[34] Schlette 1971, 167.
[35] Zitiert bei Schlette 1971, 168.
[36] Speck 1993, 52.
[37] Vgl. Skiba 2001, 511.
[38] Vgl. zur Biographie: Berger 2002.
[39] Bopp 1930, 15.
[40] Vgl. Bleidick 1985, 70.
[41] König 1975, 36.
[42] Bleidick 1985, 70.
[43] Bopp 1930, 1.
[44] Ebd..
[45] Ebd., 27-62.
[46] Ebd., 25.
[47] Bopp 1930, 35.
[48] Ebd., 34.
[49] Ebd., 35.
[50] Ebd..
[51] Ebd., 16.
[52] Bopp 1930, 265.
[53] Vgl. Joest 1990, 369 f.
[54] Vgl. ebd., 394 ff.
[55] Bopp 1930, 33.
[56] Vgl. Szagun 1983, 57 ff und 67 ff.
[57] Bopp 1930, 16.
[58] Ebd..
[59] Vgl. ebd., 16 und 266 f.
[60] Vgl. ebd., 267.
[61] Vgl. ebd., 277.
[62] Ebd., 267.
[63] Vgl. Joest 1990, 603.
[64] Bopp 1930, 238.
[65] Bopp 1930, 266 f.
[66] Vgl. ebd., 8.
[67] Ebd., 72.
[68] Bleidick 1983, 157.
[69] Bopp 1930, 8.
[70] Bopp 1930, 11 f.
[71] Ebd., 63.
[72] Vgl. ebd., 8.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Textvorschau?
Diese Textvorschau bietet einen umfassenden Überblick über ein wissenschaftliches Werk, einschließlich Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Es analysiert auch theologische, religiöse und parareligiöse Aspekte in heil- und sonderpädagogischen Kontexten.
Was sind die Hauptthemen, die im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Themen wie Einleitung, begriffliche Klärungen (Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Theologie, Religion, Parareligiösität), theologische, religiöse und parareligiöse Aspekte in den Entwürfen von Bopp, Haeberlin und Jantzen, Schlussbetrachtung und Ertrag sowie Literatur.
Wer sind Bopp, Haeberlin und Jantzen im Kontext dieses Textes?
Bopp, Haeberlin und Jantzen sind Autoren, deren Werke (Linus Bopp's "Allgemeine Heilpädagogik", Urs Haeberlin's "Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft", Wolfgang Jantzen's "Allgemeine Behindertenpädagogik") im Hinblick auf ihre theologischen, religiösen oder parareligiösen Aspekte analysiert werden.
Was ist der Unterschied zwischen Heilpädagogik und Sonderpädagogik, wie in der Textvorschau definiert?
Heilpädagogik ist der ältere Begriff, der sich auf "heilende Erziehung" bezieht, während Sonderpädagogik sich speziell auf die Pädagogik für Behinderte bezieht, insbesondere im Kontext des Sonderschulsystems. Der Text erörtert die Entwicklung und die verschiedenen Nuancen dieser Begriffe.
Wie definiert der Text Theologie, Religion und Parareligiösität?
Theologie und Religion werden im Zusammenhang mit Transzendenz, Heiligkeit oder Göttlichkeit definiert, während Parareligiösität als eine Weltanschauung mit religiösen Zügen oder Merkmalen beschrieben wird, obwohl sie nicht unbedingt als Religion anerkannt wird.
Was sind die Kernargumente von Linus Bopp's "Allgemeine Heilpädagogik" laut der Textvorschau?
Bopps Werk basiert auf der katholischen Theologie und betont das christologisch gedeutete Modell der Gottebenbildlichkeit. Behinderung wird als Wertsinnshemmung verstanden, und die Rolle des Heilerziehers wird mit der Rolle Christi verglichen.
Was ist der Ausgangspunkt der theologischen Begründung im Werk von Linus Bopp?
Die Verklammerung von Heilpädagogik und Christusgeschehen durch den Heilbegriff ist der Ausgangspunkt der theologischen Begründung im Werk von Linus Bopp.
- Quote paper
- Matthias Deiters (Author), 2002, Religiöse, parareligiöse und theologische Argumentationsfiguren in heil- bzw. sonderpädagogischen Entwürfen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113844